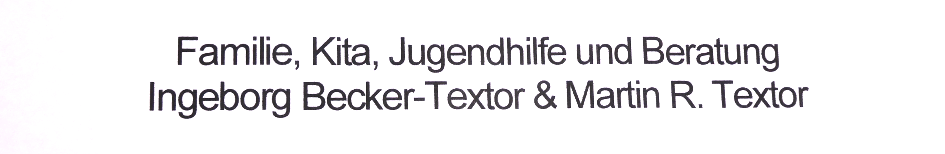Die Politik vor großen Aufgaben
Martin R. Textor
Ab den 1980er Jahre erblühte laut Professor Hasso Spode (Freie Universität Berlin) der Neoliberalismus, dessen Maxime "Ersetzung des Plans durch Markt, des Staates durch Vertrag, der Wohlfahrt durch Nächstenliebe" lautete. So hat der Staat durch Privatisierungen seine produktiven Bereiche - z.B. die Versorgung der Bürger mit Wasser, Energie, medizinischen Diensten usw. - zu einem mehr oder minder großen Teil abgegeben und beschränkt sich nun weitgehend auf Verwaltungsaufgaben. Gleichzeitig wurde der Sozialdemokratismus zurückgedrängt, da er unter den Bedingungen der Globalisierung als nicht mehr finanzierbar erschien.
Seit der Jahrtausendwende nimmt aber die Zukunftsorientierung der Politik wieder zu, die jedoch unter eher negativen Vorzeichen steht: dem Erkennen immer kleiner werdender Handlungsräume aufgrund von Staatsverschuldung und rasch wachsenden Sozialausgaben, der Wahrnehmung immer neuer sozialer Probleme, der Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, dem Streben nach einer "nachhaltigen Entwicklung" (für die vor allem die westlichen Länder "Opfer" erbringen müssten) und dem Eingeständnis der erodierenden nationalstaatlichen Souveränität und Marktkontrolle.
Der Staat wirkt heute bei vielen Herausforderungen und Problemen überfordert und scheint (Zukunfts-) Entwicklungen immer weniger beeinflussen oder gar steuern zu können. Dies wird laut Professor Fredmund Malik, Verwaltungsratspräsident des Management Zentrums St. Gallen, durch die extreme Komplexität der Probleme bedingt: Es ist eine "Komplexitätsgesellschaft" entstanden, deren Ausdifferenzierung durch die Globalisierung beschleunigt wird. Hyperkomplexe und ultradynamische Systeme sind selbst für Wissenschaftler nur schwer zu verstehen - was natürlich verstärkt für Politiker gilt, deren Problemlösekompetenz zudem noch durch das Parteienkalkül beeinträchtigt wird. Das Vertrauen der Bürger in die Politik wird deshalb in den nächsten Jahren weiter schwinden; die Massenflucht aus Parteien und Gewerkschaften wird sich fortsetzen.
In den kommenden Jahren muss sich die Politik vor allem den folgenden vier Problemlagen stellen:
1. Herausforderung: Finanzpolitik
In Deutschland betragen die Schulden der öffentlichen Haushalte mehr als 1,6 Billionen Euro - knapp 65% des Bruttoinlandsprodukts. Dazu kommt die sogenannte "implizite" Staatsverschuldung, die vor allem aus zwei Quellen stammt: nämlich den Pensionszusagen für Beamte und den erworbenen Leistungsansprüchen an die Sozialversicherungen. Aufgrund von Bevölkerungsrückgang und -alterung können diese Ansprüche in Zukunft immer weniger durch das Umlageverfahren bestritten werden; die Zuschüsse aus öffentlichen Kassen müssen also immer größer werden. Die implizite Staatsverschuldung beträgt laut Bund der Steuerzahler schätzungsweise 5 Billionen Euro.
Um diese hohe Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen, haben Bundestag und Bundesrat im Jahr 2009 eine "Schuldenbremse" für Deutschland beschlossen und im Grundgesetz verankert: Die Haushalte von Bund und Ländern sind in Zukunft grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen (Artikel 109 Abs. 3 GG), wobei der Bundeshaushalt dieser Vorgabe bereits entspricht, wenn die Einnahmen aus Krediten einen Wert von 0,35% des nominalen Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Für die kommenden Jahre gibt es noch Übergangsregelungen: Die Einhaltung der Vorgabe des ausgeglichenen Haushalts ist für den Bund ab dem Jahr 2016 und für die Länder ab dem Jahr 2020 zwingend vorgeschrieben. Nur in Notlagen wie Naturkatastrophen oder bei Konjunkturkrisen sind Ausnahmen möglich, für die aber eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen ist. So muss der Bund bereits ab 2011 das strukturelle Defizit in ungefähr gleich großen Schritten abbauen - das wären rund 10 Milliarden Euro pro Jahr bis 2016. Das wird nur mit großen Kürzungen im Bundesetat möglich sein.
Noch ist offen, ob sich Bund und Länder wirklich an die Schuldenbremse halten werden. Beispielsweise sieht der Bundeshaushalt für 2010 eine Rekordverschuldung von 80,2 Milliarden Euro und für 2011 eine Verschuldung von 57,5 Milliarden Euro vor - selbst 2014 wird die Neuverschuldung mit 24,1 Milliarden Euro noch über den Werten für 2007 (14,3 Milliarden Euro) und 2008 (11,5 Milliarden Euro) liegen. Zudem sind beim Bund die finanziellen Spielräume z.B. durch die Zinsausgaben für sein Schuldenportfolio begrenzt: Laut dem Finanzplan des Bundes für 2010 bis 2014 werden die Zinsausgaben von rund 36,1 Milliarden Euro im Jahr 2011 (11,7% der gesamten Bundesausgaben) bis zum Jahr 2014 auf ca. 48,1 Milliarden Euro (16,0% der Gesamtausgaben) anwachsen. Dieser Anstieg wird noch höher ausfallen, falls die Zinsen steigen sollten: Ein Zinsanstieg um 1% würde zu Mehrausgaben von rund 3,5 Milliarden Euro führen. Und irgendwann sollte ja zumindest ein Teil der Schulden getilgt werden...
Die finanziellen Spielräume des Bundes sind ferner durch die Personalkosten begrenzt, die mehr als 9% des Haushaltes ausmachen. Der größte Unsicherheitsfaktor liegt aber im Bereich der sozialen Sicherung, der im Haushaltsentwurf 2011 mit 158,8 Milliarden Euro 51,7% der gesamten Ausgaben des Bundes ausmacht. Laut Finanzplan sollen die Ausgaben für die soziale Sicherung bis 2014 auf 150,8 Milliarden Euro sinken.
Nach dem Sozialbericht 2009 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales stieg die Sozialleistungsquote (Sozialleistungen gemessen am Bruttoinlandsprodukt) von 27,6% im Jahr 1991 (direkt nach der Wiedervereinigung) über 31,2% im Jahr 2001 auf den bisherigen Höchststand von 32,4% im Jahr 2010. Bis 2012 soll er wieder auf 31,0% fallen.
Dies ist aber eher unwahrscheinlich, denn mittelfristig ist aufgrund der bereits beschriebenen Bevölkerungsentwicklung und deren Konsequenzen für die Sozialversicherungssysteme mit einem Anstieg der Ausgaben für die soziale Sicherung und damit auch der Sozialleistungsquote zu rechnen. Es ist fraglich, ob dann eine Neuverschuldung verhindert werden kann. Zudem werden die hohen Staatsschulden von immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter getilgt werden müssen. Schließlich ist unklar, inwieweit die Schuldenbremse zu einer Verlagerung von Aufgaben - und damit Ausgaben - auf die kommunale Ebene führen wird, was die Schulden der Städte, Gemeinden und Landkreise stark erhöhen könnte.
Wenn Bund, Länder und Gemeinden ab sofort keine neuen Kredite mehr aufnehmen und zusätzlich zu den gut 60 Milliarden Euro Zinsen pro Jahr 20 Milliarden Euro tilgen würden, könnten sie die letzten Schulden erst in rund 85 Jahren zurückzahlen.
2. Herausforderung: Sozialpolitik
Die Alterung der Gesellschaft wird zu immer höheren Ausgaben bei der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung führen. So werden die Sozialversicherungen in den kommenden Jahren schon bald an finanzielle Grenzen stoßen. Es wird dann nicht mehr möglich sein, durch höhere Sozialversicherungsbeiträge die Defizite zu decken. Dann müssen immer häufiger Leistungskürzungen vorgenommen werden.
Die notwendige Einsicht in diese unausweichlichen Entwicklungen fehlt aber noch bei den Bürgern - und selbst bei Gewerkschaften und Volksparteien, obwohl ihnen die Konsequenzen aus der Alterung der Bevölkerung schon seit vielen Jahren bekannt sind: So hat der Bundestag erst 2009 eine "Rentengarantie" beschlossen: Die Rente soll in schlechten Zeiten von Kürzungen verschont bleiben. Allerdings sollen in konjunkturell besseren Zeiten die unterlassenen Rentenkürzungen teilweise nachgeholt werden. Nachdem die Renten in den Jahren 2008 und 2009 überplanmäßig erhöht wurden und dies von 2011 an wieder ausgeglichen werden soll, drohen Rentnern nun mehrere Nullrunden.
In den letzten Jahren wurde durch Gesetzesänderungen versucht, die zukünftigen Ausgabensteigerungen bei der Rentenversicherung abzubremsen. Beispielsweise wird das Rentenalter bis 2018 sukzessive auf 67 Jahre erhöht. Gewerkschaften, einige Parteien und Verbände laufen derzeit gegen diese an sich sinnvolle Vorgabe Sturm, sodass nicht abzuschätzen ist, ob sie Bestand haben wird.
Im Jahr 2009 betrug die Standardrente nach 45 Versicherungsjahren in den alten Bundesländern netto vor Steuern (also nach Abzug der Sozialbeiträge) 1.088 Euro, was einem Standardrentenniveau von 50,2% entspricht. Viele Bürger haben noch nicht bewusst wahrgenommen, dass aufgrund verschiedener Reformen das Mindestsicherungsniveau bis zum Jahr 2020 auf 46% und bis zum Jahr 2030 auf 43% gesenkt werden kann. Zudem muss ein immer größerer Prozentsatz der Rente versteuert werden; ab 2040 greift die volle Steuerpflicht. So wird die Rente schon nach der jetzigen Gesetzeslage sinken.
Insbesondere bei Menschen, die während ihres Erwerbslebens nur ein geringes Einkommen erzielt haben oder längere Zeit arbeitslos waren, wird die Rente unter dem Niveau der Grundsicherung liegen. Sie wird dann entsprechend aufgestockt werden müssen. So sind heute mehr als 22% der Arbeitnehmer im Niedriglohn-Sektor beschäftigt, erhalten Hartz-IV-Empfänger für ein Jahr Arbeitslosengeld II nur einen monatlichen Rentenanspruch von 2,17 Euro, müssen Durchschnittsverdiener 25 Jahre lang arbeiten, um eine gesetzliche Rente auf dem Grundsicherungsniveau von 625 Euro zu erhalten - im Jahr 2030 werden es sogar 30 bis 35 Jahre sein. Deshalb droht nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes eine Altersarmut ungeahnten Ausmaßes. Schon jetzt müssten rund 700.000 Rentner Mini-Jobs übernehmen, um über die Runden zu kommen.
Auf den Staat kommt somit ein starker Anstieg der Ausgaben für die Grundsicherung bei Senioren zu. Aber nicht nur diese Kosten werden aus Steuereinnahmen finanziert, sondern auch der allgemeine und der zusätzliche Bundeszuschuss, mit denen 2009 bereits 27,6% der Rentenausgaben gedeckt wurden. Die Bundeszuschüsse werden ebenfalls in den kommenden Jahren ansteigen müssen. Irgendwann wird es dann nicht mehr möglich sein, durch höhere Steuern oder Verschuldung diese Mittel aufzubringen.
Hinzu kommt, dass es auch immer mehr Pensionäre geben wird. Nach einer Studie von Professor Dr. Winfried Fuest für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) wird die Zahl der Pensionäre von derzeit rund 930.000 auf circa 1,6 Millionen im Jahr 2050 steigen. So müssen Bund, Länder und Kommunen aus dem "Steuersäckel" einen immer größeren Betrag für Pensionen und Beihilfen verwenden: Die jährlichen Versorgungsausgaben werden sich ohne Änderungen am System der Altersversorgung im Öffentlichen Dienst bis zum Jahr 2050 versechsfachen und einen Gesamtbetrag von 137,1 Milliarden Euro erreichen. Das wären rund 6% der aktuellen Jahreswirtschaftsleistung.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, dass der Wert der Pensionsansprüche von Beamten kurz vor dem Ruhestand im Durchschnitt rund 400.000 Euro beträgt. Bei anderen abhängig Beschäftigten des gleichen Alters wären dies nur 160.000 Euro - oder 200.000 Euro, wenn man Arbeitslose und Personen in Ausbildung heraus rechnet. Ein Grund für den Unterschied liegt darin, dass die Höhe einer Beamtenpension auf Basis des Gehalts in den letzten Monaten des Berufslebens berechnet wird, bei Renten hingegen anhand der Summe aller Einzahlungen in die Rentenversicherung. Laut dem "Vierten Versorgungsbericht" der Bundesregierung beträgt die Durchschnittspension derzeit 2.520 Euro brutto.
Abgesehen davon, dass diese Bevorzugung von Beamten zunehmend als ungerecht empfunden wird, kann die aufgrund der Bevölkerungsentwicklung zurückgehende Zahl von Menschen, insbesondere von Erwerbstätigen, neben den steigenden Sozialversicherungsbeiträgen nicht auch noch höhere Steuern zahlen, um derartig hohe Pensionen zu finanzieren. Deshalb wird der Staat in den kommenden Jahren die Leistungen für Pensionäre radikal kürzen müssen.
So ist in den kommenden Jahren mit großen sozialen Spannungen zu rechnen. Auf der einen Seite werden die Menschen im Erwerbsalter stehen, die nicht immer höhere Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen wollen - und können. Sie werden von der Wirtschaft unterstützt werden. Auf der anderen Seite werden die Senioren stehen, die für den Erhalt der Leistungen von Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung bzw. für ihre Pensionen kämpfen werden. Sie werden schon alleine aufgrund ihrer zunehmenden Zahl immer mehr politische Macht erlangen: Bei der letzten Bundestagswahl waren bereits 33% der Wahlberechtigten älter als 60 Jahre - in 20 Jahren werden es mehr als 40% sein. Hinzu kommt, dass die Wahlbeteiligung im Seniorenalter deutlich höher ist als in allen anderen Altersgruppen. So müssen Politiker die Belange der alten Menschen immer mehr beachten - wobei sie auch von ihren Parteimitgliedern dazu gedrängt werden: In CDU und SPD ist schon fast die Hälfte der Mitglieder älter als 60 Jahre.
Die Politik ist gefordert, zwischen diesen beiden "Fronten" zu vermitteln und Gerechtigkeit zwischen den Generationen herzustellen, damit kein "Generationenkrieg" entsteht. Jedoch werden Ungerechtigkeiten unvermeidbar sein: So werden sich beispielsweise jüngere Menschen damit abfinden müssen, dass sie mehr in die Rentenversicherung "einzahlen", als sie später einmal herausbekommen werden. Der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg (Universität Bielefeld) verweist auch auf einen Interessengegensatz innerhalb jeder Generation, nämlich zwischen Menschen mit und ohne Kinder - Letztere würden als Senioren vom umlagefinanzierten sozialen Sicherungssystem mitversorgt, also von den Kindern anderer Menschen unterstützt. Jedoch wird die immer kleiner werdende Zahl von Familien wohl kaum die politische Macht erlangen, um z.B. einen geringeren Rückgang der Leistungen der Sozialversicherungen für Eltern durchzusetzen.
Die Politik erwartet, dass die Bevölkerung auf breiter Ebene Eigenverantwortung für die Sicherung ihres Lebensunterhalts im Alter übernimmt, und hat dafür besondere Möglichkeiten wie z.B. die Rürup- und die Riester-Rente geschaffen. Einer Studie des Allensbach-Instituts zufolge legte 2009 allerdings nicht nur jeder Sechste wegen der Finanzkrise deutlich weniger Geld für den Ruhestand zurück, sondern mehr als die Hälfte möchte auch künftig nicht mehr in ihre Altersvorsorge investieren. Jeder dritte Berufstätige in Deutschland sorgt überhaupt nicht für das Alter vor. Zudem wird immer mehr problematisiert, was eine "sichere" Altersvorsorge sei. Die meisten Deutschen halten ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung für "besonders sicher", bedenken aber nicht, dass es aufgrund des Bevölkerungsrückgangs immer weniger potenzielle Immobilien-Käufer geben wird. Wie bereits erwähnt, müssen Eigenheim- und Wohnungsbesitzer schon jetzt in Fortzugsregionen mit hohen Wertverlusten rechnen.
In den kommenden Jahrzehnten könnte es außerdem zu einem deutlichen Rückgang der Renditen an den Kapitalmärkten kommen - ja sogar eine "Kapitalmarktschmelze" (ein Zusammenbruch der Märkte) ist nicht auszuschließen: Da die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, geht zum einen die Kapitalproduktivität zurück. Zum anderen könnten - insbesondere vor dem Hintergrund sinkender gesetzlicher Renten - immer mehr Rentner ihre Aktien oder Zinspapiere verkaufen. Aufgrund der abnehmenden Zahl der Erwerbstätigen, die zudem aufgrund steigender Steuern und Sozialabgaben nur wenig Geld sparen können, könnte es dann mehr Verkäufer als Käufer geben. Die Wertpapiere müssten dann "verschleudert" werden - außer sie werden von den reicher werdenden Menschen in den Schwellenländern erworben.
Ferner wird die Politik in den kommenden Jahren neue Konzepte entwickeln müssen, wie vereinsamte alte Menschen in die Gesellschaft integriert und die Kosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen reduziert werden können. Politiker könnten das Entstehen einer "Hilfeleistungsgesellschaft" fördern, in der soziales Engagement, informelles Helfen und die Unterstützung älterer Menschen (z.B. durch Helferbörsen) eine große Rolle spielt. Ferner ist an gemeinschaftliche Wohnformen für Alt und Jung zu denken. Auch könnten neue Netzwerke wie Seniorengenossenschaften geschaffen werden, in denen sich ältere Menschen gegenseitig helfen. Außerdem könnten sich noch rüstige Senioren in Wohlfahrtsverbänden, Sozialprojekten und Freiwilligen-Agenturen ehrenamtlich engagieren. Schließlich könnten Beschäftigte des "zweiten Arbeitsmarktes" zur Betreuung alter bzw. pflegebedürftiger Menschen herangezogen werden.
Falls Politiker versuchen sollten, den Rückgang an erwerbsfähigen Menschen durch verstärkte Zuwanderung zu kompensieren, könnte die Integrationsfähigkeit des Landes überfordert werden: Auf Seiten der Einheimischen könnte es zu einem Rechtsruck kommen, auf Seiten der Einwanderer zur verstärkten Bildung von Subkulturen und Ghettos. Zudem wird derzeit intensiv diskutiert, ob die Zuwanderung seit den 1960er Jahren überhaupt zu positiven Effekten für Deutschland geführt habe.
Sinnvoller dürfte es sein, stärker auf die Bevölkerungs- und Familienpolitik zu setzen, um die Geburtenrate zu erhöhen. Hier wird immer wieder Schweden als Vorbild genannt: Weil sich Beruf und Familie dank Elterngeld und günstiger Betreuungsangebote gut vereinbaren lassen, ist nicht nur die Erwerbsbeteiligung von Frauen eine der höchsten in Europa, sondern auch die Geburtenrate. Akademikerinnen verzichten nicht häufiger als andere schwedische Frauen auf Nachwuchs; Städterinnen haben sogar mehr Kinder als Landbewohnerinnen.
3. Herausforderung: Wirtschaftspolitik
Während der Finanzkrise und der darauffolgenden Rezession haben Bund und Länder vor allem "alte" Wirtschaftsunternehmen wie Industriekonzerne, Kaufhausketten, Versandhäuser und Zeitungsverlage unterstützt. Laut dem brand eins-Redakteur Wolf Lotter werde bei "Wirtschaft" immer noch an "Fabrik" und "Produktionsbetrieb" gedacht. In den kommenden Jahren wird es aber darauf ankommen, dass vor allen Zukunftsbranchen gefördert werden - also Unternehmen, die den Schwerpunkt z.B. auf erneuerbare Energien, Informations- und Kommunikationstechnologie, Robotik, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrttechnik, Fahrzeug- und Maschinenbau, Nanotechnologie, chemische und pharmazeutische Produkte, neue Medien und Internet legen. Nur sie sind in einer globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig - Computer, Haushaltsgeräte, Konsumartikel, Textilien usw. können hingegen in Schwellen- und Entwicklungsländern preiswerter hergestellt werden. Außerdem müsste der Binnenmarkt belebt werden, der in Deutschland "traditionell" schwach ist - im Gegensatz zum Exportsektor.
Stark rohstoff- und energieabhängige Unternehmen werden in Zukunft mit Problemen rechnen müssen, da - wie bereits erwähnt - die Rohstoffvorkommen schwinden. So müssten einerseits erneuerbare Energien noch stärker als bisher gefördert werden, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Andererseits sollte das Recycling weiter ausgebaut werden, um Metalle und andere Rohstoffe zurückzugewinnen, oder es müssten Ersatzstoffe entwickelt werden.
Sowohl die Unternehmen als auch der Staat sollten die Mittel für Forschung und Entwicklung stark erhöhen, damit die deutsche Wirtschaft im weltweiten Wettbewerb mithalten kann. Auch Forschungseinrichtungen und wissensbasierte Einrichtungen müssten von Bund und Ländern verstärkt gefördert werden. Laut dem Deutschen Stifterverband investierten die Unternehmen 2008 rund 57,3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Die Wirtschaft hat damit eine FuE-Quote von 1,84% des Bruttoinlandsprodukts erreicht. Rechnet man die Ausgaben von Staat und Hochschulen hinzu, so lag die FuE-Intensität der gesamten Volkswirtschaft bei 2,54% im Jahr 2007. Damit wurde das Ziel von 3% des Bruttoinlandsprodukts nicht erreicht, das sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Jahr 2000 auf dem Gipfel von Lissabon zum Ziel gesetzt hatten. Laut OECD erzielten andere Länder höhere Werte als Deutschland: die USA mit 2,77%, Finnland mit 3,49%, Schweden mit 3,75% und Israel sogar mit 4,86% des Bruttoinlandsprodukts (2008).
Da in einer Wissensgesellschaft die Leistung der Wirtschaft in hohem Maße vom Bildungsstand der Arbeitnehmer abhängt, müssten auch die öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildung erhöht werden. Sie lagen dem OECD-Bildungsbericht 2009 zufolge in Deutschland mit 4,8% des Bruttoinlandsprodukts (2006) weit unter denen anderer OECD-Länder. Beispielsweise gaben die USA, Korea und Dänemark mehr als 7% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung aus. Wenn das Begabungspotenzial in der deutschen Bevölkerung bestmöglich ausgenutzt würde, könnte dadurch am ehesten dem sich anbahnenden Fachkräftemangel begegnet werden. Aber auch in die Fortbildung der Arbeitnehmer, deren Durchschnittsalter immer weiter zunehmen wird, müsste mehr investiert werden.
4. Herausforderung: Umweltpolitik
Dem Klimawandel kann nur begegnet werden, wenn weltweit der Ausstoß aller Treibhausgase reduziert wird. Hier sollten Deutschland und andere hoch entwickelte Länder mit gutem Beispiel vorangehen, weil sie im Gegensatz zu den Schwellenländern leichter die damit verbundenen Kosten schultern können. Die Entwicklungsländer tragen wenig zu den weltweiten CO2-Emissionen bei - mit Ausnahme in den Tropen durch das Abholzen und insbesondere das Abbrennen der Urwälder. Diese Umweltzerstörung wird aber nur begrenzt werden können, wenn die jeweiligen Länder eine relevante finanzielle Unterstützung durch die hoch entwickelten Länder erhalten.
Inzwischen sind viele Verfahren bekannt, mit denen in Deutschland der Ausstoß klimaschädlicher Gase reduziert werden könnte. So sind nach Industrieangaben über 25% der CO2-Emissionen mit technischen Innovationen im Energiesektor vermeidbar - diese müssten nur finanziert werden. Dazu gehören z.B. Windenergieanlagen, Biomasse- und Solarthermische Kraftwerke. Auch könnte durch den Emissionshandel die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern weiter verteuert werden. Schließlich ließe sich die Energieeffizienz verbessern.
Nach einer in "Spektrum der Wissenschaft" veröffentlichten Studie von Mark Z. Jacobson (Stanford University) und Mark A. DeLucchi (University of California in Davis) könnte mit 3,8 Millionen Windturbinen, 90.000 großen Solaranlagen, zahlreichen Erdwärme-, Wasser- und Gezeitenkraftwerken sowie Fotovoltaikmodulen auf allen dafür geeigneten Dächern der gesamte Energiebedarf der Welt gedeckt werden. Die derart gewonnene Energie würde schon 2020 weniger kosten als die von herkömmlichen Kraftwerken erzeugte.
Jedoch ist derzeit weder in Deutschland noch in anderen hoch entwickelten Ländern der politische Wille erkennbar, durch die vorgenannten und andere geeignete Maßnahmen die Emission von Klimagasen so schnell und so stark einzuschränken, dass die Erderwärmung bis 2100 auf 2 Grad begrenzt wird - zu groß ist die Angst vor Nachteilen für die eigene Wirtschaft. Laut Wolfgang Sachs vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie könnten die europäischen Reduktionsziele für Treibhausgase nicht bei einem jahrzehntelangen stetigen Wirtschaftswachstums erreicht werden. So müssten z.B. die fossile Energieindustrie, die Autoindustrie und die chemische Industrie schrumpfen, was nur schwer durch Wachstum in anderen Wirtschaftsbereichen auszugleichen sei. So kapituliert die Politik vor den Vertretern gut organisierter Wirtschaftszweige wie der Schwerindustrie und den Stromkonzernen. Statt die Nutzung erneuerbarer Energien zu intensivieren, wird die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert, befinden sich 19 neue Kohlekraftwerke im Genehmigungsverfahren, werden weitere 5 konkret geplant.
Schlusswort
Natürlich gibt es noch weitere politische Herausforderungen: Dazu gehören z.B. Probleme wie Langzeitarbeitslosigkeit, Lohndumping, soziale Ungleichheit (Armut), regionale Disparitäten, unzureichender Familienleistungsausgleich, fehlende Integration vieler Zuwanderer, Bürokratismus, die zunehmende Entfremdung zwischen Wirtschaft und Bevölkerung (wegen zu hoher Gehälter und Boni, wegen Kündigungen und Betriebsschließungen, wegen der Finanzkrise) etc. Auf sie soll an dieser Stelle aber nicht eingegangen werden.
Anmerkung
Eine umfassendere Darstellung von Zukunftsentwicklungen finden Sie in meinem Buch "Zukunftstrends - ein Überblick" (Books on Demand, 2. Aufl. 2021), das im Buchhandel und z.B. bei Amazon erhältlich ist.
Quelle
Aus: Martin R. Textor: Zukunftsentwicklungen: Trends in Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Norderstedt: Books on Demand 2010, S. 97-107