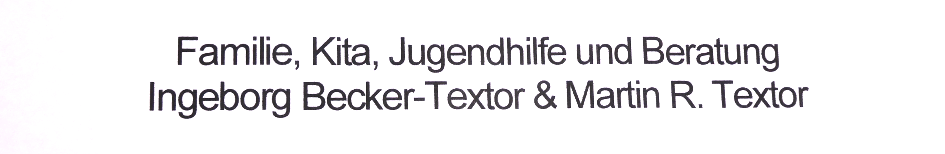Kinderleben heute
Martin R. Textor
Kind-Sein ist schwer. Da ist der weinende und schreiende Säugling, der sich überhaupt nicht beruhigen lässt. Da ist der tobende Dreijährige, für den eine Welt zusammengebrochen ist, weil er seinen Willen nicht durchsetzen konnte. Da ist die sehr klein gewachsene Achtjährige, die niedergeschlagen und verheult ist, weil sie ein Erwachsener gefragt hat, wie der Tag im Kindergarten verlaufen sei. Da ist der Zehnjährige, der sich wegen einer schlecht benoteten Arbeit kaum nach Hause traut. Da ist die Vierzehnjährige, die sich nachts in den Schlaf weint, weil ein von ihr angehimmelter Junge sie immer noch ignoriert. Da ist der Achtzehnjährige, der von seinem Ausbilder fortwährend verspottet wird.
Normales Kinderschicksal. Leid wechselt mit Freude, Unglücklichsein mit Glücklichsein. Dazwischen liegen Zeiten, in denen das Leben einfach so dahin fließt. Oft ist es nicht leicht, ein Kind zu sein.
Waren Kinder früher zufriedener und ausgeglichener? Wir wissen es nicht. Wohl ist uns bekannt, dass im frühen Mittelalter die meisten Kinder zusammen mit ihren Eltern und dem Vieh in einem Raum hausten, dass ihr Leben durch Pest, Cholera, Hungersnöte und Kriege bedroht war, dass sie mit sechs Jahren bereits erste Handlangerdienste wie das Gänsehüten übernehmen mussten. Wir kennen Pestalozzis Beschreibungen verwahrloster und halb verhungerter Kinder. Auch haben wir von den Millionen Kindern gelesen, die vor 150 Jahren in Bergwerken und Fabriken arbeiteten. Wir wissen von Montessoris Klagen über von ihrer Familie und der Gesellschaft verformte Kinder. Jedoch ist uns nicht bekannt, wie sich Kinder damals fühlten, wie es um ihre psychische Gesundheit stand. So wollen wir uns an dieser Stelle nicht ausführlich mit den guten - oder schlechten - alten Zeiten beschäftigen. Stattdessen wollen wir uns wieder der Gegenwart zuwenden.
Trotz des immer früher werdenden Beginns und der immer länger werdenden Dauer des Verbleibs von Kindern in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ist die Familie weiterhin die wichtigste Sozialisationsinstanz. Fünf Charakteristika der gegenwärtigen Situation von Familien sollen im Folgenden kurz skizziert werden.
1. Labilität der Familienverhältnisse: Viele Kinder erleben ihre Jugend nicht mehr in der Familie, in die sie hineingeboren wurden: Die Trennung und Scheidung der Eltern, das Aufwachsen in Teil- und Stieffamilien prägen die Lebensverhältnisse von Millionen Kindern. Oft wird sogar der generelle Verfall von Ehe und Familie erwartet. Aber täuschen wir uns nicht: In den letzten Jahrhunderten haben ebenfalls Millionen von Kindern die Auflösung ihrer Familien erlebt - wohl nicht bedingt durch Scheidung, sondern durch den sicherlich auch nicht leicht zu verarbeitenden Tod eines Elternteils. Sie haben die sozialen und wirtschaftlichen Probleme von Teilfamilien erfahren und mussten sich oft an einen Stiefelternteil gewöhnen.
Einige Unterschiede gibt es dennoch: Trennung und Scheidung sind im Gegensatz zu dem (früher bei Eltern zumeist rasch eintretenden Tod) Prozesse, die sich über einen langen Zeitraum erstrecken; das Durchlaufen des so genannten Scheidungszyklus kann fünf Jahre und länger dauern. Zudem sind diese Zeit und die vorausgegangenen Jahre meistens durch intensive Ehekonflikte und psychische Probleme der Eltern gekennzeichnet, die sich auf die kindliche Entwicklung negativ auswirken können. Ich betone: "können", denn viele Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Scheidungskinder im Vergleich zu anderen Kindern gar nicht sehr viel schlechter entwickeln. Aber die Tatsache bleibt, dass Kinder aus Scheidungs- und Teilfamilien unverhältnismäßig häufig unter Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Problemen leiden. Obwohl von Wissenschaftlern immer öfter betont wird, dass Teil- und Stieffamilien genauso gute Sozialisationsbedingungen bieten können wie Erstfamilien und somit nicht defizitär seien, gibt es in diesen Familienformen relativ häufig Schwierigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung führen können.
2. Erwerbstätigkeit von Müttern: Eine zunehmende Zahl von Müttern ist in den letzten Jahren erwerbstätig geworden bzw. während der Kinderphase geblieben. Auch dieses ist nichts Neues: In den vergangenen Jahrhunderten haben ebenfalls die meisten Frauen - und prozentual gesehen sogar mehr als heute - auf dem Hof, in Werkstätten, Geschäften und (später auch) Fabriken (mit-) arbeiten müssen. Aber im Gegensatz zu früher sind Mütter heute außerhäuslich erwerbstätig, also für ihre Kinder weniger verfügbar. Auch ist die Arbeit in der Regel psychisch belastender geworden (obwohl in vielen "Leichttarifgruppen" die physische Belastung weiterhin sehr hoch ist). So sind viele erwerbstätige Mütter gestresst und gereizt, haben wenig Geduld mit ihren Kindern, können sich auf Gespräche mit ihnen nicht wirklich einlassen, vernachlässigen sie unter Umständen.
Die erwerbstätige Frau, die als unabhängig gilt, die sich im Beruf verwirklicht und Freude an ihrem aktiven und abwechslungsreichen Leben hat, ist in den letzten Jahren zum Maßstab für die Hausfrau geworden - wobei das Hausfrauendasein ein wohl nun vorübergehendes Phänomen der letzten 50 bis 100 Jahre ist. Dieser Vergleich, der vermutlich eher an einem Mythos als an der Realität ausgerichtet ist, lässt das Hausfrauenschicksal als leer, öde, unbefriedigend, isolierend und langweilig erscheinen. So sind viele nichterwerbstätige Mütter unzufrieden und negativ gestimmt, erleben ihre Kinder als "Fessel" und lassen ihre Frustration an ihnen aus. Andere versuchen, über Erziehungserfolge zu Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung zu kommen. Sie überfordern ihre Kinder oder behüten und verwöhnen sie im Übermaß. In den meisten dieser Fälle wirken Väter wenig ausgleichend - von "neuer Väterlichkeit" ist wenig zu sehen, und wenn, dann nahezu nur in der Kleinkindphase.
3. Schwierige Erziehung: In den letzten Jahren sind die Erwartungen an die Familienerziehung immer mehr gestiegen - sowohl seitens der Gesellschaft, z.B. verkörpert durch Kindergarten und Schule, als auch seitens der Eltern selbst. Die meisten Eltern haben recht differenzierte Alltagstheorien über Erziehung entwickelt. Sie denken häufig über Erziehung nach und haben sich oft ein großes Wissen über diesen Bereich angeeignet. Jedoch sind Eltern auch zunehmend verunsichert. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate haben sie vielfach in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis keine Eltern mit etwas älteren Kindern, an deren Erziehung sie sich orientieren können. Manchmal hatten sie auch in ihrer Jugend keinen Kontakt zu Kleinkindern, sodass sie nicht frühzeitig gelernt haben, wie man mit ihnen umgeht. Zudem werden sie von den Medien mit einer Vielzahl einander widersprechender, verkürzter oder wenig belegter Erziehungskonzepte überhäuft. Die hieraus resultierende Unsicherheit führt oft zu Erziehungsfehlern. Dazu gehören neben problematischen Erziehungsstilen (antiautoritäre, autoritäre, inkonsistente Erziehung) die falsch verstandene Anwendung psychologischer (z.B. verhaltenstherapeutischer) Techniken oder der häufige Einsatz von Liebesentzug.
4. Kinder sind Wunschkinder: Aufgrund der Verbreitung von Empfängnisverhütungsmitteln und der relativ liberalen Handhabung des Schwangerschaftsabbruchs werden heute die meisten Kinder absichtlich gezeugt. Wunschkinder sollen dem Leben ihrer Eltern Sinn und Fortbestand geben, emotionale und psychische Bedürfnisse derselben befriedigen. Hier besteht die Gefahr, dass sie vereinnahmt werden: Der Sohn, mit dem Vati basteln will; die Tochter, die Muttis Vertraute ist; die Kinder, die einen ganz tollen Beruf ergreifen sollen und auf die ihre Eltern stolz sein wollen. Wird Erziehung als Weg zur Selbstentfaltung gesehen, fragen sich Eltern auch immer wieder: Was habe ich davon? Haben sie dann den Eindruck, auf andere Weise sich selbst verwirklichen zu können, mögen sie ihre Kinder als Hindernis und Belastung erleben. Die Erziehung kann dann umschlagen, oder es kommt zum fortwährenden Wechsel zwischen Phasen hoher Aufmerksamkeit bzw. großer Verwöhnung und des Ignorierens bzw. der Vernachlässigung.
5. Einzelkindheit: Viele Kinder sind Einzelkinder. Auch in der Vergangenheit fanden viele Kinder in ihren Familien keine Spielkameraden, da der Altersunterschied zwischen Geschwistern aufgrund der hohen Säuglingssterblichkeit oft zu groß war. Heute finden sie wegen der niedrigen Geburtenrate aber häufig auch in der Nachbarschaft keine Gleichaltrigen. So sind sie auf ihre Eltern als Spielkameraden angewiesen, beanspruchen ihre Zeit sehr stark, sind von ihnen zumindest in jüngeren Jahren hinsichtlich ihrer Lebensgestaltung abhängig. Zugleich sind sie das einzige Kind, in das die Eltern alle ihre Wünsche und Erwartungen hineinlegen. Problematische Entwicklungen können sich somit aus Überforderung, Überbehütung, Frühreife oder mangelnden sozialen Fertigkeiten ergeben.
Kindheit ist natürlich nicht nur Familienkindheit; sie spielt sich zunehmend in pädagogisch besetzten Räumen ab. Da sich Kinder aufgrund der großen Verkehrsgefährdung, der vielleicht übertriebenen Angst vor sexuellem Missbrauch (der sich zumeist in der eigenen Familie abspielt) und der zunehmenden Verstädterung immer weniger (unbeaufsichtigt) im Freien aufhalten können bzw. dürfen, findet ein großer Teil ihres Lebens in Tageseinrichtungen, in organisierten Gruppen, auf speziell für Kinder angebotenen Veranstaltungen, in Musikschulen, Clubs, Vereinen usw. statt. Ein zwangloses, selbst bestimmtes, spontanes und kreatives Handeln ist nur selten möglich - die Aktivitäten sind von Erwachsenen geplant und vorgegeben; es steckt eine mehr oder minder verdeckte Erziehungs- oder Unterweisungsabsicht dahinter; die Verhaltenskontrolle durch Erwachsene ist nahezu fortwährend gegeben. Kinder und Jugendliche wechseln zwischen vielen dieser Räume. Probleme können aus unterschiedlichen Regeln, Erwartungen und Anforderungen, aus verschiedenen Erziehungsstilen der vielen Bezugspersonen, aus Überforderung, (Schul-) Stress und mangelnder Selbständigkeit resultieren.
Für Kinder und Jugendliche verschwinden in unserer Gesellschaft zunehmend Möglichkeiten für die Umweltaneignung und Naturerfahrung durch Eigentätigkeit. Das kognitive, schulische Lernen steht im Mittelpunkt. Hier erlebt aber nur ein Teil der jungen Menschen Erfolgserlebnisse, gewinnt an Achtung und Selbstbewusstsein. Das Erkennen und Schulen eigener Fertigkeiten, die aus der eigenen Körperbeherrschung resultierende Selbstsicherheit, die sich aus Mutproben und Raufereien in der freien Natur ergebende Selbst- und Fremdbestätigung, die Freude am handwerklichen, schöpferischen Produzieren sind im Gegensatz zu früher nur noch selten gangbare Wege. So sind viele Kinder und Jugendliche unsicher, verängstigt, gehemmt, unkreativ und misserfolgsgewöhnt, beherrschen ihren Körper kaum und haben ein negatives Selbstkonzept.
Verstärkt wird die skizzierte Entwicklung fort von der Eigentätigkeit durch die wohl immer noch zunehmende Konsumorientierung. Kinder sind von einer Unmenge an Spielsachen umgeben, die nicht selbst hergestellt wurden und die nur wenige, vorgeschriebene Möglichkeiten zum Umgang mit ihnen offen lassen: Sie können nur konsumiert werden. Fernseher und Musikkassetten dienen zur "Ruhigstellung" der Kinder. Mit Süßigkeiten und Geschenken erleichtern Eltern ihr schlechtes Gewissen, wenn sie mal wieder zu wenig Zeit für sie hatten. Jugendliche konsumieren kommerzialisierte Freizeitangebote, Jugendzeitschriften, Fernsehprogramme und Videos - sie verbringen im Durchschnitt mehrere Stunden am Tag vor dem Bildschirm. Dort erlernen sie aber keine praktischen und sozialen Fertigkeiten, wird ihre kognitive Entwicklung nur unzureichend gefördert. Zudem werden sie in Filmen vorwiegend mit schlechten Vorbildern konfrontiert. Rollen, bei denen Personen mit ausgereiften Persönlichkeitsstrukturen und positiv zu bewertenden Umgangsformen gespielt werden, sind selten. Das Anschauen von Horrorvideos - eine weit verbreitete Form der Mutprobe - kann nur zur Abstumpfung der Gefühle führen.