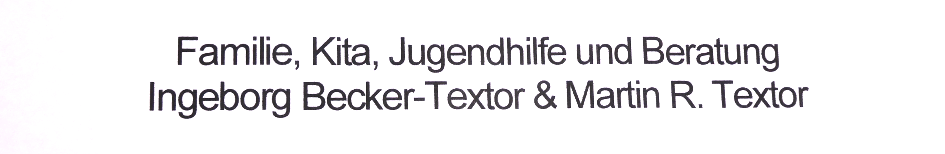Schulen der Familientherapie
Martin R. Textor
Schon in den Schriften des Konfuzius und in den alten griechischen Sagen wird die Rolle der Familie bei der Entstehung individueller Probleme erwähnt. Aber erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wurde erkannt, dass neben dem Symptomträger häufig auch andere Familienmitglieder psychisch oder verhaltensgestört sind, Symptome von einem Familienangehörigen an andere weitergegeben werden können und psychische Störungen oft komplementäre Beziehungen zwischen dem "Kranken" und einer anderen, "gesunden" Person voraussetzen. Auch beobachtete man, dass pathologische Familiensysteme psychische und Verhaltensstörungen erzeugen können und diese oft den Zusammenhalt der Familie garantieren. So wurde immer wieder erlebt, dass aus psychiatrischen Krankenhäusern als geheilt entlassene Patienten nach der Rückkehr zu ihren Familien rückfällig wurden oder in der Zwischenzeit andere Familienmitglieder psychisch oder psychosomatisch erkrankten. Auch beobachtete man immer häufiger pathogene horizontale, diagonale oder vertikale Dyaden, die sich meist von dem Rest der Familie und der Außenwelt abkapselten. Diese Beobachtungen und Erkenntnisse führten dann zur Entwicklung der Familienbehandlung.
"Familientherapie" ist der Sammelbegriff für eine Anzahl verschiedener psychotherapeutischer Ansätze zur Modifikation pathogener Familiensysteme, zur Verbesserung interpersonaler Beziehungen und zur Veränderung des Erlebens und Verhaltens individueller Familienmitglieder. Es werden Individuation und Autonomie, die Lösung von Konflikten und Problemen, die Stärkung der ehelichen Beziehung und ein befriedigenderes Zusammenleben aller Familienmitglieder angestrebt. Die Familientherapie soll der Familie bei der Erfüllung ihrer Reproduktions-, Sozialisations-, Erziehungs-, Spannungsausgleichs- und psychischen Stabilisierungsfunktion helfen und wird dabei durch die spezialisierteren Dienste wie Schwangerschafts-, Erziehungs-, Bildungs-, Ehe- und Sexualberatung unterstützt.
Viele Therapeuten sehen die Familientherapie als eine neue Zugangsweise zu den Problemen ihrer Patienten und als eine zusätzliche Methode in ihrem therapeutischen Repertoire an. Sie sprechen dann häufig von Indikationen und Gegenindikationen. So ergänzen sie ihre individuelle Orientierung durch eine interpersonale und familiendynamische.
Eine kleinere Gruppe sehen die Familientherapie als eine gänzlich andere Therapieform, ein ausschließliches Erkenntnismodell oder eine neue "Gestalt" an. Das Objekt der Diagnose und Therapie ist nicht mehr das gestörte Individuum, sondern das familiale Interaktionssystem. Individuelles Verhalten wird als durch das Familiensystem verursacht und auf es zurückwirkend verstanden. So liegen die Probleme des Symptomträgers in einer pathologischen Familiensituation begründet und sind als adaptiv zu verstehen. Werden die Struktur einer Familie und die Beziehungen in ihr modifiziert, so verändern sich auch die Persönlichkeitsstruktur und das Verhalten ihrer Mitglieder.
Wie jede andere Therapieform dient auch die Familientherapie der Korrektur von Sozialisations- und Erziehungsmängeln - sowohl von jenen, unter denen die Kinder einer Familie leiden und die bei ihnen Fehlentwicklungen hervorrufen, als auch von jenen, unter denen die Eltern während ihrer Kindheit litten und die zu Persönlichkeitsstörungen, negativ sich auswirkenden Introjekten, mangelnden Fertigkeiten und falschen Einstellungen führten oder nun Kommunikationsstörungen, Erziehungsfehler und Ehekonflikte bewirken. Jede Therapieform will diese Sozialisationsmängel und Fehlentwicklungen beheben.
Bei der Familientherapie ist wie bei den anderen Therapieformen die fortdauernde Beziehung zwischen dem Therapeuten und seinen Klienten die Grundlage der Therapie. Entsprechend den Forschungen von Rogers und Carkhuff ist diese Beziehung am erfolgversprechendsten, wenn sie in hohem Maße Wärme, unkonditionierte Zuwendung, positive Wertschätzung, Aufrichtigkeit, Konkretheit und Empathie enthält. Immer umfasst der Therapieprozess Informationsvermittlung, Veränderung von psychischen Prozessen und Verhaltensweisen, soziale Kontrolle und erzieherische Elemente.
Die Gruppentherapie wurde vor allem aus Effizienzerwägungen begründet und dient der Behandlung individueller Probleme innerhalb einer Gruppe oder der Modifikation des Sozialverhaltens. Betrachtet man die soziologische Definition der Familie als Kleingruppe, so scheinen Familien- und Gruppentherapie einander auf den ersten Blick hin ähnlich zu sein. Dieser Eindruck täuscht aber: Die Familie ist eine Einheit mit einer mehrere Generationen zurückreichenden Geschichte und einer gemeinsamen Zukunft. Sie ist eine natürliche Gruppe mit einer spezifischen Struktur, Kultur und Atmosphäre, befriedigt intime Bedürfnisse und erfüllt eine Vielzahl weiterer Funktionen. Ihre Mitglieder werden durch Geburt oder sexuelle Beziehung in die Familie integriert und unterliegen starken psychosozialen Kräften. Sie kennen einander genau, können Reaktionen der anderen Mitglieder vorhersagen und haben private Begriffsbedeutungen. Demgegenüber kommt bei der Gruppentherapie eine Anzahl Fremder zusammen. Sie haben keine gemeinsame Vergangenheit und Zukunft, arbeiten nur für eine kurze Zeit zusammen. So müssen die einzelnen Gruppenmitglieder zuerst ihre Probleme ausführlich darstellen und fühlen sich durch die Schwierigkeiten der anderen kaum betroffen. Der Therapeut ist anfangs stark mit der Gruppenbildung beschäftigt und muß erst gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit erreichen, während die Familie sofort ihre Probleme darstellt, intensive (negative) Gefühle ventiliert und sehr reaktiv ist.
Die Familien- und die Gruppentherapie gingen eine Synthese in der "multiplen Familientherapie" ein. Mehrere Familien treffen sich für normalerweise 90 Minuten mit einem oder zwei Therapeuten, um gemeinsame Probleme zu besprechen, durch Introspektion und aus der Beobachtung anderer Familien zu lernen, Rollen zu verändern und die Kommunikation in der Familie zu verbessern. Sie fühlen sich in der Gruppe weniger isoliert und stigmatisiert, sind freier und ungebundener, werden sich der in ihnen ablaufenden Prozesse leichter bewusst und lernen am Beispiel, durch Analogie, Identifikation, Interpretation sowie Versuch und Irrtum. Die Gruppe erlaubt die Bildung von aus Gleichaltrigen, Gleichgeschlechtlichen, Vätern oder Müttern bestehenden Subgruppen, deren Mitglieder einander besser verstehen und unterstützen können. Obwohl die multiple Familientherapie viele Vorteile der Gruppen- und der Familientherapie kombiniert, entstehen große Probleme aus der schwachen Position des Therapeuten und aus der Schwierigkeit, die verschiedenen Familien miteinander zu einer Gruppe zu verknüpfen.
Ehe- und Familientherapie entwickelten sich parallel und unabhängig voneinander sowie aufgrund anderer Motive - die Ehetherapie, um Eheprobleme zu lösen und die Beziehung zwischen Partnern zu verbessern, und die Familientherapie, um dem Symptomträger besser zu helfen und die Familie wieder funktionsfähig zu machen. Beide sind Produkte der heutigen pluralistischen und komplexen Gesellschaft mit ihren zerstörerischen Einflüssen auf Ehe und Familie. Leider befruchteten sie einander aufgrund ihrer getrennten Entwicklung und unterschiedlichen Orientierung nur wenig. In den letzten Jahren haben sich aber beide Therapieformen einander stark angenähert: So verschob sich in der Familientherapie der Brennpunkt vom identifizierten Patienten auf die Problemehe, während Ehetherapeuten mehr und mehr die Großeltern in die Therapie involvierten. So gibt es heute viele Gemeinsamkeiten.
Historische Entwicklung
Für längere Zeit wurde das Individuum von Psychologie, Soziologie und Medizin in Isolierung von seinen Mitmenschen erforscht. Man untersuchte sein Verhalten in künstlichen Klein- und Experimentiergruppen oder unter Einfluss gesellschaftlicher Ideologien und internalisierter Normen, berücksichtigte aber nicht die interpersonalen Prozesse. Nur manchmal befragte man den einzelnen über seine Beziehungen zu anderen, erkannte aber noch nicht die mangelnde Wissenschaftlichkeit dieser Methode.
Auch in der Familienforschung stand das Individuum im Mittelpunkt des Interesses. Die Soziologen untersuchten die Familie entsprechend den Rollen und Funktionen des Einzelnen, Psychoanalytiker in Hinblick auf die innerliche Verarbeitung inzestuöser und ödipaler Bestrebungen und Anthropologen mit Schwerpunkt auf der Weitervermittlung von Persönlichkeitscharakteristika und Handlungsmustern in verschiedenen Kulturen.
Erst musste in den Gesellschaftswissenschaften eine "kopernikanische Wende" (Haley) stattfinden, während der die Bedeutung interpersonaler Prozesse entdeckt wurde. Seit Beginn der 1950-er Jahre sieht man das Individuum nicht mehr als Mittelpunkt seiner Umgebung, sondern als durch gesellschaftliche, Beziehungs- und Systemprozesse gelenkt. Diese neue Sichtweise des Menschen und seiner Umwelt wurde durch zwei Paradigmawechsel eingeleitet: (1) Harry Stack Sullivan (1980) entdeckte das "Kommunikationsparadigma" (Levenson) in den 1920-er Jahren. Er konzeptualisierte interpersonale Beziehungen entsprechend kybernetischen und informationstheoretischen Modellen und studierte die wechselnden Muster von Signalen innerhalb dieser Beziehungen. Da er Symptome als das Produkt eines pathologischen Verhältnisses zwischen Mutter und Kind sah, bezog er die Eltern des psychisch kranken Kindes in die Behandlung ein. (2) Das "organismische Paradigma" (Levenson) wurde von Ludwig von Bertalanffy (1969) in den 1930-er Jahren entwickelt, der interpersonale Prozesse mit biologischen verglich und alle entsprechend einem Systemmodell beschrieb. Der Mensch wurde als ein aktives Persönlichkeitssystem konzeptualisiert, das mit anderen Systemen (Individuen, Familie, Kultur usw.) verbunden ist. Damit waren die Voraussetzungen für die Entstehung der Familientherapie geschaffen.
Wohl gibt es Vorläufer der Familientherapie, diese wurden aber erst retrospektiv entdeckt. So lassen sich Ansätze einer interpersonalen Theorie der psychischen Krankheit und Therapie zu einem 1877 veröffentlichten Artikel von Lasegue und Falret zurückverfolgen, welche die "folie à deux" beschrieben, die Wechselbeziehung zwischen den Psychopathologien verwandter Personen (nach Sonne 1972).
Sigmund Freud (1963) erkannte schon 1888, dass der Symptomträger (Hysteriker) oft nicht das einzige neurotische Familienmitglied ist und dass das Verhalten und die Einstellungen der Angehörigen die Symptome verstärken und hervorrufen können. Er beschrieb 1908, wie aus einer unbefriedigten, neurotischen Frau oft eine überängstliche Mutter wird, die ihr Kind bis lange nach dessen Adoleszenz an sich bindet, sich mit ihm identifiziert und es durch ein Übermaß an Zärtlichkeit sexuell stimuliert. Das Kind erlebt dann starke Gefühle der Liebe, des Hasses und der Eifersucht, die es unterdrücken muss und die zusammen mit einer aus der intensiven Bindung resultierenden Entwicklungshemmung zur Neurose führen. Diese Konstellation wurde später zum ÖdipuskonfIikt erweitert. Da Freud diesen aber schließlich in die Psyche der Person verlegte, wurde aus der im Ansatz vorhandenen interpersonalen Theorie eine monadische.
1909 behandelte Freud den "kleinen Hans". Er sprach dessen Mutter teilweise die Verantwortung für die Neurose und Regression ihres Sohnes zu und therapierte diesen indirekt durch die Beeinflussung seines Vaters - was heute wieder von Familientherapeuten praktiziert wird. 1914 beschrieb Freud Delegationsmechanismen. Ein Jahr später stellte er die These auf, dass das Unbewusste einer Person direkt auf das Unbewusste einer anderen einwirken kann. Dieses wurde dann in "Totem und Tabu" erweitert, als eine Art Familienpsyche und der unbewusste Austausch (einschließlich der Vererbung psychischer Charakteristika) zwischen den Generationen konzeptualisiert wurden.
1917 wurde noch einmal von Freud der negative Einfluss der Familienmitglieder auf den Neurotiker beschrieben: "Wer überhaupt weiß, von welchen Spaltungen oft eine Familie zerklüftet wird, der kann auch als Analytiker nicht von der Wahrnehmung überrascht werden, dass die dem Kranken Nächsten mitunter weniger Interesse daran verraten, dass er gesund werde, als dass er so bleibe, wie er ist. Wo, wie so häufig, die Neurose mit Konflikten zwischen Familienmitgliedern zusammenhängt, da bedenkt sich der Gesunde nicht lange bei der Wahl zwischen seinem Interesse und dem der Wiederherstellung des Kranken" (zitiert nach Sander 1978, S. 159). Alle diese Ansätze einer interpersonalen Theorie wurden aber von Freud nicht weiterverfolgt und gingen verloren.
Alfred Adler (1974) beachtete stärker als Freud die soziale Situation, in der das Kind aufwächst. Er sah die Entwicklung desselben durch die Beziehung zu beiden Elternteilen und den Geschwistern sowie durch deren Charaktere bestimmt. In der Therapie sprach Adler mit den Eltern über das Kind und bezog sie in die Behandlung ein. Diese Praxis wurde teilweise von der amerikanischen "Child Guidance Movement" in den 1930-er und 1940-er Jahren übernommen. Ein Psychiater behandelte das symptomatische Kind, ein Psychologe testete es, und ein Sozialarbeiter beeinflusste seine Eltern. Für die Entstehung der Familientherapie waren weiterhin die Beschreibung der "schizophrenogenen Mutter" durch Frieda Fromm-Reichmann, der mütterlichen "Überbesorgtheit" durch David Levy und des "symbiotischen Syndroms" durch Mahler bedeutsam.
In den 1950-er Jahren entwickelten dann einige amerikanische Therapeuten gleichzeitig und ohne Wissen voneinander die Familientherapie, da sie mit der relativen Erfolglosigkeit traditioneller Therapieformen bei der Behandlung von Schizophrenen, Verhaltensgestörten, Delinquenten, Farbigen und Klienten aus der Unterschicht unzufrieden waren. Aufgrund des starken, auf Anpassung gerichteten Drucks des psychoanalytischen Establishments entstand die Familientherapie als Untergrundbewegung, deren Pioniere gegen die Macht traditionell orientierter Psychiater ankämpfen mussten und oft in professionelle Isolierung gerieten. Zumeist wurden familientherapeutische Ansätze unter dem Schutzschirm von Forschungsprogrammen an den erwähnten "hoffnungslosen" Patientengruppen entwickelt.
1946 begannen Carl A. Whitaker und John Warkenton in Atlanta, Schizophrene und deren Familien zu behandeln. Um 1951 therapierte Nathan W. Ackerman in New York zum ersten Mal emotional gestörte Kinder und deren Familien. 1954 begann Hurray Bowen am "National Institute for Mental Health" mit der Hospitalisierung schizophrener Patienten und deren Familien, ein Projekt, das später von Lyman Wynne zusammen mit Rodney J. Shapiro und C. Christian Beels fortgeführt wurde. 1957 startete Ivan Boszormenyi-Nagy das "Family Therapy Project" mit schizophrenen Familien am "Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute", an dem James L. Framo, David Rubinstein, Ross V. Speck und Geraldine Spark teilnahmen. Ein Jahr später begann Alfred S. Friedman am "Philadelphia Psychiatric Center" das Forschungsprogramm "Family Treatment of Schizophrenia in the Home", an dem sich auch die zuvor genannten Therapeuten beteiligten.
Von 1952 bis 1962 führte der Anthropologe Gregory Bateson sein bekanntes Forschungsprojekt über Kommunikation, Schizophrenie und Therapietheorie in Palo Alto durch. Zu seinen Mitarbeitern gehörten Don D. Jackson, Virginia Satir, Jay Haley und John Weakland, die ab 1958 Familientherapie praktizierten. Ein Jahr später gründete Jackson das "Mental Research Institute", an dem die vorgenannten und später auch Paul Watzlawick arbeiteten.
Obwohl bereits 1953 von John E. Bell (1967) die wahrscheinlich erste Beschreibung der Familientherapie bei einer Konferenz der "Eastern Psychological Association" vorgelegt worden war, traten erst 1957 die Familienberater aus dem Untergrund hervor, als bei Tagungen der "American Psychiatric Association" und der "American Orthopsychiatric Association" Vorträge von Murray Bowen, Theodore Lidz u.a. gehalten wurden. Im gleichen Jahr veröffentlichte Christian Midelfort (1957) das erste Buch über Familientherapie.
In Großbritannien entwickelte John G. Howells 1949 die "Familienpsychiatrie". 1950 gründete er bereits am Ipswich Hospital eine Forschungsabteilung, an der u.a. 1.000 Familien untersucht und Tests entwickelt wurden. Vier Jahre später gab er das erste Seminar in Familienpsychiatrie in Zusammenarbeit mit der Universität von Cambridge. Gegen Ende der 1950-er Jahre begann Ronald D. Laing mit seinen berühmten Forschungen über Familien mit schizophrenen Mitgliedern.
In den 1950-er Jahren konzentrierten sich die Familientherapeuten (mit der Ausnahme von Ackerman und Bell) auf die schizophrenogene Familie. Es entstand eine Vielzahl von Behandlungsansätzen, was teilweise durch die räumliche Trennung der Therapeuten, deren Herkunft aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und unterschiedliche Persönlichkeitscharakteristika bedingt wurde. Die Theorien entstanden entweder aus den Methoden, die zur Lösung von in der Forschung entdeckten Problemen entwickelt wurden, oder aus dem Versuch, im Nachhinein die in der Therapiepraxis gefundenen Techniken zu begründen. Sie lassen sich grob in psychoanalytische und kommunikationstheoretische Ansätze unterteilen.
Zu Beginn der 1960-er Jahre ließ der große Enthusiasmus über die Erfolgsaussichten der Familientherapie nach, als erkannt wurde, dass besonders die schizophrenogene Familie äußerst komplex ist und sich nur schwer verändern lässt. Zudem reduzierte die Entwicklung der Psychopharmaka das Interesse an diesem Familientyp. So wurde die Familientherapie auf die Behandlung von Familien mit alkoholkranken, drogensüchtigen, ausagierenden und kriminellen Mitgliedern ausgeweitet. Auch arme, farbige, fragmentierte und Unterschichtfamilien wurden zum ersten Mal therapiert.
1962 gründeten Ackerman, Jackson und Haley mit "Family Process" die erste Zeitschrift für Familientherapeuten. Zwei Jahre später fand dann die erste Tagung von Familienberatern in Philadelphia statt. Anfang der 1960-er Jahre führte Salvador Minuchin ein Forschungsprojekt mit ausagierenden Jugendlichen an der New Yorker "Wiltwyck School" durch und begann etwa 1965 nach seiner Übersiedelung an die "Philadelphia Child Guidance Clinic" mit der familientherapeutischen Behandlung psychosomatischer Kinder. Jay Haley kam von Palo Alto nach Philadelphia und half Minuchin bei der Entwicklung der "strukturellen Familientherapie". Unter dem Einfluss der "experimentellen Therapie" Milton H. Ericksons (siehe Haley 1978a) begründete er dann aber einen eigenen therapeutischen Ansatz, die "strategische Familientherapie".
Ross V. Speck führte 1966 seine erste "Netzwerkintervention" mit einem schizophrenen Patienten und 40 anderen Personen durch. Zudem wurden in diesem Jahrzehnt die "Family Studies Section" am New Yorker "Albert Einstein College" von Israel Zwerling und Marilyn Mendelsohn, das "Chicago Family Institute" von Charles Kramer und das "Boston Family Institute" von Frederick J. Duhl und David Kantor gegründet. H. Peter Laqueur entwickelte die multiple Familientherapie und Robert MacGregor die "Multiple Impact Therapy".
Um 1960 begann Horst-Eberhard Richter in Berlin, Familientherapie zu praktizieren. 1963 veröffentlichte er mit "Eltern, Kind und Neurose" das erste deutsche Buch für Familientherapeuten. Kurz darauf führte auch Eckhard Sperling in Göttingen zum ersten Mal eine Familientherapie durch.
Um 1967 begann Mara Selvini Palazzoli in Mailand, Familientherapie zu praktizieren. Ein Jahr später führte Maurizio Andolfi seine erste Familienbehandlung in Rom durch. Beide Pioniere bildeten sich selbst aus und hatten große Probleme mit dem medizinischen Establishment.
Während die Familientherapeuten in den 1950-er Jahren vor allem nach der Rettung des Symptomträgers aus dem pathogenen Familiensystem trachteten, konzentrierten sie sich in den 1960-er Jahren mehr auf die Rettung der Familie aus inneren und äußeren Gefahren. Sie setzten den Behandlungsschwerpunkt auf die Ehebeziehung, aber berücksichtigten immer stärker den gesellschaftlichen Kontext und den Einfluss von Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft und der erweiterten Familie. Auch der Familienzyklus mit seinen Stufen, Aufgaben und Krisen wurde gründlicher untersucht. Die Gegensätze zwischen den am System und den am Individuum orientierten Familientherapeuten verschärften sich - erstere betonten insbesondere die auf dem Paradigmawechsel beruhende Unvereinbarkeit von Individual- und Familientherapie und fürchteten eine Verfälschung ihrer Erkenntnisse durch die Vermischung mit psychoanalytischen Konzepten und das Ignorieren von theoretischen Vorannahmen.
In den 1970-er Jahren wurde die Familientherapie in Nordamerika endgültig respektabel und gewann eine Vielzahl von Anhängern an den Universitäten und in den unterschiedlichsten Praxisfeldern und Berufsgruppen. So wurden überall Ausbildungs- und Forschungsprogramme geschaffen, Tests entwickelt, Experimente durchgeführt und Lehrbücher geschrieben. Während in den 1950-er Jahren rund 60 Artikel und in den 1960-er Jahren ungefähr 250 Artikel über Familientherapie veröffentlicht wurden, waren es in den 1970-er Jahren schon über 4.000.
1972 wurde das "International Journal of Family Counseling", 1974 die "Family Therapy", 1975 das "Journal of Marriage und Family Counseling", 1979 das "International Journal of Family Therapy" und 1980 die "Family Therapy Quarterly" gegründet. 1970 taufte man die "American Association of Marriage Counselors" in "American Association of Marriage and Family Counselors" um (19% der Mitglieder waren 1977 Psychologen, 19% Sozialarbeiter, 14% Pfarrer, 8% Soziologen und 26% "Eheberater").
1978 wurde eine Befragung von 500 amerikanischen Beratungsstellen und 1.117 Familientherapeuten veröffentlicht (Coleman und Davis 1978; Coleman und Stanton 1978): Danach waren 57,5% der Berater männlich, 56,2% verheiratet und 11,9% geschieden. 85% besaßen einen "Bachelor"- und 49,7% einen "Master"-Abschluss; 8,9% hatten promoviert. Zwei Drittel hatten eine Spezialausbildung in Familientherapie erhalten und durchschnittlich drei Jahre in diesem Bereich gearbeitet. An den meisten Beratungsstellen wurden mehr Individual- und Gruppentherapie als Familienberatung durchgeführt. Aber im Durchschnitt waren 24 Familien in Behandlung und trafen sich ein- bis zweimal pro Woche für wenige Monate bis zu einem Jahr mit den Beratern. Die Familientherapeuten fühlten sich in ihrer Vorgehensweise stark von Satir, Haley, Minuchin, Ackerman, Jackson, Whitaker und Bowen (in dieser Reihenfolge) beeinflusst, benutzten aber auch viele Techniken der Verhaltenstherapie. An 4% der Institutionen wurden Familien- und Therapieprozesse erforscht.
In den 1970-er Jahren breitete sich die Familientherapie fast über die ganze Welt aus. 1977 gründeten Familientherapeuten die italienische "Terapia Familiare" sowie 1980 "The Australian Journal of Family Therapy" und die südamerikanische "Terapia Familiar". In der Bundesrepublik Deutschland entstanden zwei Fachzeitschriften, die "Familiendynamik" (1976) und die "Partnerberatung". Die Zahl der an Familientherapie interessierten Therapeuten wuchs rasant an. So gab es 1980 bei der dritten Arbeitstagung "Analytische Familientherapie und Gesellschaft" (Heidelberg) schon 1.100 Teilnehmer. Ihre Ansprüche und die sich wandelnden Einstellungen der Klienten zwangen immer mehr Institutionen, sich auf die Familientherapie umzustellen, was vor allem für den ambulanten psychosozialen Bereich gilt.
Auch die Ausbildungsmöglichkeiten vermehrten sich: Seminare in Familientherapie werden heute an vielen Lehrstühlen für Psychologie und Sonderpädagogik sowie an Fachhochschulen für Sozialarbeit angeboten. Eine grundlegende Ausbildung ist insbesondere an den Universitäten Gießen (H.E. Richter), Heidelberg (H. Stierlin) und Göttingen (E. Sperling) möglich. Daneben gibt es mehrere private Ausbildungsinstitutionen wie z.B. das Münchner "Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie" (K.H. Mandel), das "Institut für Familientherapie e.V." (M. Bosch, R. Kaufmann) in Weinheim, das "Evangelische Zentralinstitut für Familienberatung" (M. Koschorke) in Berlin und das "Münchner Institut für integrative Familientherapie" (M. Kirschenbaum, C. Gammer).
Eine Fort- und Weiterbildung in Familientherapie wird nur von wenigen Berufsverbänden angeboten und erfolgt so meist informell durch Supervision und Fallbesprechungen. 1978 wurde die "Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie e.V." (A. Overbeck) in Gießen gegründet, deren 500 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen stammen und sich in Selbsthilfegruppen durch wechselseitige Supervision, gemeinsames Literaturstudium und Fortbildungswochenenden in der Familientherapie weiterbilden.
In den 1970-er Jahren begründeten Anhänger der Gestalttherapie, Transaktionsanalyse, klientenzentrierten Therapie, Individualpsychologie und Verhaltenstherapie eigene familientherapeutische Ansätze. Andere Fachleute entwickelten kurzzeitige problemorientierte Behandlungsformen und die Krisenintervention in Familien. Ferner wurden die ersten Spezialisierungen mit den Berufen des Scheidungsberaters und Sexualtherapeuten geschaffen. So bietet nun die Familientherapie das Bild einer rasant expandierenden, anerkannten und facettenreichen Therapieform.
Schulen der Familientherapie
Heute gibt es eine Vielzahl familientherapeutischer Ansätze. Sie unterscheiden sich nahezu in allen ihren Bestandteilen. Ihnen ist nur gemeinsam, dass die Familie als pathogen und als Behandlungseinheit konzeptualisiert wird.
Familientherapeutische Ansätze lassen sich erstens nach formalen Charakteristika untergliedern. So kann man zwischen Familientherapie mit einem Familienmitglied, einem Subsystem, der ganzen Familie, der erweiterten Familie, dem Netzwerk oder mehreren Familien (als Gruppe) trennen (vergl. Beels und Ferber 1972; Foley 1974). Oder man kann Krisenintervention, kurz-, mittel- und langfristige Therapie unterscheiden (Zuk 1974). Schließlich lässt sich in gemeinsame (die ganze Familie ist anwesend), serielle (Sitzungen mit der ganzen Familie und mit einzelnen Individuen bzw. Subsystemen wechseln einander ab), parallele (Individuen oder Subsysteme werden getrennt voneinander, aber vom gleichen Therapeuten behandelt) und kollaborative (einzelne Familienmitglieder oder Subgruppen werden getrennt voneinander durch kooperierende Berater behandelt) Familientherapie untergliedern, wobei jede dieser Formen stationär oder ambulant, als Gruppenbehandlung oder mit einem Kotherapeuten zusammen durchgeführt werden kann (vergl. Olson 1970; Stahmann 1977; Stanton 1979).
Zweitens kann man die familientherapeutischen Ansätze entsprechend ihrer Fundierung systematisieren. So unterscheidet beispielsweise Moeller (1977) zwischen psychoanalytisch orientierter (Richter, Stierlin, Willi, Strotzka, Bowen, Grotjahn, Boszormenyi-Nagy), gruppenanalytisch orientierter (Skynner), integrativer (Williams, Spiegel, Pollak, Ackerman), kommunikationstheoretischer (Jackson, Weakland, Haley, Satir, Watzlawick), systemorientierter (Minuchin) und verhaltenstherapeutischer (Patterson, Stuart, Liberman, Masters und Johnson) Familientherapie.
Drittens lassen sich die familientherapeutischen Ansätze nach ihrer Erscheinungsform klassifizieren. So beobachteten beispielsweise Beels und Ferber (1972) verschiedene Therapeuten während der Behandlung und trennten nach dem jeweiligen Arbeitsstil zwischen (1) "conductors", welche die Klienten führen, eigene Werte und Ziele durchsetzen, aktiv, direktiv und dominant sind (Ackerman, Satir, Bowen, Minuchin, Tharp, MacGregor, Paul, Bell), (2) "reactor-analysts", die Interaktionen und Verhalten psychoanalytisch erforschen, Übertragungen und innere Prozesse behandeln und meist in Kotherapie arbeiten (Whitaker, Wynne, Boszormenyi-Nagy, Framo), und (3) "system purists", welche die Familie heimlich durch indirekte, paradoxe oder komplexe Interventionen lenken, Systemprozesse, Regeln, Machtkämpfe und beobachtbares Verhalten untersuchen und oft verschiedene Rollen übernehmen (Haley, Jackson, Zuk).
Eine vierte Systematisierungsmöglichkeit ergibt sich aus dem Vergleich von ausgewählten Theorieelementen. So unterscheidet beispielsweise Feldman (1976a) vier verschiedene Ansätze nach der Art und Weise, wie Therapeuten Veränderungen erzielen: (1) Dem "Paradigma der Einsicht" zufolge verändern sich Menschen, wenn sie sich mit Hilfe des Therapeuten entweder der unbewussten Gedanken, Gefühle und Einstellungen bewusst werden, deren Herkunft erforschen und dissoziierte Persönlichkeitselemente integrieren (Paul, Framo, Ackerman) oder die Wechselwirkung zwischen dem eigenen Handeln und dem anderer Familienmitglieder erkennen und ihr Beziehungsverhalten modifizieren (Bell, Minuchin, Beels, Ferber). (2) Nach dem "Paradigma der Konditionierung" verändern sich Menschen nach einer Modifikation von Stimulusmustern oder Verstärkungsprogrammen (Eisler, Hersen). (3) Entsprechend dem "Paradigma des Modelllernens" erfolgt eine Verhaltensänderung aus der Beobachtung des Verhaltens eines Therapeuten und seiner Interaktion mit anderen Menschen (Liberman, Ackerman, Paul, Whitaker). (4) Nach dem "Paradigma des Paradoxes" verändern sich Menschen, wenn der Therapeut sie paradoxen Situationen aussetzt, in denen ihr Verhalten anders werden muss und ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt wird (Hoffman, Weakland, Haley, Jackson).
Obwohl ich rund 25 verschiedene Klassifikationsversuche familientherapeutischer Ansätze fand, möchte ich hier keinen übernehmen, da meist nur wenige Therapieansätze verglichen und die anderen übersehen oder zu viele unterschiedliche Theorien in einer Rubrik inkorporiert wurden. Oft waren auch die Kategorien zu eindimensional oder nur wenig relevant. So entwickelte ich eine eigene Klassifikation, welche die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sechs Schulen der Familientherapie entlang von fünf Dimensionen aufzeigt. Ich trenne zwischen der
- "strategischen Familientherapie": Haley, Jackson, Madanes, Palazzoli, Rabkin, Watzlawick, Zuk
- "strukturellen Familientherapie": Andolfi, Minuchin, Walrond-Skinner
- "verhaltenstherapeutischen Familientherapie": Liberman, Mandel, Mash, Patterson
- "Therapie der erweiterten Familie" (oder "Netzwerkintervention"): Attneave, Bell, Bowen, Rueveni, Speck
- "erfahrungsbezogenen Familientherapie": Howells, Kantor, Kempler, Kirschenbaum, Lehr, Luthman, Napier, Satir, Whitaker
- "psychodynamischen Familientherapie": Ackerman, Boszormenyi-Nagy, Framo, Friedman, Gerlicher, MacGregor, Richter, Synner, Spark, Stierlin
Sie unterscheiden sich entlang folgender fünf Dimensionen:
(1) Theorieschwerpunkt. In jeder Sitzung wird der Therapeut mit dem unendlich komplexen verbalen und nonverbalen Verhalten der anwesenden Familienmitglieder konfrontiert. Es ist ihm unmöglich, gleichzeitig die unzähligen Elemente der ablaufenden Interaktionen und Transaktionen wahrzunehmen, zu erfassen, zu ordnen und daraus Schlüsse über nichtbeobachtbare Vorgänge wie Motivationen und über Interventionsmöglichkeiten zu ziehen. Deshalb muss jeder Familientherapeut eine Therapietheorie besitzen oder entwerfen, die sein Augenmerk und seine Eingriffe nur auf bestimmte bedeutsame Verhaltensaspekte lenkt - auf eine beschränkte, dadurch aber erfassbare und auswertbare Anzahl von Elementen.
Demzufolge kann und wird es zum einen nur unvollständige Therapietheorien geben. Und zum anderen wird die Zahl unterschiedlicher Ansätze auch in Zukunft noch zunehmen, da jeder Familientherapeut andere Elemente in der Behandlungssituation beobachten, beschreiben, in Beziehung zueinander setzen und für Diagnose und Therapie auswerten wird. Diese Auswahl von Elementen erfolgt nach gewissen, willkürlich oder unwillkürlich gesetzten Schwerpunkten, die sich in dem Familienmodell, den Vorstellungen von der gesunden und der kranken Familie sowie in der Therapietheorie und -praxis niederschlagen. Diese Theorieschwerpunkte lassen sich nach einer Anzahl von Kategorien ordnen und erlauben so die Unterscheidung verschiedener Schulen der Familientherapie.
Die strategischen Familientherapeuten konzentrieren sich auf die Systemprozesse, die sich in der familialen Homöostase, in Regeln, Transaktionen und Interaktionen sowie im beobachtbaren Verhalten der Familienmitglieder äußern. Dagegen setzen die strukturellen Familientherapeuten den Schwerpunkt auf die Anordnung und Abgrenzung der familialen Subsysteme. Dabei werden auch die Art der Rollenausübung durch die Familienmitglieder und der Einfluss der die Familie umgebenden Systeme beachtet. Die auf der Lerntheorie fußende verhaltenstherapeutische Schule beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erfassung der Symptome des "Kranken", mit ihrer Entstehung und mit der Rolle, die andere Familienmitglieder als Verstärker problematischen Verhaltens spielen. Generell werden wechselseitige Verstärkungsprozesse und Familienkonflikte untersucht.
Die Netzwerkinterventen setzen den Schwerpunkt auf die theoretische Durchdringung und auf die Behandlung der erweiterten Familie, eventuell unter Einschluss von Freunden und anderen signifikanten Personen. Sie erforschen die im Netzwerk ablaufenden Prozesse, die auftretenden Probleme und die Selbstheilungskräfte. Die erfahrungsbezogenen Familientherapeuten konzentrieren sich wie die Verhaltenstherapeuten auf das Individuum im Kontext seiner Familie - nicht aber auf dessen beobachtbares Verhalten, sondern auf sein Selbst- und Welterleben, seine Gefühle und Bedürfnisse. Auch die psychodynamischen Familientherapeuten beschäftigen sich mit dem Individuum, jedoch hauptsächlich mit seinem Unbewussten, seinen Introjekten, Motivationen und Abwehrmechanismen sowie seiner Persönlichkeitsentwicklung. In Beziehung dazu setzen sie dann die Familiendynamik und erforschen beispielsweise wechselseitige Übertragungen und Projektionen, unbewusste Verträge und Loyalitätsbindungen.
(2) Familienpathologie. Jeder Familientherapeut muss eine Pathologietheorie besitzen oder entwickeln, die ihm hilft, krankhafte Elemente in Familien und Individuen zu erkennen und diese in Anamnese und Diagnose zu erfassen. Eine solche Theorie ist besonders nützlich, wenn nicht nur pathologische Erscheinungsformen beschrieben, sondern auch pathogene Mechanismen aufgezeigt werden, denn auf diese sollen sich ja die Interventionen richten. Eine vollständige Pathologietheorie nennt pathogene Vorgänge auf den Ebenen der Gesellschaft, der Familie, ihrer Subsysteme und ihrer einzelnen Mitglieder.
Die strategischen Familientherapeuten konzentrieren sich auf die Erfassung der Symptome, die ihrer Meinung nach aus der falschen Handhabung alltäglicher Schwierigkeiten, aus destruktiven Sichtweisen von sich selbst und den anderen oder aus Machtkämpfen, krankmachenden Beziehungen und Kommunikationsstörungen resultieren. Auch die Verhaltenstherapeuten beschäftigen sich hauptsächlich mit Symptomen, die von ihnen jedoch als aufgrund einer ungewollten positiven Verstärkung gelernte falsche Verhaltensweisen definiert werden. Auch ein Mangel an positiver Verstärkung und das Fehlen effektiver Problemlösungstechniken können pathogen wirken.
Für strukturelle Familientherapeuten sind pathologische Familien durch eine gestörte Struktur, d.h. durch zu lockere oder zu enge Beziehungen, intergenerationale Koalitionen und mangelhaft ausgeübte Rollen gekennzeichnet. Auch die Netzwerkinterventen beschäftigen sich hauptsächlich mit der Beziehungspathologie, wobei fehlende gegenseitige Unterstützung, Isolation, Verwicklung, Rollendysfunktion und Projektion im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die erfahrungsbezogenen Therapeuten versuchen, pathogen wirkende Erlebnisse zu ermitteln, insbesondere solche, die aus Kommunikationsmängeln oder negativen Emotionen resultieren. Die Psychodynamiker schließlich charakterisieren pathologische Erscheinungen auf der Beziehungsebene z.B. durch Symbiosen, Auftragskonflikte, Rollenzuschreibungen und Mythen sowie auf der intrapsychischen Ebene durch unbewusste Konflikte, Neurosen, Persönlichkeitsdefizite usw.
(3) Therapieziele. Ein wichtiges Element einer jeden Therapietheorie sollten Vorstellungen über die "gesunde" Familie sein, von denen dann die Behandlungsziele abzuleiten sind. Jedoch bietet sich Familientherapeuten nur äußerst selten die Gelegenheit, "normale" Familien zu erforschen, da diese ja nicht zu ihrer Klientel gehören. Überraschenderweise gibt es auch in anderen Wissenschaftsbereichen kaum Literatur bzw. empirische Untersuchungen über diesen Familientyp. So findet man meist nur vorwissenschaftliche Annahmen über die "gesunde" Familie, die den Behandlungszielen der Familientherapeuten zugrunde liegen.
Die Therapieziele sollen das anzustrebende Behandlungsergebnis darstellen, die einzelnen Therapiephasen determinieren, jede Intervention lenken und eine Evaluation des Behandlungserfolgs ermöglichen. Die verhaltenstherapeutischen und die strategischen Familientherapeuten streben eine Symptomreduktion sowie eine Problem- und Konfliktlösung an. Erstere versuchen, diese durch die Veränderung von Verstärkungsprogrammen und das Lehren bestimmter verhaltenstherapeutischer Techniken und letztere durch die Veränderung von Sichtweisen, Regeln, Hierarchien und Kommunikationsweisen zu erreichen.
Die strukturellen Familientherapeuten wollen vor allem verstrickte Familienmitglieder zur Individuation und losgelöste zur Verbundenheit führen. Die Netzwerkinterventen möchten die erweiterte Familie stärken sowie Freunde und Bekannte als Helfer mobilisieren. Erfahrungsbezogene Therapeuten wollen neue Erlebnisse vermitteln, andersartige Gefühle stimulieren, bessere Kommunikationsweisen lehren, Individuation und Spontaneität fördern. Und die Psychodynamiker schließlich streben Einsicht und Katharsis, Autonomie und gegenseitige Bindung, eine Versöhnung der Familienmitglieder und eine bessere wechselseitige Bedürfnisbefriedigung an.
(4) Therapietechniken. Aus den unterschiedlichen Familienmodellen resultieren andersartige therapeutische Techniken, durch die den Behandlungszielen entsprechende Veränderungen herbeigeführt werden sollen. Besonders die erstgenannten drei Schulen der Familientherapie verwenden eine Vielzahl von Techniken. Die strategischen Familientherapeuten planen ihre Vorgehensweise genau und setzen vor allem paradoxe Techniken wie die Symptomverschreibung ein. Zudem werden Sichtweisen verändert und Kommunikationsmuster verbessert. Die Verhaltenstherapeuten benutzen meist von den Lerntheorien abgeleitete Techniken wie die Verhaltensübung, das Selbstsicherheitstraining, die Konditionierung, das Feedback oder die Extinktion, während die strukturellen Familientherapeuten viel mit Modelllernen, angeleiteter Beobachtung, Umdefinition, Grenzziehung und Klarifikation arbeiten.
Die Netzwerkinterventen verwenden viele für Encounter-Gruppen, Psychodrama und Familienskulptur entwickelte Techniken, aber auch Interpretation und Rückmeldung. Vor allem leiten sie jedoch ihre Klienten an, Probleme gemeinsam und selbständig zu lösen und einander zu helfen. Die erfahrungsbezogenen Therapeuten versuchen, ihr Selbst, ihre eigenen Gefühle und Erlebnisse in die Behandlung einzubringen und so als Vorbild zu wirken. Sie rufen neue Emotionen und korrektive Erfahrungen hervor und lehren kongruente Kommunikationsweisen. Die Psychodynamiker verwenden dynamische und genetische Interpretationen, analysieren Übertragungen und Widerstände, leiten einen interfamilialen Kontenausgleich an.
(5) Therapiedauer und -auswertung. Die strategische und die verhaltenstherapeutische Familientherapie sowie die Netzwerkintervention sind aufgrund ihrer Problemorientiertheit meist kurzfristig, während die Behandlungen durch die mehr wachstumsorientierten Vertreter der drei anderen Schulen gewöhnlich mittel- bis langfristig sind.
Dann ist noch kurz auf die Art der Therapieauswertung einzugehen: Die strategischen und die verhaltenstherapeutischen, aber auch die strukturellen Familientherapeuten legen meist sehr klare und objektive Erfolgsauswertungen vor, die sich größtenteils auf die Symptomreduktion beziehen. Aus den anderen drei Schulen kommen fast nur subjektive Evaluationen.
Erfolgsquoten in der Familientherapie
In den 1950-er und Anfang der 1960-er Jahre waren die Familientherapeuten sehr enthusiastisch über ihre neuen Theorien und Techniken, erwarteten durchgreifende Veränderungen im Bereich der psychosozialen Berufe und enorme Behandlungserfolge. Von Mitte der 1960-er Jahre an nahmen dann die Therapieauswertungen an Zahl und Qualität zu und führten zu einer gewissen Desillusionierung: Der erwartete überragende Erfolg blieb aus.
DeWitt (1978) fasste die Ergebnisse von 23 Untersuchungen über den Erfolg der Familientherapie mit zumeist kindlichen oder jugendlichen Symptomträgern zusammen: In 55% (im Bereich von 29 bis 90%) aller Fälle (n=576) traten große, in 9% mittelmäßige und in 8% kleine Verbesserungen ein; in 27% (im Bereich von 10 bis 54%) der Fälle änderten sich Patienten und Familien nicht oder verschlechterte sich ihr Zustand; 1% brach die Therapie vorzeitig ab.
Gurman und Kniskern (1978b) fassten die Ergebnisse von 75 Untersuchungen zur Auswertung der (nicht verhaltenstherapeutischen) Familientherapie zusammen:
(1) 26 Studien über ambulant behandelte Familien (n=879) berichteten von durchschnittlich 76% Verbesserungen, 23% kleinen oder fehlenden Veränderungen und 1% Verschlechterungen.
(2) Drei Untersuchungen über Familientherapie an "Day Hospitals" (n=194) ergaben Verbesserungen in 59%‚ kleine oder mangelnde Veränderungen in 37% und Verschlechterungen in 4% aller Fälle.
(3) Zehn Studien über stationäre Familientherapie (n=341) nannten Verbesserungen für 78% und kleine bzw. fehlende Veränderungen für 22% der Population.
(4) 39 Berichte über Familientherapie allgemein (n=1.414) sprachen von durchschnittlich 75% Verbesserung. 24% kleiner oder fehlender Veränderung und 1% Verschlechterung.
Nach Gurman und Kniskern (1978a) zeigt die Durchsicht von 38 Studien über die Auswertung verhaltenstherapeutischer Familientherapie, dass diese etwa gleich erfolgreich wie die nicht verhaltenstherapeutische ist. Allerdings sind viele positive Veränderungen bei Nachuntersuchungen verschwunden oder werden nicht generalisiert. In fünf von sechs Vergleichsuntersuchungen war die verhaltenstherapeutische Familientherapie erfolgreicher als andere Therapieformen.
Beim Vergleich nicht verhaltenstherapeutischer Familientherapie mit unbehandelten Kontrollgruppen war erste in acht von 13 Untersuchungen besser. Wurde sie mit anderen Therapieformen verglichen, so war sie in 10 von 14 Studien erfolgreicher. Vergleicht man allerdings die Prozentsätze in Übersichten über die Therapieauswertung von Familientherapie mit denen über die Evaluation anderer Therapieformen, so erkennt man, wie klein diese Unterschiede sind: Einem Erfolg in durchschnittlich 68% aller Fälle stehen 66,4% in der Kindertherapie (n=9.359) (Levitt 1971), rund 60% in der Individualtherapie Erwachsener (Bergin 1971) und 61% in der Ehetherapie (n=1.528) (Gurman und Kniskern 1978a) gegenüber.
Gurman und Kniskern zeigen auch die Faktoren auf, die normalerweise zu einem größeren Erfolg führen: Der Therapeut sollte erfahren sein und schnell eine Beziehung zu den Patienten aufbauen können. Besonders seine zwischenmenschlichen Fertigkeiten sind von großer Bedeutung und wichtiger als therapeutische Techniken. Meist ist der Therapeut erfolgreicher, wenn er den Familienvater in die Behandlung einbeziehen kann. Kotherapie und Therapiedauer wirken sich normalerweise nicht auf das Behandlungsergebnis aus.
Allerdings weisen die meisten Untersuchungen zur Therapieauswertung, auf die sich die vorgenannten Übersichten stützen, gravierende Mängel auf. Es handelt sich insbesondere um folgende:
(1) Eine Randomisierung bei der Aufstellung von Therapie- und Kontrollgruppen oder eine repräsentative Auswahl von Therapeuten fanden nicht statt. So waren die behandelnden Berater oft noch unerfahren oder befanden sich in der Ausbildung. Die Kontrollgruppen waren häufig zu klein und zu heterogen oder ihre Mitglieder denen der Versuchsgruppen nicht genau zugeordnet. Zudem mögen sich pathologische Familien schon aufgrund von Schuldgefühlen, Stigmatisierung, Angst usw. anders als gesunde Familien in der gleichen Untersuchungssituation verhalten. Die Gründe letzterer für die Teilnahme an den Forschungsprogrammen sind unbekannt (mögen z.B. indirekt Hilfe suchen). Zudem können sie keiner Therapie unterzogen werden, so dass Kontrollgruppen oft aus pathologischen Familien mit andersartigen Symptomträgern gebildet werden - ihnen gegenüber mögen sich aber Forscher und Therapeuten anders verhalten.
(2) Die Familie und die Therapiesituation sind so komplex, dass in den Untersuchungen selten alle bedeutsamen Variablen berücksichtigt werden konnten. Beispielsweise wurden der Kontext, der verwendete therapeutische Ansatz und die Charakteristika von Therapeuten und Patienten meist nicht erfaßt und mit dem Therapieergebnis in Beziehung gesetzt.
(3) Die psychischen Störungen und Krankheiten der Symptomträger wurden oft nicht genau spezifiziert und beschrieben.
(4) Viele Therapieauswertungen maßen unterschiedliche Variablen, die häufig unklar definiert und schwer objektiv zu bestimmen waren (z.B. Einsicht, Persönlichkeitsveränderungen, familiendynamische Prozesse). Manche Forscher studierten Modifikationen nur auf der Ebene des Individuums und nicht auf den Ebenen der Subsysteme und des Familiensystems. Statistische Evaluationen wurden kaum durchgeführt.
(5) Unterschiedliche Methoden, Tests, Skalen und Befragungstechniken wurden verwendet; die Validität und Reliabilität der Messinstrumente waren gering. Die Auswertung mag auch durch die Einstellung des Therapeuten (Rosenthal-Effekt), die Beziehung zwischen ihm und der Familie sowie durch subjektive Faktoren (z.B. Voreingenommenheit des Therapeuten bei Eigenberichten) verfälscht worden sein.
(6) Oft mangelte es an Vor- oder Nachuntersuchungen sowie an Daten über die Dauer der Veränderungen und über Rückfälle. Der Therapieprozess wurde nur selten erforscht.
So muß gesagt werden, dass die einzelnen Untersuchungen, auf die sich die beschriebenen und andere Übersichten stützen, wissenschaftlich nicht einwandfrei und schwer miteinander zu vergleichen sind. Insbesondere geben sie kaum Hinweise darauf, welcher Therapieansatz (z.B. mit welcher Patientenpopulation) die besten Ergebnisse erzielt.
Weitere Probleme der Familientherapie
Andere Probleme liegen in der Zersplitterung des familientherapeutischen Feldes in einzelne Schulen, die wiederum unterschiedliche, aber einander in einigen Aspekten ähnliche Ansätze umfassen. Die meisten Theorien, Hypothesen und Konzepte über Familien, interpersonale Beziehungen, pathogene Vorgänge, Therapieprozesse usw. wurden empirisch nicht validiert - zu wenig Familientherapeuten arbeiten im Bereich der experimentellen Forschung. Zudem sind viele Teiltheorien und Begriffe so vage, unsystematisch und abstrakt abgefasst, dass sie auch gar nicht empirisch getestet werden können. Auch bleibt unklar, inwieweit sich Theorie und Praxis unterscheiden.
Bis heute wurden "normale" Familien und Verhaltensweisen nur wenig untersucht. Es fehlt an Forschungsergebnissen über die "gesunde" oder "durchschnittliche" Familie und so fällt es vielen Beratern schwer, Therapieziele aufzustellen. Aber auch die meisten pathologischen Familientypen sind noch nicht eindeutig beschrieben und klassifiziert worden. Einige Formen wurden kaum erforscht, während es über andere eine Vielzahl unterschiedlicher Theorien gibt. So fehlt eine Nosologie kranker Familien, insbesondere eine, die auf einer Taxonomie von interpersonalen Verhaltensweisen oder Systemprozessen beruht. Auch mangelt es an Versuchen, die Theorien der Familientherapeuten mit experimentellen, entwicklungspsychologischen, soziologischen oder anthropologischen Forschungsergebnissen zu verknüpfen.
Die meisten Therapeuten haben auch zu wenig die Familientypen in verschiedenen Randgruppen und den Einfluss der Werte und Normen spezifischer Subkulturen untersucht. So ist erst relativ wenig über die Therapie von Gastarbeiter- oder Unterschichtfamilien, von Bauern- oder Arbeiterfamilien, von vaterlosen Familien oder solchen mit berufstätigen Müttern geschrieben worden. Auch die Bedeutung der Emanzipationsbewegung und dem politischen, ökonomischen, erzieherischen und religiösen Systeme für Familie und Therapie wurden nur unzureichend erforscht. Offen bleibt auch die Frage, inwieweit die Familientherapeuten an einer Gesellschaftsveränderung mitwirken können. So ist es beispielsweise für viele schwierig, ihren Klienten moderne Einstellungen über die Geschlechtsrollen zu vermitteln. Sie können sich nicht wirklich von den internalisierten Stereotypen trennen, selbst wenn es ihnen intellektuell gelingt.
Andere Probleme resultieren aus der fehlenden Institutionalisierung der Familientherapie. So gibt es noch keine offizielle familientherapeutische Ausbildung oder die staatliche Anerkennung als "Familientherapeut". Eine Veränderung dieser Situation ist in der nahen Zukunft nicht zu erwarten. Das hat zur Folge, dass normalerweise familientherapeutische Behandlungen von Krankenkassen nicht finanziert werden. Nur Psychiatern, Psychoanalytikern und Psychagogen wird eine Familientherapie bezahlt, wenn sie die Abrechnung mit dem alten medizinischen Krankheitsbegriff begründen und nicht mehr Kosten als bei einer Individualtherapie verursachen. Niedergelassenen Therapeuten wird manchmal Geld von Krankenkassen, Sozial- oder Jugendämtern bewilligt, wenn diese mit Ersparnissen (z.B. Vermeidung einer Hospitalisierung) rechnen. Auf der anderen Seite bieten aber meist Erziehungsberatungsstellen und Universitätsinstitute Familientherapie kostenlos an.
Ein anderes Problem tritt in den Institutionen auf, in denen sich Ärzte, Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter familientherapeutisch betätigen. Obwohl sie die gleiche Arbeit (oft im Team) tun, werden sie unterschiedlich bezahlt und haben einen anderen Status, was als ungerecht empfunden wird. Ferner mangelt es an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Familientherapie für diese Berufsgruppen.
Auch gibt es Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen Familientherapeuten und den (psychologisch mangelhaft ausgebildeten) Ärzten, Lehrern, Juristen, Pfarrern und Kindergärtnerinnen. Bei einem verbesserten Informationsfluss könnte es vermehrt zu Überweisungen kommen. Unbefriedigend ist auch, dass kaum Ratsuchende aus der Unterschicht und aus Randgruppen mit Familientherapeuten in Kontakt kommen. Generell fehlen Beratungsstellen in Kleinstädten, ländlichen Gemeinden und Randgebieten, während es in Großstädten oft lange Wartelisten gibt. Häufig ist die Innenausstattung der Beratungsstellen unbefriedigend.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Familientherapie in den 30 Jahren ihrer Existenz wohl als Therapieform im psychosozialen Bereich Anerkennung fand, sich aber noch im Versuchsstadium befindet. Auf der einen Seite hat sie mit den gleichen Problemen wie die anderen Therapieformen zu kämpfen, auf der anderen Seite entstehen Schwierigkeiten aufgrund der Vielzahl - einander befehdender Schulen.
Quelle
Aus: Martin R. Textor (Hrsg.): Das Buch der Familientherapie. Sechs Schulen in Theorie und Praxis. Eschborn: Fachbuchhandlung für Psychologie - Verlagsabteilung 1984, S. 1-39 (bearbeitete Fassung)
Literatur
Ackerman, N.W. (1958): The Psychodynamics of Family Life. Diagnosis and Treatment of Family Relationships. New York
Ackerman, N.W. (1966): Treating the Troubled Family. New York
Ackerman, N.W. (1970): Family Psychotherapy and Psychoanalysis - Implications of Difference. In: N.W. Ackerman (Ed.): Family Process. New York, S. 5-18
Adler, A. (1974): Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Frankfurt
Andolfi, M. (1979): Family Therapy: An Interactional Approach. New York
Bateson, G. et. al. (1969): Schizophrenie und Familie. Frankfurt
Beels, C. and Ferber, A. (1972): What Family Therapists Do. In: A. Ferber, M. Mendelsohn and A. Napier (Eds.): The Book of Family Therapy. Boston, S. 168-209
Bell, J.E. (1961): Family Group Therapy. Washington
Bell, J.E. (1967): Family Group Therapy - A New Treatment Method for Children. Family Process 6, S. 254-263
Bell, J.E. (1975): Family Therapy. New York
Bergin, A.E. (1971): The Evaluation of Therapeutic Outcomes. In: A.E. Bergin and S.L. Garfield (Eds.): Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: An Empirical Analysis. New York, S. 217-270
Bergin, A.E. and Lambert, M.J. (1978): The Evaluation of Therapeutic Outcomes. In: S.L. Garfield and A.E. Bergin (Eds.): Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: An Empirical Analysis. Second Edition. New York, S. 139-189
Bertalanffy, L. von (1969): General System Theory. Foundations, Development, Applications. Second Printing. New York
Bieliauskas, V.J. (1977): Mental Health Care in the USSR. American Psychologist 32, S. 376-379
Bloch, D.A. (1976): Family Therapy, Group Therapy. International Journal of Group Psychotherapy 26, S. 289-299
Boszormenyi-Nagy, I. and Spark, G.M. (1973): Invisible Loyalties. Reciprocity in Intergenerational Family Therapy. New York
Boszormenyi-Nagy, I. und Framo, J.L. (Hg.) (1975): Familientherapie. Theorie und Praxis. Bd. 1, 2. Reinbek
Bowen, M. (1978): Family Therapy in Clinical Practice. New York
Bundesregierung (1975): Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland - Zur psychiatrischen und psychotherapeutisch/ psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung. Deutscher Bundestag. Drucksache 7/4200. Bonn
Coleman, S.B. and Davis, D.I. (1978): Family Therapy and Drug Abuse: A National Survey. Family Process 17, S. 21-29
Coleman, S.B. and Stanton, M.D. (1978): An Index for Measuring Agency Involvement in Family Therapy. Family Process 17, S. 479-483
Crolla-Baggen, M., Ven, P. van de und Staps, T. (Hg.) (1978): Partner- und Familienberatung. Freiburg
DeWitt, K.N. (1978): The Effectiveness of Family Therapy: A Review of Outcome Research. Archives of General Psychiatry 35, S. 549-561
Dierking, W. (1978): Tagungsbericht: Analytische Familientherapie und Gesellschaft. 2. Arbeitstagung vom 28.4. bis 1.5.1978 in Giessen. Psychosozial 1 (2), S. 145-151
Dierking, W. (1980): Familientherapie in der Bundesrepublik Deutschland. Familiendynamik 5, S. 290-304
Feldman, L.B. (1976a): Strategies and Techniques of Family Therapy. American Journal of Psychotherapy 30, S. 14-28
Feldman, L.B. (1976b): Processes of Change in Family Therapy. Journal of Family Counseling 4, S. 14-22
Fieldsteel, N.D. (1974): Family Therapy - Individual Therapy: A False Dichotomy. In: L.R. Wolberg and M.L. Aronson (Eds.): Group Therapy 1974. An Overview. New York, S. 45-56
Foley, V.D. (1974): An Introduction to Family Therapy. New York
Fox, R.E. (1976): Family Therapy. In: I.B. Weiner (Ed.): Clinical Methods in Psychology. New York, S. 451-515
Framo, J.L. (1981): A Dynamic Approach to Marital and Family Therapy. New York
Freud, S. (1963): Gesammelte Werke. Frankfurt
Friedman, A.S. et. al. (Eds.) (1970): Psychotherapy for the Whole Family. Second Printing. New York
Friedman, A.S. et. al. (Eds.) (1971): Therapy with Families of Sexually Acting-Out Girls. New York
Gerlicher, K. et. al. (Hg.) (1977): Familientherapie in der Erziehungsberatung. Weinheim und Basel
Grotjahn, M. (1960): Psychoanalysis and the Family Neurosis. New York
Group for the Advancement of Psychiatry (1970): The Field of Family Therapy. Report No. 78. New York
Guerin, P.J., Jr. (1976): Family Therapy: The First Twenty-Five Years. In: P.J. Guerin, Jr. (Ed.): Family Therapy. Theory and Practice. New York, S. 2-22
Gurman, A.S. and Kniskern, D.P. (1978a): Research on Marital and Family Therapy: Progress, Perspective, and Prospect. In: S.L. Garfield and A.E. Bergin (Eds.): Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: An Empirical Analysis. Second Edition. New York, S. 817-901
Gurman, A.S. and Kniskern, D.P. (1978b): Deterioration in Marital and Family Therapy: Empirical, Clinical, and Conceptual Issues. Family Process 17, S. 3-20
Haley, J. (1971a): A Review of the Family Therapy Field. In: J. Haley (Ed.): Changing Families. A Family Therapy Reader. New York, S. 1-12
Haley, J. (1971b): Family Therapy: A Radical Change. In: J. Haley (Ed.): Changing Families. A Family Therapy Reader. New York, S. 272-284
Haley, J. (1977): Direktive Familientherapie. Strategien für die Lösung von Problemen. München
Haley, J. (1978a): Die Psychotherapie Milton H. Ericksons. München
Haley, J. (1978b): Gemeinsamer Nenner Interaktion. Strategien der Psychotherapie. München
Haley, J. (1980): Leaving Home. The Therapy of Disturbed Young People. New York
Heckel, R.V. (1975): A Comparison of Process Data from Family Therapy and Group Therapy. Journal of Community Psychology 3, S. 254-257
Howells, J.G. (1963): Family Psychiatry. Edinburgh
Howells, J.G. (1978a): Familien-Psychotherapie. Grundlagen und Methoden. München
Howells, J.G. (1978b): Developments in Family Psychiatry in the United Kingdom. Journal of Marriage and Family Counseling 4, S. 133-141
Jackson, D.D. (Ed.) (1968a): Communication, Family and Marriage. Palo Alto
Jackson, D.D. (Ed.) (1968b): Therapy, Communication and Change. Palo Alto
Kanfer, F.H. and Goldstein, A.P. (Eds.) (1975): Helping People Change: A Textbook of Methods. New York
Kantor, D. and Lehr, W. (1975): Inside the Family. San Francisco
Keil, S. (1979): Konzeption und Organisation familienrelevanter Beratung in der Bundesrepublik Deutschland. München
Kempler, W. (1975): Grundzüge der Gestalt-Familientherapie. Stuttgart
Leitner, U. (1976): Problem Familie? Antworten aus der empirischen Sozialforschung. In: H. Braun und U. Leitner (Hg.): Problem Familie - Familienprobleme. Frankfurt, S. 22-31
Levitt, E.E. (1971): Research on Psychotherapy with Children. In: A.E. Bergin and S.L. Garfield (Eds.): Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: An Empirical Analysis. New York, S. 474-494
Liberman, R.P. et. al. (Eds.) (1981): Handbook of Marital Therapy. New York
Luthman, S.G. und Kirschenbaum, M. (1977): Familiensysteme. München
MacGregor, R. et. al. (1964): Multiple Impact Therapy with Families. New York
MacGregor, R. (1970): Group and Family Therapy: Moving into the Present and Letting Go of the Past. International Journal of Group Psychotherapy 20, S. 495-515
Madanes, C. (1981): Strategie Family Therapy. San Francisco
Madanes, C. and Haley, J. (1977): Dimensions of Family Therapy. Journal of Nervous and Mental Disease 165, S. 88-98
Mash, E.J. et. al. (Eds.) (1976a): Behavior Modification and Families. New York
Nash, E.J. et. al. (Eds.) (1976b): Behavior Modification Approaches to Parenting. New York
Mandel, K.H. (1979): Therapeutischer Dialog. München
Midelfort, C. (1957): The Family in Psychotherapy. New York
Minuchin, S. (1978): Familie und Familientherapie. Theorie und Praxis struktureller Familientherapie. 2. Aufl. Freiburg
Minuchin, S. et. al. (1967): Families of the Slums. An Exploration of Their Structure and Treatment. New York
Minuchin, S. et. al. (1978): Psychosomatic Families. Anorexia Nervosa in Context. Cambridge
Moeller, M.L. (1977): Familientherapeutische Konzepte. Medizin, Mensch, Gesellschaft 2, S. 194-201
Napier, A.Y. and Whitaker, C.A. (1979): Tatort Familie. Düsseldorf
Olson, D.H. (1970): Marital and Family Therapy: Integrative Review and Critique. Journal of Marriage and the Family 32, S. 501-538
Olson, D.H. and Sprenkle, D.H. (1976): Emerging Trends in Treating Relationships. Journal of Marriage and Family Counseling 2, S. 317-329
Overbeck, A. (1978): Tagungsbericht: Analytische Familientherapie und Gesellschaft. Kongreß vom 16.-19. Juni 1977 in Giessen, Bundesrepublik Deutschland. Psychosozial 1 (1), S. 141-144
Palazzoli, M.S. (1974): Self-Starvation. From the Intrapsychic to the Transpersonal Approach to Anorexia Nervosa. London
Palazzoli, M.S. et. al. (1977): Paradoxon und Gegenparadoxon. Ein neues Therapiemodell für die Familie mit schizophrener Störung. Stuttgart
Patterson, G.R. (1977): Soziales Lernen in der Familie. München
Pongratz, L.J. (1975): Lehrbuch der Klinischen Psychologie. Psychologische Grundlagen der Psychotherapie. 2. Aufl. Göttingen
Rabkin, R. (1976): Strategic Psychotherapy: Brief and Symptomatic Treatment. New York
Richter, H.E. (1969): Eltern, Kind und Neurose. Reinbek
Richter, H.E. (1970): Patient Familie. Reinbek
Riess, B.F. (1976): Family Therapy as Seen by a Group Therapist. International Journal of Group Psychotherapy 26, S. 301-309
Rueveni, U. (1979): Networking Families in Crisis. New York
Sander, F.M. (1978): Ehe und Familie in Sigmund Freuds Schriften. Familiendynamik 3, S. 148-163
Satir, V. (1967): Conjoint Family Therapy. Revised Edition. Palo Alto
Satir, V. (1975): Selbstwert und Kommunikation. Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe. München
Skynner, A.C.R. (1976): Systems of Family and Marital Psychotherapy. New York
Skynner, A.C.R. (1978): Die Familie. Schicksal und Chance. Handbuch der Familientherapie. Olten
Sonne, J.C. (1972): Family Therapy of Sexually Acting-Out Girls. In: H.L.P. Resnik and M.E. Wolfgang (Eds.): Sexual Behaviors. Social, Clinical, and Legal Aspects. Boston, S. 281-304
Sperling, E. (1979): Heutige Familien in Deutschland. Kontext 1, S. 9-23
Stahmann, R.F. (1977): Treatment Forms for Marital Counseling. In: R.F. Stahmann and W.J. Hiebert (Eds.): Klemer's Counseling in Marital and Sexual Problems. A Clinician's Handbook. Second Edition. Baltimore, S. 3-16
Stanton, M.D. (1979): Family Treatment Approaches to Drug Abuse Problems: A Review. Family Process 18, S. 251-280
Stierlin, H. (1975a): Eltern und Kinder im Prozeß der Ablösung. Frankfurt
Stierlin, H. (1975b): Psychoanalyse und Familientherapie. Stuttgart
Stierlin, H. (1978): Delegation und Familie. Frankfurt
Strelnick, A.H. (1977): Multiple Family Group Therapy: A Review of the Literature. Family Process 16, S. 307-325
Sullivan, H.S. (1980): Die interpersonale Theorie der Psychiatrie. Frankfurt
Talmadge, J.N. (1975): Adler, Sullivan, and Family Counseling. Family Therapy 2, S. 173-180
Walrond-Skinner, S. (1976): Family Therapy. The Treatment of Natural Systems. London
Watzlawick, P., Weakland, J.H. und Fisch, R. (1974): Lösungen. Bern
Wells, R.A. and Dezen, A.E. (1978): The Results of Family Therapy Revisited: The Nonbehavioral Methods. Family Process 17, S. 251-274
Zuk, G.H. (1974): Engagement and Termination in Family Therapy. In: L.R. Wolberg and M.L. Aronson (Eds.): Group Therapy 1974. An Overview. New York, S. 34-44
Zuk, G.H. (1975a): Familientherapie. Interventionen und therapeutische Prozesse. Freiburg
Zuk, G.H. (1975b): Process and Practice in Family Therapy. Haverford
Zuk, G.H. (1979): Theories of Family Pathology: In What Direction? International Journal of Family Therapy 1, S. 356-361