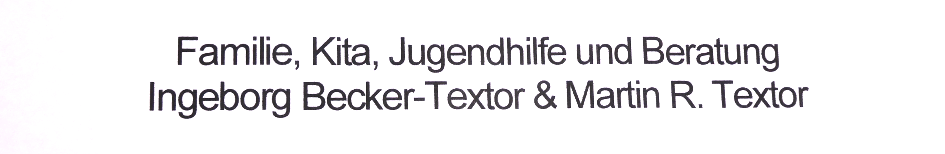Eltern und Pädagogen – "natürliche" Partner bei Erziehung und Bildung
Martin R. Textor
Familie, Kindertageseinrichtung und Schule sind die drei gesellschaftlichen Institutionen, welche die kindliche Entwicklung in den ersten 10 Lebensjahren entscheidend prägen. Über ihren Einfluss, über ihr Zusammenwirken sowie über Erziehung und Bildung sind Tausende von Büchern und Zeitschriftenartikeln veröffentlicht worden. So können in dem folgenden Referat nur einige Aspekte der Fachdiskussion behandelt werden. Es ist zugegebenermaßen eine subjektive Auswahl: Da meine Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Frühpädagogik und Elternbildung liegen, werde ich mich zum einen mehr auf Kindertageseinrichtungen und Familien als auf Schulen beziehen. So werde ich die Bedeutung dieser Institutionen für die Erziehung und Bildung des Kindes herausarbeiten und auf die Notwendigkeit ihrer Kooperation im Rahmen einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft eingehen. Zum anderen werde ich mich vor allem mit der kognitiven Entwicklung von Kindern befassen. Diese Schwerpunktsetzung erfolgt vor dem Hintergrund der intensiven Diskussion über die Ergebnisse der beiden PISA-Studien und der OECD-Länderstudien über die frühkindliche Betreuung. In diesem Kontext wurde immer wieder konstatiert, dass die Bildung von Kleinkindern in Österreich und Deutschland vernachlässigt worden wäre. So möchte ich vor allem darauf eingehen, wie Eltern und Kindergärtner/innen in Familie bzw. Kindertageseinrichtung sowie in der Kooperation miteinander die kognitive Entwicklung von Kindern fördern können.
Die (frühe) Kindheit aus Sicht der Hirnforschung
Die rasante kognitive Entwicklung in der frühen Kindheit ist in den letzten Jahren vor allem von Hirnforschern betont worden: Die sei die Zeit im Leben eines Menschen, in der am meisten gelernt würde. Hier müsse Bildung ansetzen, wäre eine intensive Förderung aller Kinder am erfolgversprechendsten, könnten Defizite am leichtesten kompensiert werden.
Beim Fötus entwickelt sich im Gehirn zunächst eine Unmenge von Neuronen, von denen ein Großteil noch vor der Geburt wieder abgebaut wird. So startet ein Neugeborenes mit 100 Milliarden Neuronen (gleiche Anzahl wie bei Erwachsenen), die aber noch klein und wenig vernetzt sind. Dementsprechend beträgt das Gewicht seines Gehirns nur ein Viertel von dem eines Erwachsenen. In der Regel ist bei der Geburt die rechte Hemisphäre etwas weiter entwickelt als die linke.
In den ersten drei Lebensjahren nimmt die Zahl der Synapsen rasant zu – eine Gehirnzelle kann bis zu 10.000 ausbilden. Mit zwei Jahren entspricht die Menge der Synapsen derjenigen von Erwachsenen, mit drei Jahren hat ein Kind bereits doppelt so viel. Die Anzahl (200 Billionen) bleibt dann bis zum Ende des ersten Lebensjahrzehnts relativ konstant. Bis zum Jugendalter wird rund die Hälfte der Synapsen wieder abgebaut, bis die für Erwachsene typische Anzahl von 100 Billionen erreicht wird. Verbunden mit diesem rasanten Wachstum von Synapsen ist eine rasche Gewichtszunahme des Gehirns: von 250 g bei der Geburt über 750 g am Ende des 1. Lebensjahrs bis 1.300 g im 5. Lebensjahr. In der Pubertät wird schließlich das Endgewicht erreicht. Die doppelt so hohe Zahl von Synapsen erklärt auch, wieso das Gehirn eines Dreijährigen mehr als zweimal so aktiv ist wie das eines Erwachsenen und dementsprechend mehr Energie benötigt.
Die Ausbildung von doppelt so viel Synapsen wie letztlich benötigt werden ist ein Zeichen für die große Plastizität des Gehirns – und die enorme Lern- und Anpassungsfähigkeit des Säuglings bzw. Kleinkinds. Das Neugeborene fängt geistig praktisch bei Null an: Abgesehen von ein paar Instinkten ist es weitgehend auf Wahrnehmung und Reaktion beschränkt. Die Regionen des Gehirns, die später für komplexe Funktionen wie Sprechen oder Denken zuständig sind, liegen weitgehend brach. Die Überproduktion von Synapsen in den ersten wenigen Lebensjahren ermöglicht das schnelle Erlernen der Verhaltensweisen, Fertigkeiten, Kenntnisse usw., die für das Leben in unserer Gesellschaft benötigt werden. Ein großer Teil der weiteren Gehirnentwicklung bei Kindern besteht dann darin, die für ihre jeweilige Lebenswelt nicht relevanten Synapsen abzubauen und die benötigten Bahnen zwischen Neuronen zu intensivieren. So bestimmt letztlich die Umwelt – das in ihr Erfahrene, Gelernte, Erlebte, Aufgenommene – zu einem großen Teil die Struktur des Gehirns.
Die Überproduktion und Selektion von Synapsen erfolgen in verschiedenen Regionen des Gehirns mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität; sie erreichen ihren Höhepunkt zu jeweils anderen Zeiten. In diesem Zusammenhang wird oft von "Entwicklungsfenstern" oder "kritischen Phasen" gesprochen, in denen das Gehirn für bestimmte Lernerfahrungen besonders empfänglich sei, da dann die relevanten Synapsen ausgewählt und miteinander verknüpft, also die entsprechenden Regionen des Gehirns strukturiert würden. Werden diese Perioden verpasst, könnte ein Kind im jeweiligen Bereich kaum noch dieselbe Leistungsfähigkeit erreichen wie andere Personen. Beispielsweise dauert die "sensible Phase" für den Spracherwerb bis zum 6. oder 7. Lebensjahr. Das Baby kann schon alle Laute jeder Sprache dieser Welt unterscheiden, das Kleinkind alle Phoneme korrekt nachsprechen. Innerhalb weniger Lebensjahre werden jedoch die Synapsen eliminiert, die diese Leistung ermöglichen, aber nicht benötigt werden, da sich das Kind in der Regel ja nur eine Sprache mit einer sehr begrenzten Zahl von Phonemen aneignet. Deshalb kann ab dem Schulalter, insbesondere ab der Pubertät, eine neue Sprache nicht mehr perfekt erlernt werden. Dieses Beispiel verdeutlicht aber auch, dass das Konzept der "kritischen Phasen" nicht überbetont werden darf. Sonst wird die Lernfähigkeit des Menschen außerhalb der sensiblen Periode unterschätzt – das Schulkind oder der Erwachsene kann eben doch eine zweite, dritte oder vierte Sprache lernen, wenn auch zumeist nur mit einem (leichten) Akzent. Allerdings fällt das Erlernen bestimmter Kompetenzen während der jeweiligen kritischen Phase leichter.
Wichtige Stufen der weiteren Gehirnentwicklung sind beispielsweise:
- Erst im Alter von drei, vier Jahren kann auf das Gedächtnis zurückgegriffen werden. Erfahrungen und Erlebnisse aus den ersten Lebensjahren können noch nicht so in das Langzeitgedächtnis abgespeichert werden, dass sie auch wieder aufgerufen werden können. So gibt es keine Erinnerungen an die ersten drei, vier Lebensjahre – man spricht hier von "infantiler Amnesie" – und nur wenige an das 5. und 6. Lebensjahr.
- Etwa ab vier Jahren verbessert sich allmählich die Kommunikation zwischen linker und rechter Hemisphäre. Dies ermöglicht die Integration der analytischen und der intuitiven Seite des Kindes. Er wirkt klüger, kann nun zwischen Schein und Wirklichkeit unterscheiden, erkennt die Andersartigkeit der Gedanken und Beweggründe anderer Menschen und kann sich in Rollen hineinversetzen.
- Mit sechs Jahren beginnt eine neue Phase intellektueller Reife: Da sich das Kind zunehmend selbst beherrschen, die eigenen Gefühle kontrollieren und die Bedürfnisbefriedigung herausschieben kann, kann es sich besser konzentrieren und zielgerichtet lernen. Die zunehmende Reife der Stirnlappen erleichtert logisches Denken, Urteilsfähigkeit, Rechnen und "vernünftiges" Verhalten.
- Bei 6- bis 12-jährigen Kindern vermehrt sich die graue Gehirnsubstanz auch stark in den hinteren Hirnregionen: Die sprachlichen Fähigkeiten und das räumliche Vorstellungsvermögen werden besser.
Ab dem 10. Lebensjahr gewinnt dann das Prinzip des "Use it or loose it" (Benutze es oder verliere es) eine überragende Bedeutung: Das Gehirn wird optimiert, d.h. diejenigen Synapsen, die häufig gebraucht werden, bleiben erhalten; die anderen werden eliminiert. Die Struktur des Gehirns spiegelt zunehmend die vorherrschenden Aktivitäten und Beschäftigungen der jeweiligen Person wider.
Während in den ersten zehn Lebensjahren das Lernen leicht und sehr schnell vonstatten geht – insbesondere wenn es in die jeweiligen sensiblen Phasen fällt -, verlangt es in den folgenden Jahren immer mehr Anstrengung. Es gibt immer weniger überzählige, unbenutzte Synapsen; die Bahnen, in denen der Jugendliche oder Erwachsene denkt, sind in der Kindheit bereits grob festgelegt worden. Gänzlich neue Verbindungen zwischen Neuronen werden eher selten hergestellt. Das Gehirn hat eine bestimmte Struktur ausgebildet, von deren Art abhängt, in welchen Bereichen das Lernen leichter oder schwerer fällt. Ist z.B. ein Kind bilingual aufgewachsen, eignet es sich schneller eine dritte oder vierte Sprache an; hat es bereits im Kleinkindalter musiziert, wird es eher im Musikunterricht brillieren. Je vielfältiger und breiter die in der Kindheit ausgeprägte Struktur des Gehirns ist, umso mehr Bereiche gibt es, in denen der Jugendliche oder Erwachsene Fortschritte machen kann.
Erfolgreiches Lernen in späteren Lebensabschnitten setzt ferner voraus, dass man das Lernen gelernt hat. Kinder müssen erfahren haben, wie man Lernen plant und selbst überwacht, wie man sich Wissen aneignet und überprüft, welche Lernstrategien erfolgversprechend sind, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen, wie man das Gelernte durchdenkt und erinnert. Sie müssen wissen, dass Lernen Sich-Anstrengen bedeutet, und sollten somit Lern- und Leistungsmotivation entwickelt haben.
Deutlich wird, dass die Gehirnentwicklung stark durch das Lernen geprägt wird – sie ist ein Prozess, der von Erbe und Umwelt gleichermaßen bestimmt wird. So wird sie durch rund 60% aller menschlichen Gene beeinflusst. Die Umgebung wirkt schon vor der Geburt auf die Gehirnentwicklung ein, insbesondere über den Körper der Mutter: Negative Einflussfaktoren sind beispielsweise Fehlernährung, Rauchen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Stress oder der Umgang mit giftigen Substanzen am Arbeitsplatz während der Schwangerschaft. Nach der Geburt wird die Gehirnentwicklung z.B. durch längere Krankenhausaufenthalte oder Heimunterbringung gehemmt, da dann Säuglinge bzw. Kleinkinder zu wenig Stimulierung erfahren. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Mutter depressiv ist oder die Eltern ihr Kind vernachlässigen. Einen negativen Effekt können ferner frühkindliche Traumata oder Misshandlungen haben. Eine positive Wirkung wird hingegen beispielsweise dem Stillen zugesprochen, da hier das Gehirn besonders gut mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgt wird. So schnitten gestillte Kinder beim IQ-Test mit acht Jahren um durchschnittlich 8 Punkte besser ab – der Vorsprung war umso größer, je länger sie gestillt worden waren (Eliot 2001). Aber auch in der (Klein-) Kindheit ist eine gesunde, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung wichtig.
Von besonderer Bedeutung ist eine sichere Mutter- (Vater-) Kind-Bindung. Die Stimulierung und damit das Lernen sind viel intensiver, wenn die Eltern sich engagiert um den Säugling bzw. das Kleinkind kümmern, warm und empathisch reagieren, es liebkosen und trösten. Zugleich erlebt das Kind weniger Stress, wird es resilienter (widerstandsfähiger) und lernt besser, die eigenen Affekte und Emotionen zu kontrollieren. Sehr positiv wirkt sich aus, wenn Kinder in einer besonders anregungsreichen Umwelt aufwachsen, in der sie außerordentlich viele und mannigfaltige Lernerfahrungen machen. Werden ihre Neugier, ihr Forschungsdrang und ihr Verständnis von der Welt gefördert, können sie viel selbst ausprobieren und mit Gegenständen experimentieren, werden sie mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert, können sie Aufgaben selbständig lösen und ihr Wissen weitergeben (z.B. an jüngere Geschwister: Lernen durch Lehren) bzw. immer wieder einsetzen (Lernen durch Wiederholung) – dann entwickeln sie ein stärker strukturiertes Gehirn mit größeren Neuronen und mehr Synapsen. Je schwieriger und komplexer die Aufgaben sind, die ihnen in ihrer Umwelt gestellt werden, umso mehr Gehirnregionen werden aktiviert, umso mehr Verbindungen zwischen Neuronen werden ausgebildet.
Offensichtlich ist, dass es große Unterschiede zwischen Familien hinsichtlich des Grades der Stimulierung gibt, die Kinder erfahren – und das erklärt teilweise, wieso der Schulerfolg so stark von der familialen Umwelt abhängt (s.u.). Hinzu kommt, dass in Familien auch in unterschiedlichem Maße Eigenschaften wie Lern- und Leistungsmotivation, Ehrgeiz, Selbstdisziplin, Selbstvertrauen, Konzentrationsfähigkeit usw. oder schulisch relevante Interessen gefördert werden – z.B. am Lesen, am Beherrschen von Fremdsprachen, an mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Themen.
Natürlich wirkt sich auch die Qualität der Schule auf die Gehirnentwicklung aus. Es spielt sogar eine Rolle, ob man mit mehr älteren oder mehr jüngeren Kindern in einer Klasse zusammen ist – in ersterem Fall ist die kognitive Stimulierung größer. So schneidet z.B. ein junger Fünftklässler bei IQ-Tests im Durchschnitt um einen oder zwei Punkte schlechter ab als seine älteren Klassenkameraden, aber um rund fünf Punkte besser als gleich alte Viertklässler (Eliot 2001).
Interessant ist auch folgendes Forschungsergebnis: Im Durchschnitt erzielen Erstgeborene bei Intelligenz- und Schulleistungstests bessere Ergebnisse als ihre jüngeren Geschwister – letztere schneiden umso schlechter ab, je weiter unten in der Geschwisterfolge sie sind (ein Viertgeborener also schlechter als ein Drittgeborener) und je kürzer der Geburtenabstand zum älteren Geschwisterteil ist (a.a.O.). Hier wirken zwei bereits beschriebene Einflussfaktoren zusammen: Zum einen erfahren Erstgeborene mehr Aufmerksamkeit und Stimulierung als ihre Geschwister, wird mit ihnen während der ersten Lebensjahre mehr interagiert. Zum anderen profitieren sie vom "Lernen durch Lehren": Ihr Wissen und ihre Fähigkeiten werden gefestigt, wenn sie ihren jüngeren Geschwistern etwas beibringen. Zugleich werden Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt. Dies fördert ihre Entwicklung so stark, dass sie bei Tests sogar besser als Einzelkinder abschneiden, obwohl diese die ungeteilte Zuwendung ihrer Eltern genießen.
Individuelle Unterschiede gibt es schließlich auch zwischen den Geschlechtern. Mädchen greifen bei verbalen Tätigkeiten eher auf beide Gehirnhälften zurück. Sie fangen früher mit dem Sprechen an, sind sprachbegabter und schneiden dementsprechend besser ab bei verbal ausgerichteten Intelligenztests und bei Untersuchungen über das Lesen und Schreiben sowie hinsichtlich des assoziativen Gedächtnisses und der Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Jungen zeigen hingegen bessere Leistungen bei nicht verbalen IQ-Tests, im Rechnen, hinsichtlich des naturwissenschaftlichen und technischen Verständnisses und bei visuell-räumlichen Analysen (z.B. räumliches Rotieren, Erkennen verborgener geometrischer Figuren). Diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind jedoch relativ schwach ausgeprägt. Allerdings variiert bei Jungen die geistige Leistungsfähigkeit stärker: Einerseits erzielen sie häufiger Spitzenleistungen, andererseits sind sie öfters lernbehindert. Ansonsten kann man auch bei diesen Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen davon ausgehen, dass sie zum Teil genetisch bedingt sind und zum Teil durch geschlechtsspezifische Erziehung, Geschlechtsrollenleitbilder, Vorbilder (z.B. Filmstars oder Sportler) und Medien hervorgerufen werden. Außerdem scheint das Spielverhalten von Bedeutung zu sein: Beispielsweise beschäftigen sich Jungen mehr mit Bauklötzen, Fußball-Spielen, Konstruktionsmaterial und Computerspielen, was die visuell-räumliche Koordination und das technische Verständnis fördert. Puppen- und Rollenspiele, die von Mädchen bevorzugt werden, wirken sich hingegen auf die sprachliche und soziale Entwicklung positiv aus.
Die kognitive Entwicklung aus Sicht der Psychologie
Jeder, der sich ein wenig mit Pädagogik und/oder Psychologie befasst hat, weiß, dass die skizzierten Erkenntnisse der Hirnforscher nicht gerade "neu" sind. In der Entwicklungspsychologie liegen sogar viel mehr Forschungsergebnisse über die frühkindliche Entwicklung vor als in der Hirnforschung. Es ist den Psycholog/innen aber nur ansatzweise gelungen, diese in die Öffentlichkeit zu transportieren oder gar für die Bildungspolitik relevant zu machen. Im Folgenden möchte ich nun einige Erkenntnisse über die kognitive Entwicklung von Kleinkindern aus der Entwicklungspsychologie vorstellen.
Ein Kind, das in den Kindergarten kommt, hat bereits eine rasante Entwicklung im kognitiven Bereich hinter sich. Vorsprachlich denkend hat es als Baby seine Umwelt beobachtet und Erfahrungen mit den für es erreichbaren Dingen gesammelt. Gegen Ende des 1. Lebensjahres hat es schon erste Kategorien gebildet und begriffliches Wissen erworben. Dank der so genannten "Wortschatzexplosion" haben sich im 2. Lebensjahr seine sprachlichen Kompetenzen stark verbessert. Zugleich werden Denken und Sprechen zu einer untrennbaren Einheit: Das Kind lernt, Sprache intrapsychisch zum Nachdenken zu verwenden.
Während der Kindergartenzeit setzt sich die rasche Entwicklung im kognitiven Bereich fort. Dies wird durch die zunehmende Sprachbeherrschung und den wachsenden Wortschatz erleichtert – zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr lernt das Kind rund neun neue Wörter pro Tag. Am Ende der Vorschulzeit verfügen Kinder im Schnitt dann über einen aktiven Wortschatz von 2.500 und einen passiven Wortschatz von ca. 13.000 Wörtern. Auch werden die Sätze länger und komplexer.
Kindergartenkinder sind sehr neugierig, erkunden selbsttätig ihre Umwelt und stellen viele Fragen. So nimmt ihr Wissen schnell zu, wobei sich aufgrund individueller Interessen schon Schwerpunkte bilden: Beispielsweise wird ein an Dinosauriern interessiertes Kind bei weitem mehr Informationen über sie sammeln als desinteressierte Kinder – sofern ihm andere (erwachsene) Menschen entsprechendes Wissen zur Verfügung stellen, also mit ihm über Dinosaurier sprechen, ihm (Bilder-) Bücher besorgen oder mit ihm naturkundliche Museen besuchen.
Schon bei Kleinkindern ist das Wissen "domänenspezifisch" organisiert, also nach Gebieten strukturiert, die Erwachsene z.B. als "Physik", "Biologie" oder "Psychologie" bezeichnen würden. Begriffe und Informationen werden nicht "wirr" oder unzusammenhängend in diesen Domänen "abgelegt", sondern in "intuitive Theorien" eingefügt. Von Anfang an ähneln diese den wissenschaftlichen Theorien, wie Sodian (2002) verdeutlicht: "Intuitive wie wissenschaftliche Theorien sind gekennzeichnet durch einen Phänomenbereich, ein System von Kernbegriffen sowie ein System von Erklärungsprinzipien" (S. 449).
Während man früher nach fundamentalen Unterschieden zwischen (Klein-) Kindern und Erwachsenen hinsichtlich des Verständnisses von Begriffen suchte, interessieren sich Entwicklungspsychologen heute mehr für domänenspezifische Begriffssysteme und deren Veränderung im Laufe der Zeit. So wird die kognitive Entwicklung als Prozess des Erwerbs von Expertise über die verschiedenen Domänen hinweg verstanden, wobei der Fortschritt in der jeweiligen Domäne von der Verfügbarkeit entsprechenden Wissens (s.o.), der Gelegenheit zum Üben und natürlich den allgemeinen Informationsverarbeitungsfähigkeiten abhängt.
Neuer Input und neue Erfahrungen führen zu einer Evaluation und eventuell zu einer Revision von (Kern-) Begriffen und Erklärungsprinzipien in der jeweiligen intuitiven Theorie. Zumeist kommt es zu einer graduellen Bereicherung vorhandenen Wissens, manchmal aber auch zu radikalen Restrukturierungen (z.B. wenn im Grundschulalter eine rein biologische aus der frühkindlichen biologisch-psychologischen Domäne ausgegrenzt wird). So können die Kinder auf immer mehr Vorwissen zurückgreifen. Die intuitiven Theorien werden dementsprechend mit zunehmendem Alter komplexer und entsprechen dann immer mehr der Realität – bzw. wissenschaftlichen Theorien.
Parallel zur Ausbildung von Domänen entwickelt sich das Langzeitgedächtnis. Generell behalten Kindergartenkinder Informationen besser, wenn z.B. mehrfach über das jeweilige Thema gesprochen wurde, wenn Phänomene nach einem ähnlichen Schema ablaufen oder wenn Ereignisse persönlich relevant bzw. emotional bedeutsam sind. Allerdings wissen sie erst wenig über das Gedächtnis und können Gedächtnisprozesse nur sehr begrenzt überwachen und regulieren. Auch lassen sie sich hinsichtlich ihrer Gedächtnisleistung noch durch Suggestivfragen verwirren und zeigen wenig intentionales Memorierverhalten (z.B. wiederholen sie noch nicht etwas absichtlich, um es besser zu behalten, und machen noch keine konzentrierten Erinnerungsversuche).
Im 3. Lebensjahr nimmt der auf Gefühle bezogene Wortschatz stark zu. Je mehr in Familie und Kindergarten über Bedürfnisse und Emotionen gesprochen wird, umso größer wird das Verständnis des Kindes. Es kann nun im Rollenspiel Gefühle vortäuschen oder z.B. einer Puppe zusprechen. Aber erst mit 6 Jahren kann es zwischen realer und scheinbarer Emotion unterscheiden, weiß also, dass sich Menschen verstellen können, dass der Gesichtsausdruck einer Person nicht immer ihre wahren Gefühle widerspiegelt.
Ferner werden die Problemlösefertigkeiten des Kindes immer besser. Es kann nun über nicht vorhandene bzw. hypothetische Situationen nachdenken, also z.B. mögliche Folgen eines denkbaren Problemlöseversuchs oder einer Verhaltensweise antizipieren. Das heißt, es kann planen, bevor es handelt. Auch kann es seine Handlungsziele mit den -ergebnissen in Beziehung setzen, also aus Erfahrung lernen. Das Kind entwickelt verschiedene Problemlösestrategien und kann zwischen ihnen wechseln, falls sich eine in der jeweiligen Situation nicht bewährt. Es hat aber noch Schwierigkeiten, Strategien zu optimieren. Auch kann es erst ansatzweise schlussfolgernd denken (z.B. "Etwas, was so ähnlich aussieht wie etwas Bekanntes, wird sich auch so ähnlich verhalten").
Das Kind beschäftigt sich nun gedanklich weniger mit der dinglichen Welt und mehr mit den anderen Menschen. Dabei wird es sich mehr und mehr nicht beobachtbarer Prozesse bewusst: Es entdeckt die eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie die anderer Menschen und beginnt, über sie zu sprechen. Das Kind erkennt, dass Bedürfnisse zu Handlungen führen, dass sich solche intentionalen Handlungen von zufälligen unterscheiden, und dass Aktionen Emotionen hervorrufen können. Zugleich wird die Selbstkontrolle besser, da es zwischen Bedürfnis und Intention bzw. Handlung unterscheiden und somit die Bedürfnisbefriedigung aufschieben kann. Das Kind beginnt, seinen eigenen Willen wahrzunehmen und darüber zu sprechen. Zunehmend zieht es aus der Mimik und Gestik anderer Menschen Rückschlüsse auf deren Gefühle und berücksichtigt diese bei seinen Reaktionen (z.B. im Spiel). So entwickelt es ein Bewusstsein für die eigenen mentalen Zustände und die anderer Personen.
Im Alter von 4 bis 5 Jahren erreichen Kinder ein relativ vollständiges Verständnis mentaler Repräsentationen und Prozesse – sie entwickeln eine Theorie über das Denken. Das heißt, sie erkennen, dass sich beim Denken etwas im Kopf "abspielt", also dass z.B. Informationen abgespeichert und Situationen interpretiert werden. Sie interessieren sich für den Ursprung von Wissen ("Woher weißt du das?") und können erklären, wie sie Wissen erworben haben (z.B. durch Betasten oder Beobachten). Ferner erkennen die Kinder, dass Gedanken, Träume und Erinnerungen nicht wirklich, sondern mentale Gebilde sind. Sie können im Gegensatz zu Dreijährigen nun eindeutig zwischen Realität und Fantasie unterscheiden (z.B. haben sie im Als-ob-Spiel nicht mehr Angst vor "Monstern").
Vier- bis fünfjährige Kinder erkennen auch, dass man über die verschiedenen Sinne zu unterschiedlichen Informationen gelangt und dass ein Wechsel des Blickwinkels oft andere Seiten eines Gegenstands enthüllt. So wird ihnen bewusst, dass Menschen oft dieselbe Angelegenheit andersartig sehen, dass also "beim Denken Situationen interpretiert werden und dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Interpretationen hervorbringen können" (Astington 2000, S. 119). Die Kinder entwickeln Empathie, da sie sich nun in andere Menschen hineinversetzen und von deren Standpunkt aus über etwas nachdenken oder deren Empfindungen nachvollziehen können. Der Egozentrismus wird langsam geringer; altruistisches Handeln wird möglich (z.B. Trösten eines traurigen Spielkameraden). Zugleich witrd den Kindern bewusst, dass Menschen auch aus Einstellungen und Haltungen heraus handeln. Sie können ihre Überzeugungen denen anderer Menschen entgegensetzen und verstehen fehlerhafte Überzeugungen bei sich selbst und bei anderen Menschen. Wissen sie, dass eine Person eine fehlerhafte Überzeugung hat, können sie im Gegensatz zu Dreijährigen voraussagen, dass diese Person falsch handeln wird. Auch können sie nun durch Lügen absichtlich fehlerhafte Überzeugungen bei anderen Menschen hervorrufen, um auf diese Weise bestimmte Ziele (z.B. Vermeidung von Strafe) zu erreichen.
Das Kind erwirbt seine Alltagspsychologie – und auch sein "Weltwissen" – weitgehend in der Kommunikation mit anderen: Es äußert seine Beobachtungen und Vermutungen, sodass diese diskutiert werden können. Es stellt Fragen, sodass es zusätzliche Informationen erhält. Es antwortet auf Fragen, sodass der Grad des erreichten Verständnisses deutlich wird. Aufgrund dieser großen Bedeutung der Gesprächspartner wird heute davon gesprochen, dass kindliches Wissen "ko-konstruiert" wurde.
Die Bedeutung von Familie, Kindergarten und Schule für die kindliche Entwicklung
In der frühen Kindheit sind die Eltern die für das Kind wichtigsten "Ko-Konstrukteure". Unter Wissenschaftler/innen ist seit Jahrzehnten bekannt, dass die Familie die bedeutsamste Bildungsinstitution ist – nicht die Schule. Bereits 1966 erschien in den USA das Aufsehen erregende Buch "Equality of Educational Opportunity" von Coleman et al. und 1967 in Großbritannien der gleich bedeutende Sammelband "Children and Their Primary Schools" von Plowden. In beiden Büchern wurde anhand von Untersuchungen nachgewiesen, dass der Anteil der Schule am Schulerfolg von Kindern nur etwa halb so groß wie der Anteil der Familie ist.
In den folgenden Jahrzehnten boomte die empirische Forschung auf diesem Gebiet. Hunderte von Studien wurden veröffentlicht, in denen ganz unterschiedliche Merkmale von Familien und Schulen in Bezug zur Schulleistung von Kindern erforscht wurden. In Dutzenden von Überblicksartikeln, so genannten Metaanalysen, wurden auf Grundlage dieser Untersuchungen die Effektstärken einzelner Merkmale berechnet. Diese wurden 1987 von Fraser et al. zusammengefasst, wobei sich laut Krumm (o.J.) zeigte, dass die Effektstärke der Lernbedingungen in der Familie größer war in 15 von 16 Metaanalysen zur Effektstärke von Schulmerkmalen, in 8 von 9 Metaanalysen zur Effektstärke von Lehrermerkmalen, in 23 von 30 Metaanalysen zur Effektstärke von Unterrichtsmerkmalen und in allen 37 Metaanalysen zur Effektstärke von Methodenmerkmalen.
Interessanterweise war die Effektstärke von Familienmerkmalen in 20 von 25 Metaanalysen auch größer als diejenige von Kindmerkmalen. Das heißt, dass z.B. die Bedeutung der genetischen Ausstattung nicht überschätzt werden sollte. So ist der Schulerfolg nur zu 20% genetisch bedingt (Eliot 2001).
Somit ist festzuhalten, dass der Einfluss der Familie auf den Schulerfolg größer ist als der Einfluss der Schule oder als der Einfluss von Kindmerkmalen. In ihren Familien erwerben Kinder die meisten psychomotorischen, sozialen, affektiven und sprachlichen Kompetenzen. Für den Schulerfolg ist besonders relevant, welcher Sprachstil in der Familie erlernt wird, inwieweit Literacy gefördert wird, wie groß die kognitive Anregung ist, welche Einstellungen zur Schule und generell zum Lernen vermittelt werden, wie hoch das Anspruchsniveau, die Leistungsmotivation, die Selbstkontrolle und die Frustrationstoleranz sind.
Da viele solcher Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale und Haltungen in den Jahren vor der Einschulung erworben werden, kommen Kinder – selbst bei gleicher Intelligenzausstattung und Begabung – mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Grundschule. Bedenkt man den großen Einfluss der Familie auf den Schulerfolg, so ist es letztlich nicht verwunderlich, dass es der Schule im Verlauf vieler Jahre nicht gelingt, diese Unterschiede weitgehend zu verringern. Das Gegenteil ist sogar der Fall: Mit der Zahl der Schuljahre wird die "Leistungsschere" zwischen den Schüler/innen immer größer. Kinder aus "bildungsmächtigen" Familien brillieren am Gymnasium; Kinder aus "bildungsschwachen" Familien versagen an der Hauptschule oder kommen in Förderschulen.
Ferner wirkt sich der sozioökonomische Status von Familien auf die Schulleistungen von Kindern aus – wobei es hier natürlich Überschneidungen gibt. Dieses Faktum ist ebenfalls seit Jahrzehnten bekannt. Es wurde in den letzten Jahren durch die PISA-Studien wieder einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht. Diese hatten ergeben, dass in keinem anderen Industrieland die soziale Herkunft so entscheidend für den Schulerfolg ist wie in Deutschland. Das deutsche Schulsystem schafft es nicht, herkunftsbedingte Nachteile auszugleichen: Kinder aus Akademikerfamilien haben eine viermal größere Abiturchance als Kinder aus Facharbeiterfamilien. Selbst Unterschichtkinder mit besten Leistungen bleiben in der Hauptschule. Ausländerkinder haben in Deutschland schlechtere Bildungschancen als in anderen Industrienationen mit einem ähnlichen Ausländeranteil.
Die gerade genannten Ergebnisse der PISA-Studien verdeutlichen aber auch, dass es in anderen Ländern dem Bildungssystem besser gelingt, die "Defizite" von Kindern aus "bildungsschwachen", ausländischen oder Unterschichtfamilien auszugleichen. Dies zeigt, dass Kindertageseinrichtungen und Schulen in Österreich und Deutschland durchaus einen größeren Einfluss auf die kindliche Entwicklung nehmen könnten – falls es gelänge, die Qualität der hier geleisteten Bildung und Erziehung zu verbessern...
So haben z.B. in Deutschland die Bundesländer nach dem "PISA-Schock" verschiedene – und zum Teil unterschiedliche – Reformen in ihren Bildungssystemen eingeführt: von Bildungsplänen für Kindergärten, Sprachstandstests einige Zeit vor der Einschulung und Sprachkursen für ausländische Kinder über die Neugestaltung der Schuleingangsstufe bis hin zu Ganztagsschulen, Angeboten für Hochbegabte, bundesweiten Bildungsstandards, zentralen Abschlussprüfungen, Schulvergleichen und Maßnahmen zur Erweiterung der Schulautonomie. Allerdings wird bemängelt, dass beispielsweise manche dieser Reformen nur halbherzig durchgeführt werden, dass die finanzielle Ausstattung des Bildungsbereichs kaum verbessert wurde, dass im Vergleich zu anderen OECD-Staaten zu wenig Geld in den vorschulischen Bereich und in die Grundschule investiert wird.
Es muss also noch viel unternommen werden, um die "Bildungsmacht" von Kindertageseinrichtungen und Schulen zu stärken. Und dies wird immer dringender: Da Mütter nach der Geburt eines Kindes häufiger und schneller als früher wieder erwerbstätig werden und immer länger arbeiten, schrumpft die Zeit, in der sie die kindliche Entwicklung beeinflussen können. Beispielweise ergaben amerikanische Untersuchungen, dass Eltern 1996 durchschnittlich 22 Stunden pro Woche weniger Zeit für ihre Kinder hatten als 1969 (Hochschild 2002). Ähnliches dürfte auch für Österreich und Deutschland gelten, wobei Wirtschaft und Politik die Müttererwerbstätigkeit in den nächsten Jahren noch ausweiten wollen, indem mehr Betreuungsplätze für Unterdreijährige geschaffen werden und mehr Kindertageseinrichtungen Öffnungszeiten von über acht Stunden anbieten sollen. Anzumerken ist, dass Väter traditionell sehr wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen und auch dieser Zeitaufwand aufgrund der Verlängerung der Arbeitszeit, der hohen Zahl von Überstunden und der langen Fahrzeiten zurückgehen dürfte – trotz des größeren Engagements der wenigen "neuen Väter".
Die "Bildungsmacht" vieler Familien wird aber auch durch Verunsicherung der Eltern in pädagogischen Fragen, Erziehungsunfähigkeit, Überbehütung, häufig auftretende Ehekonflikte, Scheidung der Eltern und ähnliche Faktoren sowie durch Charakteristika heutiger Kindheit wie Verhäuslichung, Verinselung, Verplantheit, Reizüberflutung und Konsumorientierung beeinträchtigt. Außerdem werden Gleichaltrigengruppe und Medien mit zunehmendem Alter der Kinder zu immer wichtigeren Sozialisationsfaktoren – mit manchmal negativen Konsequenzen für Erziehung und Bildung. Vielen Eltern gelingt es auch nicht, nach den Krisen der Pubertät und der frühzeitigen Ablösung wieder eine funktionierende Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. So war für mich das erschreckendste Ergebnis der ersten PISA-Studie, dass nur etwas mehr als 40% der deutschen Schüler/innen angaben, dass ihre Eltern regelmäßig mit ihnen über ihre schulischen Leistungen reden – der OECD-Durchschnitt lag bei 51,2%, der Wert für italienische Eltern sogar bei gut 60%! Ferner berichteten von den deutschen 15-Jährigen nur 41%, dass ihre Eltern regelmäßig mit ihnen persönliche Gespräche führen, und gerade einmal 16%, dass sie mit ihnen mehrmals pro Woche über Bücher, Filme oder Fernsehen reden. Dies zeigt, wie gering die Bildungsmacht der Familie geworden ist, wenn die Kinder das Jugendalter erreicht haben.
Kindertageseinrichtungen und Schulen sind also viel stärker als früher gefordert, den abnehmenden und vereinzelt weitgehend ausgefallenen Einfluss von Eltern hinsichtlich der Sozialisation und Enkulturation ihrer Kinder zu kompensieren. Hinzu kommt, dass die zurückgehende Geburtenrate und die daraus resultierenden und immer größer werdenden negativen Konsequenzen für Sozialstaat und Wirtschaft sowie der durch die Globalisierung verstärkte Wettbewerb den Druck auf das Bildungssystem erhöhen wird, jedes Kind bestmöglich zu fördern und beruflich zu qualifizieren. Das bedeutet, dass die Qualität von Kindertageseinrichtungen und Schulen in den nächsten Jahren stark verbessert werden müsste, wobei erstere vor allem die Bildungsfunktion und letztere die Erziehungsfunktion intensivieren müssten. Lehrer/innen – insbesondere an Sekundarschulen – müssten mehr Verantwortung für die Leistungen, das Verhalten und die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/innen übernehmen – ich erinnere in diesem Zusammenhang an ein weiteres Ergebnis der ersten PISA-Studie, nämlich dass deutsche Jugendliche weitaus häufiger als Schüler/innen aus anderen OECD-Staaten der Meinung waren, dass ihre Lehrer/innen sie zu wenig beim Lernen unterstützen, kaum auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen, zu oft fehlen und generell nicht am Lernerfolg aller Schüler/innen in der Klasse interessiert sein würden.
All dies verlangt nicht nur einige Reformen wie die zuvor genannten, sondern vor allem eine bessere Aus- und Fortbildung der Pädagog/innen, kleinere Gruppen bzw. Klassen, Qualitätsmanagement, Supervision, genügend Vorbereitungs- und Verfügungszeit etc. Auch müssen die Übergänge von der Familie in die Kindertageseinrichtung, von dort in die Primarschule und von dieser in die Sekundarschulen verbessert werden. Vor allem aber müssen Eltern, Kindergärtner/innen und Lehrer/innen erkennen, dass – wie bereits erwähnt – Bildung bzw. Erziehung eine Ko-Konstruktion von ihnen und dem jeweiligen Kind ist und dass sie deshalb intensiv zusammenarbeiten sollten. Sie sind sozusagen "natürliche" Partner.
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Zur Bezeichnung der wünschenswerten Beziehung zwischen Eltern und Kindergärtner/innen bzw. Lehrer/innen werden immer häufiger die Begriffe "Erziehungspartnerschaft" und "Bildungspartnerschaft" verwendet. Durch den erstgenannten Begriff wird die gemeinsame Verantwortung für die Erziehung der Kinder betont. Eltern und Pädagog/innen verfolgen ähnliche Erziehungsziele und kooperieren bei deren Umsetzung. Als "Partner" sind sie gleichwertig und gleichberechtigt.
Erziehungspartnerschaft realisiert sich in einem dynamischen Kommunikationsprozess, in der wechselseitigen Öffnung von Familie und Kindertagesstätte bzw. Schule. Dies setzt gegenseitiges Vertrauen und Respekt voraus – Haltungen, die sich auch auf das Kind positiv auswirken: Sieht es, dass die Kindergärtner/innen bzw. die Lehrer/innen seine Familie wertschätzen, wird es eher Selbstachtung entwickeln. Merkt es, dass seine Eltern die Pädagog/innen respektieren, fördert dies den pädagogischen Bezug und die Lernmotivation.
Öffnung auf Seiten der Familie bedeutet, dass die Eltern über das Verhalten des Kindes in der Familie, besondere Erlebnisse, ihre Erziehungsziele und -methoden sprechen. Becker-Textor (1992) schreibt hierzu: "Wenn die Mitarbeiter des Kindergartens die Familien kennen, so hat dies sehr positive Wirkungen in den Alltag der Einrichtung hinein. Es gelingt ihnen besser, die Welt der Familie und die Welt des Kindergartens zu verbinden oder gar zu einem Ganzen zu vereinen. Die Bewältigung des Alltags wird leichter" (S. 53).
Auf Seiten der Kindertagesstätte bzw. Schule geht es bei der Öffnung darum, den Alltag in der Institution für Familien durchschaubar zu machen. Die Eltern möchten wissen, wie normalerweise ein Tag abläuft, welche Erziehungsziele, -vorstellungen und -praktiken die Pädagog/innen haben, wie sie sich in schwierigen Situationen verhalten – z.B. gegenüber einem trotzenden oder aggressiven Kind. Auch wollen sie von dem entwicklungspsychologischen und pädagogischen Fachwissen und den Erfahrungen der Pädagog/innen profitieren. Vor allem aber wünschen sie Informationen darüber, wie sich ihr Kind in der Gruppe bzw. Klasse verhält, wie es sich entwickelt, welchen Lernfortschritt es macht und ob es Schwierigkeiten hat.
Erziehungspartnerschaft bedeutet aber nicht nur den Austausch von Informationen über Verhalten, Entwicklung und Erziehung des Kindes im jeweiligen System, sondern geht einen entscheidenden Schritt weiter: Familie und Kindertageseinrichtung bzw. Schule versuchen, ihre Erziehungsziele, -methoden und -bemühungen aufeinander abzustimmen, den Erziehungsprozess gemeinsam zu gestalten, sich wechselseitig zu ergänzen und zu unterstützen. Sie kooperieren miteinander, wenn es gilt, Probleme mit dem jeweiligen Kind zu bewältigen oder ihm zu helfen, bestimmte Schwierigkeiten zu meistern. Durch Erziehungspartnerschaft kann Kontinuität zwischen den Lebensbereichen gewährleistet werden. Das Kind wird nicht nur in seiner "Ganzheit" gesehen (also wie es sich in allen Systemen verhält), sondern es kommt auch ein ganzheitliches Erziehungsprogramm zustande.
Je älter das Kind ist, umso mehr kann es in diesen Austausch einbezogen werden. In vielen Ländern besteht inzwischen die Möglichkeit, die Kooperation zwischen Familie und Kindertageseinrichtung bzw. Schule in einem Bildungs- und Erziehungsvertrag zu formalisieren. Ältere Schüler/innen werden vielerorts eingebunden; sie unterschreiben dann ebenfalls den Vertrag.
Bei einer Erziehungspartnerschaft sind die Pädagog/innen selbstverständlich bereit, Eltern bei Erziehungsfragen und -problemen zu helfen. Sie machen auch elternbildende Angebote, durch die sie einen Beitrag zur Verbesserung der Familienerziehung leisten wollen. Bei größeren Erziehungsschwierigkeiten und anderen Familienproblemen vermitteln sie die Hilfsangebote von Beratungsstellen, psychosozialen Diensten, Schulpsycholog/innen und Behörden.
In Österreich wird großer Wert auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule gelegt. Dazu gehört vor allem der wechselseitige Informationsaustausch über Fragen der Erziehung, des Leistungsstandes und des für das jeweilige Kind geeigneten Bildungsweges. So sind alle Lehrer/innen verpflichtet, für Einzelaussprachen mit den Erziehungsberechtigten zur Verfügung zu stehen. Ferner gibt es Elternsprechtage und Klassenelternberatungen. Die Lehrer/innen sind auch im Rahmen eines "Frühwarnsystems" verpflichtet, von sich aus den Kontakt mit Eltern zu suchen, wenn z.B. die Leistungen von einzelnen Schüler/innen allgemein oder in einzelnen Unterrichtsgegenständen in besonderer Weise nachlassen, insbesondere wenn sie in einem Pflichtgegenstand im 2. Semester mit "nicht genügend" zu beurteilen wären. Dasselbe gilt, wenn ihr Verhalten auffällig ist oder wenn sie dem Unterricht unentschuldigt fernbleiben. In diesen Fällen sollen im Rahmen eines Beratungsgesprächs mögliche Fördermaßnahmen erarbeitet werden.
Laut dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (2002) soll der Anlass für Elterngespräche aber nicht nur die Leistung von Schüler/innen sein, sondern auch:
- "Änderungen in der Familiensituation, die sich auf die Schulleistungen auswirken können, wie Trennung der Eltern, Verlust eines nahen Angehörigen, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit der Mutter usw.
- Psychische Belastungen durch Spannungen und Konflikte, z.B. besondere Geschwisterrivalität, schwere Enttäuschungen, Liebeskummer usw.
- Probleme innerhalb der Klasse, mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, z.B. Außenseiterstatus, Unbeliebtheit, Angst vor der Lehrperson.
- Entwicklungsbedingte Schwierigkeiten im Verhalten (Aufsässigkeit, Reizbarkeit, Verschlossenheit, Pubertätserscheinungen usw.)" (S. 7).
In Österreich haben Eltern viele Pflichten übertragen bekommen: So müssen sie z.B. aktiv Kontakt zur Schule halten, die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrer/innen unterstützen, ihre Kinder mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln ausstatten, auf die gewissenhafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch ergebenden Pflichten hinwirken und zur Förderung der Schulgemeinschaft beitragen.
Großer Wert wird in Österreich auf eine aktive Schulpartnerschaft gelegt, bei der Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen "ihre" Schule gestalten. Hierzu werden in den Volks-, Haupt- und Sonderschulen für jede Klasse ein Klassenforum und für jede Schule ein Schulforum eingerichtet sowie in den Polytechnischen Schulen, den Berufsschulen und den mittleren bzw. höheren Schulen ein Schulgemeinschaftsausschuss (SGA). In diesen Gremien können wichtige Fragen des Unterrichtes und der Erziehung beraten, Unterrichtsmittel ausgewählt, Schulveranstaltungen geplant und schulautonome Lehrpläne und die Hausordnung beschlossen werden. An Schulen kann auch eine "Zukunftswerkstatt" gegründet werden, in der interessierte Schulpartner offen über schulpädagogische Innovationen und Ideen ohne sofortigen Handlungsdruck diskutieren können.
Mit Bildungspartnerschaft ist gemeint, dass Eltern und Pädagog/innen auch bei der Bildung von Kindern kooperieren. Das impliziert meines Erachtens die Mitarbeit von Eltern in der Kindertageseinrichtung bzw. Schule. Auf die Bildungspartnerschaft werde ich am Ende meines Vortrags gesondert eingehen. Zunächst möchte ich aber beschreiben, wie Eltern und Pädagog/innen unabhängig voneinander die Entwicklungsbedingungen von Kindern verbessern können.
Qualitativ gute Bildung und Erziehung in der Familie
Prinzipiell können sich Kinder in allen Familienformen und bei den unterschiedlichsten Beziehungsdefinitionen, Regeln, Werten, Erziehungsstilen usw. positiv entwickeln. Entscheidend sind hier einige allgemeine Faktoren, die am Beispiel der "Normalfamilie" skizziert werden sollen. Die Ehepartner als "Architekten der Familie" (Satir) sollten z.B. psychisch gesund sein, in einer glücklichen und befriedigenden Ehebeziehung leben, über gute Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten verfügen, ihre Ehebeziehung gegenüber den Kindern abgrenzen und für klare hierarchische Strukturen sorgen. Dies hat für die Kinder folgende positive Konsequenzen:
- Psychisch gesunde Eltern sind gute Vorbilder: Die Kinder lernen von ihnen rationales Denken, den richtigen Umgang mit Gefühlen, Problemen und Konflikten sowie ein positives kommunikatives Verhalten.
- Ist die Ehe gut, finden Kinder Sicherheit und Geborgenheit in ihrer Familie. Sie können das für das aktive Erforschen ihrer Umwelt notwendige Grundvertrauen entwickeln.
- Eine gute, dialoghafte Ehe dient Kindern als Modell für die Gestaltung eigener Beziehungen. Sie erkennen den Zusammenhang zwischen Beziehungsarbeit und Selbsterziehung.
- Akzeptieren Eltern die Individualität und Einzigartigkeit ihres Partners, so werden sie dieselbe Haltung gegenüber ihren Kindern einnehmen. Diese können sich somit frei entfalten und sich selbst verwirklichen.
- Sind die Eltern psychisch gesund und mit ihrer Ehebeziehung zufrieden, benötigen sie nicht ihre Kinder als Ersatzpartner oder zur Befriedigung von Bedürfnissen. Die Kinder werden nicht vereinnahmt, ihre Ablösung wird nicht behindert.
- Bei klaren Regeln und eindeutigen Autoritätsstrukturen können sich Kinder gut orientieren. Sie können sich auf ihre Eltern verlassen.
Deutlich wird, wie groß die erzieherische Wirkung des Vorbilds der Eltern und ihrer Beziehung ist, dass der Qualität des Zusammenlebens eine große Bedeutung zukommt. Dies ist wichtiger, als dass die Eltern die neuesten erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Theorien studieren und dann an deren Zielen ausgerichtete Techniken einsetzen. Davor warnte der renommierte Erziehungswissenschaftler von Hentig schon 1976: "Kindheit heute ist pädagogische Kindheit: immer mehr Erwachsene filtern ihre Taten und Äußerungen gegenüber den Kindern durch das, was sie als 'die richtige Erkenntnis von der Pädagogik' zu haben meinen; sie agieren und reagieren nicht spontan, nicht aufgrund dessen, wovon sie selber überzeugt sind, was sie selber erfahren haben und was sie darum 'empathisch' – einfühlsam – beurteilen können, nicht als die Person, die sie sind, auf die Person hin, die das Kind ist" (S. 38, 39).
Von großer Bedeutung ist somit auch die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Wichtige Faktoren sind hier Dialoghaftigkeit und Verständnis, Verlässlichkeit und Kontinuität, Vertrauen und Sicherheit, Anerkennung und Selbstbestätigung, Autonomie und Solidarität. Beide Elternteile müssen sich genügend Zeit für ihre Kinder nehmen, dürfen sie nicht vernachlässigen, aber auch nicht verwöhnen und überbehüten. Sie sollten ihnen einen sich allmählich erweiternden Handlungsraum und damit immer mehr Verantwortung zugestehen, ihnen viele Erfahrungsmöglichkeiten und Lernanreize bieten, sie zu aktivem Lernen, zu Selbsttätigkeit und Experimentierfreude führen und ihr Selbstvertrauen stärken. Schließlich sollten sie die Ablösung ihrer Kinder akzeptieren und fördern.
Erziehung bedeutet größtenteils "Auslese der wirkenden Welt" durch die Eltern. Sie bilden ihre Kinder durch ihre Gespräche über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur etc., durch ihre Antworten auf die Fragen des Kindes, die gemeinsam durchgeführten Aktivitäten und die von ihnen ausgesuchten Medien. Persönlichkeitsbildend wirken gelebte Werte, Regeln, Traditionen, Normen und Ideale sowie die Weltanschauung und die Religion, die das Familienleben prägen. Kinder "warten nicht darauf, erzogen zu werden, sondern sie lernen von selbst aus allem, was sie in ihrem Lebensraum wahrnehmen – sei es gut oder schlecht, wertvoll oder minderwertig" (Brezinka 1989, S. 48). Auch außerhalb der Familie können Eltern zumindest ansatzweise den Lebensraum ihrer Kinder prägen – durch die Auswahl von Freunden und Bekannten, von Bildungs- und Freizeitangeboten, von kulturellen und religiösen Veranstaltungen, von Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten.
Insbesondere folgende Faktoren tragen zur Bildung von Kindern bei:
- eine qualitativ gute Kommunikation zwischen Eltern und Kindern (also auch bezogen auf Wortschatz, Begriffsverständnis, Komplexität von Sätzen usw.),
- Unterstützung des (Klein-) Kindes bei der Erkundung der Welt und bei der Aufnahme sozialer Beziehungen,
- bildende Aktivitäten in der Familie, z.B. Beschäftigung mit Lernspielen, Vorlesen, Experimentieren, Gespräche über Fernsehfilme, Bücher, naturwissenschaftliche Themen oder politische Ereignisse,
- eine positive Einstellung zu Lernen und Leistung, zu Kindertageseinrichtung, Schule und Berufsausbildung bzw. Studium,
- positive Interaktionen über das, was in der Schule und im Unterricht passiert, Unterstützung bei den Hausaufgaben, ein hohes Anspruchsniveau hinsichtlich Schulleistung und -abschluss,
- ein enger Kontakt zwischen Eltern und Kindergärtner/innen bzw. Lehrer/innen, damit erstere wissen, wie sie außerfamilale Bildungs- und Erziehungsbemühungen zu Hause unterstützen können.
Da der Einfluss der Eltern in der frühen Kindheit am größten ist, möchte ich zum Schluss dieses Abschnitts noch einige Konsequenzen aus den anfangs genannten Erkenntnissen der Hirnforschung und Entwicklungspsychologie nennen. Prinzipiell müssen Babys und Kleinkinder von ihren Eltern nicht zum Lernen motiviert werden: Ihre Sinne sind voll auf Empfang geschaltet, ihr Gehirn reagiert auf jeden Input mit der Bildung neuer Synapsen. Von Anfang an sind sie Forscher, die alles ausprobieren, handhaben und testen müssen, die ihre Umwelt aktiv erkunden und alles Geschehen um sie herum beobachten.
Dabei sind Babys und Kleinkinder aber auf zwischenmenschliche Interaktionen angewiesen: Obwohl sie "geborene Lerner" sind, verlieren sie innerhalb kurzer Zeit Lernmotivation und Forschungsdrang, wenn sie keine Ansprache und Zuwendung erfahren. Laut den Erkenntnissen der Bindungsforschung lernen sie auch besser, wenn sie "sicher gebunden" sind, also in einer verlässlichen, engen, fürsorglichen, durch Empathie, Wärme, Zuneigung und andere positive Emotionen gekennzeichneten Beziehung zu ihren Eltern leben.
Was können Eltern also tun, um die Gehirnentwicklung und das Lernen von Babys und Kleinkindern zu fördern?
- Werdende Mütter sollten sich während der Schwangerschaft gesund ernähren, auf Tabak, Alkohol, Medikamente u.ä. verzichten sowie regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen.
- Mütter sollten ihr Baby so lange wie möglich stillen, da dann sein Gehirn am besten mit Nährstoffen versorgt wird.
- Auch später sollte auf eine vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung des Kindes geachtet werden.
- Positiv ist, wenn Mütter und Väter bald und angemessen auf die Signale und Bedürfnisse ihres Babys reagieren, ihm viel Körperkontakt bieten, liebevoll und zärtlich mit ihm umgehen, viel mit ihm sprechen, ihm vorsingen und es mit Sprache umgeben.
- Eltern sollten viel mit ihrem Baby bzw. Kleinkind spielen und sich von ihm bei den gemeinsamen Aktivitäten führen lassen. Das heißt auch, dass akzeptiert werden muss, wenn es keine Lust mehr hat.
- Eltern sollten eine anregungsreiche Umgebung schaffen, in der ihr Baby bzw. Kleinkind viel beobachten, erforschen und untersuchen kann. Beispielsweise sind Spielsachen empfehlenswert, die vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bieten, die Fantasie anregen und mehrere Fähigkeiten fördern. Bauklötze oder Malutensilien sind beispielsweise besser als ein fernlenkbares Elektroauto oder ein Kassettenrecorder – und billiger. Eltern können auch Spielsachen mit Nachbarn und Freunden tauschen. Aber sie sollten ihr Kind nicht mit Spielmaterialien "überschütten"; es ist besser, ihm immer nur einige Spielsachen zu geben und die anderen wegzuräumen. Wirkt es gelangweilt, werden die Spielmaterialien ausgetauscht.
- Mütter und Väter sollten ihr Kind an dem beteiligen, was sie gerade selbst tun, und dabei den Schwierigkeitsgrad von Aktivitäten dem Alter des Kindes anpassen. Auf diese Weise erlernt das Kind neue Kenntnisse und Fertigkeiten, gewinnt es an Selbstvertrauen und Selbstachtung. Auch kann es motiviert werden, sich etwas mehr anzustrengen und noch länger durchzuhalten. So werden Eigenschaften wie Leistungsmotivation und Ausdauer gefordert.
- Viele Aufgaben können vereinfacht oder komplizierte Aktivitäten in einfache Teilaufgaben herunter gebrochen werden, sodass das Kind nicht überfordert wird. Eltern sollten es bei auftauchenden Schwierigkeiten ermutigen und ihm wenn nötig helfen, z.B. durch Vormachen oder das Aufzeigen eines Lösungswegs. An Kinder dürfen durchaus Anforderungen gestellt bzw. von ihnen erwartet werden, dass sie sich anstrengen.
- Mütter und Väter sollten viel mit ihrem Kleinkind unternehmen – und ihm Zeit geben, neue Umwelten zu erkunden: die Pflanzen am Wegrand, das Geschäft, das Auto, den Park usw. So entdecken sie wieder den Reiz der Langsamkeit und der kleinen, sonst unbeachteten Dinge.
- Wichtig ist, Kontakte zu anderen Kleinkindern, zu jüngeren und älteren Kindern sowie zu anderen Erwachsenen zu fördern – z.B. in Eltern-Kind-Gruppen, zu Spielplatz-Bekanntschaften, Verwandten und Nachbarn, zu Verkäuferinnen oder Passanten. Dies fördert Sprach- und soziale Fertigkeiten, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen.
- Prinzipiell sollten Eltern viel mit ihrem Kind reden und möglichst alle Fragen beantworten – selbst wenn dies zeitweise ganz schön nerven kann. Sie können ihm zeigen, wie etwas funktioniert, ihm erklären, was sie gerade tun, seine Handlungen kommentieren, Ereignisse interpretieren, Objekte benennen und klassifizieren (z.B. "Ein Hund ist ein Tier"). Das Kind erwirbt dann nicht nur mehr Begriffe und mehr Kenntnisse über unsere Welt, sondern lernt auch, letztere zu kategorisieren und in Hierarchien einzuordnen.
- Väter und Mütter sollten mit ihrem Kind Bilderbücher anschauen, seine Aufmerksamkeit auf die einzelnen Bilder lenken und es erzählen lassen, was es sieht. Sie können Fragen stellen, mit ihm über die Bildinhalte und den Verlauf der Geschichte sprechen (auch: "Was könnte als Nächstes passieren?").
- Ferner können Eltern ihrem Kind Geschichten erzählen (besser als Vorlesen), da dies sein Vokabular vergrößert und zum Denken anregt. Und sie können sich von ihm Geschichten erzählen lassen – Drei- und Vierjährige können dies bereits recht gut. Berichten Kleinkinder von emotional erregenden Ereignissen, können sie sich auf diese Weise auch von ihnen distanzieren und sie somit besser verarbeiten – insbesondere wenn ihre Eltern einfühlsam zuhören.
- Wichtig ist, die Einzigartigkeit und Individualität des Kindes zu wertschätzen, sein Temperament, seine Persönlichkeit und sein Lerntempo zu akzeptieren.
- Lob, Ermutigung und positives Feedback sind besser als Kritik, das Aufzeigen von Fehlern usw. Eltern sollten positive Erwartungen haben und verbalisieren, ihrem Kind seelische Unterstützung und körperliche Zuwendung bieten. Ferner ist sinnvoll, Eigenschaften wie Aufmerksamkeit, Neugier, Fleiß, Begeisterungsfähigkeit, Beharrlichkeit oder Lernmotivation zu fördern.
- Mütter und Väter müssen sich bewusst sein, dass sie das wichtigste Vorbild bzw. Lernmodell für ihr Kind sind. Es wird sie imitieren – auch ihre "schlechten" Seiten.
- Schließlich sollten Eltern eine Reizüberflutung bei ihrem Kind vermeiden, z.B. durch langes Fernsehen, laute Musik oder Lärm. Insbesondere Kleinkinder brauchen noch viel Ruhe – und auch Zeit für sich. Wichtig ist, dass das Kind genügend Schlaf bekommt. Feste Zeiten für das Aufstehen, Mahlzeiten, Mittagsschlaf und Zubettgehen sind sinnvoll.
Selbstverständlich sind dies Ideale, die nur annähernd erreicht werden können. Kinder benötigen keine perfekten Eltern und überstehen es in der Regel ohne negative Folgen, wenn diese einmal "falsch" reagieren. Zudem wachsen Kinder an Belastungen und Problemen, entwickeln neue Fertigkeiten und Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten und widrigen Lebensumständen. Sie werden resilienter (widerstandsfähiger) und entwickeln Frustrationstoleranz.
Eltern können ihre Kinder nur in der frühen Kindheit beschützen; dann müssen sie sie freigeben für eine Welt, die es nicht immer gut mit ihren Kindern meint. Wichtig ist dann, dass sie versuchen, eine positive Beziehung zu ihrem Kind durch alle Wirren der Pubertät und des Jugendalters hindurch aufrechtzuerhalten. Darauf verweist auch der folgende Auszug aus dem Gedicht "An meine Eltern" von Gerhard Kiefel:
Meine Eltern,
wenn ich älter werde
und anders bin, als Ihr es gewünscht habt,
wenn Ihr bemerkt,
daß mit mir ein anderes Leben begann,
auch ein fremdes, das Eurem Leben nicht gleicht –
werdet mir Freunde,
die mich bejahen, so wie ich bin.
Schenkt mir die Liebe,
die annimmt, vertraut und begleitet,
damit ich sie lerne
und mutig werde zu schenken. –
Mein Vater und meine Mutter,
wenn Ihr mich freigebt aus Liebe,
kann ich mich finden und Euch und das Leben.
Sonst nicht.
Qualitativ gute Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen
Aus Untersuchungen über die Qualität von Kindertageseinrichtungen (z.B. Tietze 1998) und von den daraufhin begonnenen Projekten wie z.B. die Nationale Qualitätsinitiative wie auch aus Diskussionen über die Ergebnisse der PISA-Studien wissen wir, dass viele Kindergärten noch nicht die vielfältigen Chancen der frühkindlichen Erziehung und Bildung nutzen. Kindergärtner/innen könnten das riesige Potenzial in Kindern wecken, deren Begabungen entdecken, die kindliche Entwicklung allseitig fördern, den Erwerb von Kenntnissen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten anleiten, bei negativen Einflüssen präventiv wirken sowie bei Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen frühzeitig intervenieren. Diese Möglichkeiten bleiben aber vielfach ungenutzt. Dem Lebensalter, in dem die größte Lernkapazität und die besten Bildungschancen bestehen, wird seitens des Bildungssystems die wenigste Aufmerksamkeit geschenkt.
Da vor allem wohl die Förderung der kognitiven Entwicklung in Kindertageseinrichtungen zu wünschen übrig lässt, möchte ich mich auf einige diesbezügliche Gedanken beschränken.
- Kinder lernen am besten in einer Umgebung, in der sie sich sicher fühlen, wo sie eine enge Beziehung zu Kindergärtner/innen haben (Vertrauen, Zuneigung usw.), wo man sie weder lächerlich bzw. verlegen macht noch anklagt oder anschreit, wo sie entspannt sind und nur einem geringen bis mittleren Maß an Stress ausgesetzt sind.
- Die kindliche Entwicklung sollte allseitig gefördert werden, indem Kindergärtner/innen Wissenserwerb, kognitive, soziale, emotionale und motorische Kompetenzen, Sprachfertigkeiten, ästhetisches Tun, Fantasie und Kreativität gleichermaßen berücksichtigen. Sie sollten viel Stimulierung bieten, indem sie Lerninhalte vielfältig präsentieren, möglichst immer mehrere Sinne gleichzeitig ansprechen und viele Methoden einsetzen – z.B. Projektarbeit, Rollenspiel, Erzählen, Musizieren und Gärtnern.
- Eine optimale Lernumgebung konfrontiert Kinder mit lebensnahen Situationen, z.B. durch viele Ausflüge in die Natur, in den Ort oder zu Geschäften. Sie gestattet vielfältige Aktivitäten mit Wahlmöglichkeiten, beispielsweise z.B. durch das Einrichten von verschiedenen "Lernzentren" im Gruppenraum und in anderen Räumlichkeiten.
- Das Lernen sollte bedeutsam und relevant für Kleinkinder sein: Kindergärtner/innen können sich an den Lebenswelten und Interessen der Kinder orientieren, von deren Alltagswissen ausgehen und dieses auf neue Situationen übertragen, im Alltagsleben einsetzbare Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und auch die Emotionen der Kinder ansprechen.
- Je mehr neue Dinge untersucht werden können, je mehr selbständiges Forschen und Experimentieren möglich sind, je mehr Strategien beim Lösen von Problemen oder Bewältigen von Aufgaben ausprobiert werden können, je mehr neue Erfahrungen und Aha-Erlebnisse im Verlauf eines Tages gemacht werden, umso intensiver ist das Lernen.
- Gespräche mit Kindergärtner/innen bzw. anderen Kindern über Beobachtungen und Erfahrungen, über Gegenstände und Prozesse, Handlungsstrategien und Problemlösungsmethoden sind besonders wichtig, da Kleinkinder dabei neue Begriffe lernen, zum Nachdenken angeregt werden und gerade Gelerntes einsetzen können.
- Kinder brauchen auch Zeit zum Wiederholen, Memorieren und Üben: Zu viel Neues ist kontraproduktiv, wenn nicht genügend Gelegenheiten geboten werden, um neu erworbenes Wissen zu nutzen und gerade entwickelte Fertigkeiten zu praktizieren. Auch für Kleinkinder gilt: Übung macht den Meister.
- Kinder lernen besser, wenn Neugier und Forschergeist gefördert werden, wenn sie eigenständig nach Problemlösungen oder Antworten auf Fragen suchen können, wenn sie für die eigene Leistung selbst verantwortlich sind und wenn sie viel Anerkennung und Lob erfahren. Positiv wirkt sich aus, wenn Kindergärtner/innen Ziele und Leistungsanforderungen klar definieren, viel motivieren, eindeutige Kriterien für Erfolg und Misserfolg aufstellen, sofort Feedback geben und Fehler eher beiläufig korrigieren (bei zu viel Fokussierung können sich Fehler verfestigen).
- Die Individualität eines jeden Kindes sollte bei der Planung von Aktivitäten beachtet werden: Beispielsweise mögen extravertierte Kinder gerne im Stuhlkreis sprechen oder Besucher begrüßen, introvertierte Kinder haben oft Angst davor. Einige Kinder finden Sicherheit in Routinen, andere suchen immer wieder nach neuen Herausforderungen.
- Bewegungseinheiten zwischen Arbeitsphasen fördern Konzentration und Lernen, da sie zu einer besseren Durchblutung des Gehirns beitragen (mehr Sauerstoff und Glukose verfügbar).
- Computer – mit guter Software – intensivieren das Lernen, da sie durch Text, Bild und Ton mehrere Sinne ansprechen, ein häufiges Wiederholen ähnlicher Aufgaben ermöglichen (erleichtert das Memorieren) und den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes berücksichtigen. Malen und Komponieren am Computer fördern auch die Kreativität.
- Kinder, die in ihrer Familie eine am Wohnort wenig benutzte Sprache gelernt haben, sollten so früh wie möglich mit der Landessprache konfrontiert werden – und die anderen Kinder mit einer Fremdsprache. Sie lernen die zweite Sprache am besten im Kontext alltäglicher Interaktionen mit Erwachsenen (und Kindern), die diese beherrschen.
- Positive Beziehungen zwischen Gleichaltrigen, in denen es z.B. keine Gewalt oder Unterdrückung gibt, dafür aber viel Kooperationsbereitschaft beim Lösen von Problemen und Bewältigen von Aufgaben, fördern das Lernen.
Die gerade genannten Punkte – die sich sicherlich um viele weitere Gedanken ergänzen ließen – verdeutlichen, dass die Förderung der kognitiven Entwicklung ein höchst komplexes Geschehen ist, das bei weitem mehr als reine Wissensvermittlung umfasst. Sie muss eingebettet sein in eine allseitige bzw. ganzheitliche Bildung und Erziehung des Kindes.
Diese Gedanken möchte ich noch am Beispiel der naturwissenschaftlichen Bildung im Kindergarten vertiefen, da dieser Bildungsbereich erst seit zwei, drei Jahren intensiver diskutiert wird; er gilt als vernachlässigt. Naturwissenschaftliche Bildung kann im Kindergarten auf ganz unterschiedliche Weise erfolgen, wobei ich nun drei "Bildungswege" vorstellen möchte.
1. Kinder die Natur entdecken lassen
Kleinkinder leben in einer Umgebung voller physikalischer, chemischer und biologischer Phänomene. Häufig reicht es schon, ihre Aufmerksamkeit auf diese Objekte und Prozesse zu lenken und sie zu deren Beobachtung zu motivieren. Da Kleinkinder noch einen Großteil ihres Wissens über ihre Sinne erwerben, wird in diesem Kontext oft von Sinnesschulung gesprochen – der Kindergarten soll auch eine "Schule des Sehens" sein. So sollte eine Erzieherin zunächst erfassen, welchem physikalischen, chemischen oder biologischen Phänomen gerade das besondere Interesse eines Kindes (oder mehrerer Kinder) gilt. Wichtig ist, dass dem Kind genügend Zeit gegeben wird, sich mit diesem Phänomen zu befassen, dass also mögliche Störungen von ihm ferngehalten werden. Ferner muss es die Möglichkeit haben, mit der Erzieherin bzw. mit anderen Kindern über seine Beobachtungen zu sprechen, Hypothesen zu äußern, Zusammenhänge zu vermuten und nach Erklärungen zu suchen. Die Erzieherin kann das Kind motivieren, weitere Sinne zur Erforschung des Gegenstandes bzw. Prozesses einzusetzen. Auch kann sie es auf bisher übersehene Aspekte aufmerksam machen. Durch offene Fragen kann sie sein Interesse verstärken oder auf ähnliche Phänomene lenken, sodass Vergleichen, Abstrahieren und Generalisieren möglich werden. Außerdem kann die Erzieherin seine Umgebung durch Objekte oder Materialien anreichern, die eine weiterführende Beschäftigung mit dem jeweiligen Phänomen ermöglichen. Schließlich kann sie seine Fragen beantworten, ihm also Informationen auf verbalem Weg geben.
Ein Beispiel: Viele Kenntnisse über biologische Phänomene können sich Kinder z.B. im Außengelände eines Kindergartens aneignen. Besteht dieses aber nur aus einer Rasenfläche mit Spielgeräten, einem Sandkasten, einigen Schatten spendenden Bäumen und einer Hecke, sind jedoch die Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder stark begrenzt. Eine ganz andere Situation ist gegeben, wenn verschiedene Obstbäume und Beerensträucher gepflanzt werden, die Hecke durch Spalierobst ersetzt wird, Gemüse-, Kräuter- und Blumenbeete angelegt werden und vielleicht noch ein Biotop wie eine Trockenmauer oder ein flacher Teich geschaffen wird. Dann können Kinder biologische Prozesse wie das Keimen von Samen, das Wachsen, das Blühen und Reifen beobachten. Sie können sich selbst als Gärtner betätigen und dabei feststellen, was Pflanzen zum Gedeihen benötigen. Ferner werden sie viele Insekten, Vögel und Kleintiere wie Mäuse in "ihrem" Garten sehen und erkennen, wie sich diese entwickeln (z.B. von den Eiern über Raupe und Puppe zum Schmetterling), welche Rolle sie für Pflanzen spielen (z.B. Befruchten von Blüten), auf welche Weise sie von den Pflanzen und Bäumen abhängig sind (Nahrung) oder wie sie voneinander leben (Insekten als "Vogelfutter"). Auch wird den Kindern die Bedeutung des Wetters bewusst (z.B. welken manche Pflanzen bei zu viel Sonne, reifen die Tomaten bei zu viel Regen nicht), nehmen sie die jahreszeitlichen Veränderungen viel deutlicher wahr, werden religiöse Feiern wie das Erntedankfest wieder persönlich relevant.
Naturbeobachtungen sind natürlich auch in der Umgebung des Kindergartens möglich. Vielerorts gibt es in nächster Nähe der Einrichtung Wälder oder landwirtschaftlich genutzte Flächen, die immer wieder – zu unterschiedlichen Jahreszeiten – erkundet werden können. In Städten können zumindest Parks aufgesucht oder Gärten auf umliegenden Grundstücken betrachtet werden. Auf dem Wochenmarkt lernen Kinder unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten kennen und können z.B. verschiedene Äpfel für ein "Testessen" im Kindergarten kaufen (Prüfen von Aussehen, Größe, Gewicht, Saftigkeit, Konsistenz des Fruchtfleisches, Geruch, Geschmack usw. – auch eine Form der Sinnenschulung!). Im Botanischen Garten sehen Kinder exotische Pflanzen und erkennen deren andersartigen Lebensbedingungen. Oft gibt es hier auch Beete mit Nutzpflanzen und Kräutern.
Bei solchen Exkursionen sollten sich Kindergärtner/innen vom Interesse der Kinder leiten lassen. Entdeckt ein Kind z.B. Ameisen und wollen die Kinder diese nun beobachten, ist das wichtiger als das Erreichen des "eigentlichen" Ziels des Ausflugs. Stellen die Kinder fest, dass das Herbstlaub unterschiedlich gefärbt ist, können Blätter gesammelt und später im Kindergarten nach Färbung, Größe, Blattform usw. geordnet werden. Aber auch Sammlungen mit anderen Naturmaterialien können angelegt werden. Dann müssen die Kinder z.B. wie Botaniker Pflanzenteile pressen und auf Papier kleben oder wie Geologen Steine klassifizieren. Später bietet sich ein Besuch in einem naturkundlichen Museum an...
Naturerkundungen können dadurch ausgeweitet werden, dass Kindergärtner/innen den Kindern Lupen oder Mikroskope zur Verfügung stellen. Erstere können auch problemlos in das Außengelände des Kindergartens oder bei Ausflügen mitgenommen werden. Durch die Vergrößerung erkennen die Kinder Details an toten oder lebenden Objekten, die sie mit bloßem Auge wahrscheinlich nicht wahrnehmen würden. Sollen mit einer größeren Kindergruppe kleinste Gegenstände angeschaut werden, so können Kindergärtner/innen viele dieser Dinge auch zwischen die Glasscheiben eines Wechselrähmchens klemmen und dann per Diaprojektor an eine weiße Fläche projizieren.
2. Im Kindergarten experimentieren
Auf dem vorgenannten "Bildungsweg" können Kinder vor allem biologische Phänomene erkunden. Er herrscht in Tageseinrichtungen vor, da Kleinkinder sozusagen "natürlich" mit Pflanzen, Insekten, Tieren usw. in Kontakt kommen. Auf dieselbe Weise können sie sich aber z.B. kein Wissen über Gase, den Zusammenhang zwischen Temperatur und Aggregatzustand (d.h. fest, flüssig, gasförmig), die Schwerkraft oder die Hebelwirkung aneignen. Wenn Kindergärtner/innen sie mit solchen physikalischen und chemischen Phänomenen konfrontieren wollen, ist dies in der Regel nur durch Experimente möglich. Diese entsprechen dem frühkindlichen Lernen, da sinnliche Erfahrungen wie Sehen, Riechen, Hören, Berühren und Schmecken im Vordergrund stehen. Außerdem werden kognitive, soziale und sprachliche Kompetenzen gefördert.
Experimente setzen oft eine bestimmte Ausstattung voraus: So werden z.B. verschieden große Gläser und Röhrchen, Pipetten, Pinzetten, Werkzeug, Stethoskop, Waage, Thermometer, (Stopp-) Uhr, Lineal, Zentimetermaß, Luftpumpe, Ventilator, Kompass, Magnete, Pendel, Prismen und Chemikalien benötigt. Bei der Vorbereitung ist zu beachten, dass Beobachtung und Selbsttätigkeit der Kinder im Vordergrund stehen sollten – es darf nicht um reine Wissensvermittlung im Sinne des Schulunterrichts gehen. Das Experimentieren sollte für die Kleinkinder so interessant und faszinierend sein, dass sie sich trotz ihres großen Bewegungsdrangs und der noch gering ausgeprägten Konzentrationsfähigkeit längere Zeit mit dem jeweiligen Phänomen befassen und darüber engagiert diskutieren.
Inzwischen gibt es mehrere Bücher mit Experimenten für Kleinkinder, auf die Kindergärtner/innen zurückgreifen können. Beispielsweise beschreibt Lück (2003) 26 Versuche, die an 15 Tagen durchgeführt werden sollen und jeweils rund eine halbe Stunde dauern. Beispielsweise befasst sich die zweite der drei Experimentierreihen mit dem Wasser: "Dabei werden physikalische Aspekte, etwa die Oberflächenspannung, die Mischbarkeit mit anderen Flüssigkeiten sowie Adhäsion und Diffusion mit einfachen Experimenten dargestellt und kindgerecht gedeutet. Auch der Vergleich mit anderen Flüssigkeiten und deren Eigenschaften, die den Kindern oft noch nicht vertraut sind, wird hergestellt" (S. 130).
Lück (a.a.O.) macht deutlich, dass man für physikalische und chemische Versuche weder teure Experimentierkästen noch schwer erhältliche Chemikalien benötigt. Vieles ließe sich z.B. an Lebensmitteln oder an in jedem Familienhaushalt vorhandenen Materialien zeigen, wodurch auch ein Alltagsbezug gegeben sei und ein Wiederholen des Experiments mit den Eltern ermöglicht würde. Wichtig sei, dass die Experimente so einfach sind, dass sie auch von den Kindern selbst erfolgreich – und selbstverständlich ohne gesundheitliche Risiken – durchgeführt werden können. Die zu beobachtenden Phänomene sollten so eindeutig sein, dass sie von Kleinkindern leicht beschrieben und erklärt werden können. Sinnvoll wäre ein systematischer Aufbau der Experimente, da auf diese Weise bereits erworbenes Wissen aufgefrischt und gefestigt wird. Ferner würde auf diese Weise verdeutlicht, dass dieselben Naturgesetzlichkeiten für ganz unterschiedliche Phänomene gelten.
Allerdings lassen sich die Experimente von Lück (a.a.O.) – wie auch viele von anderen Fachleuten beschriebene Versuche – nur in Kleingruppen von ca. sechs (älteren) Kindern durchführen. Auch ist die Vorbereitung relativ zeitaufwändig, da viele der erforderlichen Materialien erst besorgt werden müssen. Die benötigte Objekte werden zumeist auf einem Tisch angeordnet. Erst dann werden die Kinder geholt, die zunächst alle Gegenstände benennen müssen. Dann folgt eine kurze Einführung in das jeweilige Thema. Die Erzieherin führt das Experiment vor bzw. lässt nacheinander jedes Kind das Experiment machen. Die (übrigen) Kinder beobachten und diskutieren anschließend das jeweilige Phänomen.
Ein Beispiel: "Geheimnisvolle Kräfte sehen: Wir brauchen eine durchsichtige Plastikschale, durchsichtigen Sirup, Eisenfeilspäne, einen Löffel, Magnete. Die Eisenfeilspäne in klaren Sirup geben, vorsichtig umrühren, bis die Späne gleichmäßig verteilt sind. Ein oder zwei Magnete unter das Schälchen legen. Ein magnetisches Feld entsteht. Wo ist die Kraft am stärksten? Die Eisenfeilspäne bewegen sich durch den Sirup, ordnen sich an den Polen an" (Hibon/ Niggemeyer 1998, S. 57).
Zum Experimentieren gehört auch, dass Kinder das "Innenleben" von Geräten erkunden können – selbst wenn diese dabei zerstört werden. Eltern – oder z.B. Werkstoffhöfe – können alte oder kaputte Geräte wie (mechanische) Uhren, Mixer, Kaffeemaschinen, Computer, Radios usw. zur Verfügung stellen, die dann im Kindergarten auseinander genommen werden. Auf diese Weise gewinnen die Kinder einen Einblick in das Funktionieren der Geräte, eignen sich neue Begriffe an (z.B. Transistor, Festplatte, Chip) und erlernen den Umgang mit Werkzeug. Und bei komplizierten Geräten findet sich oft unter den Eltern ein Fachmann oder eine Fachfrau, der bzw. die den Kindern das "Innenleben" erklären kann...
3. Naturwissenschaftliche Bildung durch Projektarbeit
Bei Experimenten, die von den Kindergärtner/innen vorbereitet und an bestimmten Tagen präsentiert werden, besteht die Gefahr, dass sie nicht immer auf das Interesse der Kinder stoßen und durch sie eher isolierte Kenntnisse vermittelt werden. Auch sind sie nicht in die anderen Aktivitäten des jeweiligen Tages eingebettet. Sie ähneln damit Schulstunden, die ebenfalls ohne Zusammenhang aufeinander folgen. Werden sie wie bei Lück (2003) nur mit einigen wenigen älteren Kindern durchgeführt, werden zudem die übrigen Kinder benachteiligt.
Eine andere Situation ist gegeben, wenn Experimente Bestandteile eines Projekts sind, z.B. zu Themen wie "Wasser" oder "Wetter". Die Idee zu einem Projekt kann von einem Kind, einer Kleingruppe, der Erzieherin oder von außen kommen. Manchmal wird die Projektinitiative ungeplant weiterverfolgt. In anderen Fällen wird mit den Kindern gemeinsam entschieden, ob das Projektthema in den nächsten Tagen bzw. Wochen behandelt werden soll – und wie dies geschehen soll. Häufig diskutieren die Kindergärtner/innen aber auch die Projektidee zunächst im Team, nachdem sie sich vom Interesse einer Mehrheit der Kinder überzeugt haben, und machen eventuell sogar einen Projektplan.
Die besondere Bedeutung der Projektarbeit liegt darin, dass im Rahmen eines Projektes alle Bildungsbereiche und alle (Basis-) Kompetenzen der Kinder berücksichtigt werden können. So wird in einem Projekt beispielsweise gespielt (insbesondere Rollenspiele), experimentiert, beobachtet, analysiert, diskutiert, gebastelt, gemalt, gesungen, getanzt usw., werden motorische, soziale, emotionale, sprachliche und kognitive Fähigkeiten gefördert. Projekte sind somit typische Beispiele für "exemplarisches Lernen": Die Themen können ganz unterschiedlich sein, aber immer werden alle Sinne und Kompetenzen geschult.
Ein Beispiel: Katz und Chard (1989) berichten, dass beim Projekt "Wetter" zunächst im Stuhlkreis über die Erfahrungen der Kinder diskutiert wurde: So wurde besprochen, wie sich Sonnenschein, Regen, Schnee und Wind auf der Haut anfühlen und welche Geräusche ein Sturm oder ein starker Regenschauer machen. Die Kinder beschrieben ihre Gefühle beim ersten Schnee in einem Jahr oder als sie einen Regenbogen sahen. In den folgenden Tagen wurden Bilder über Wetterphänomene gemalt, relevante Geschichten vorgelesen und entsprechende Lieder, Reime und Bauernregeln gelernt. Naturwissenschaftliche Bildung erfolgte vor allem durch folgende Aktivitäten:
- Neben ein großes Außenthermometer wurden verschiedenfarbige Papierstreifen geklebt, wobei jeweils ein Streifen 5 Grad entsprach. Morgens, mittags und abends dokumentierten die Kinder anhand der Streifen die Temperatur im Außengelände und in verschiedenen Räumen des Kindergartens. So lernten sie nicht nur das Thermometer kennen, sondern gewannen auch eine Vorstellung von "Temperatur" und von "Grad" als der hier verwendeten Maßeinheit. Ferner wurde darüber diskutiert, was die Temperaturschwankungen im Verlauf eines Tages bzw. mehrerer Tage bedingt.
- Analog dazu wurde der Wind mit einem Windrad (Geschwindigkeit) und einer Wetterfahne (Richtung) gemessen.
- Der Niederschlag wurde in einem Messbecher aufgefangen, sodass die Wassermenge jeden Tag erfasst werden konnte. Die Umrisse von Regenpfützen wurden mit Kreide nachgezogen. Dann wurde regelmäßig nachgeschaut, um wie viel kleiner sie geworden sind. So wurde die Verdunstung des Wassers verdeutlicht.
- Ganz unterschiedliche Materialien wurden auf Wasserdurchlässigkeit geprüft.
- Es wurde getestet, wie schnell Eiswürfel schmelzen, wenn sie aus verschiedenen bzw. gefärbten Flüssigkeiten sind oder wenn sie in Papier, Stoff, Folie usw. eingewickelt werden.
Ferner wurde mit den Kindern darüber gesprochen, wie sich Tiere an die verschiedenen Witterungsverhältnisse anpassen (z.B. Winterschlaf, Geburt der Jungen im Frühjahr), dass es auf der Erde unterschiedliche Klimazonen gibt (von der Polarregion bis zu den Tropen), welche Tiere und Pflanzen in der jeweiligen Region vorherrschen und wie die Menschen dort leben. Es wurden Drachen und Papierflieger gebastelt und bei verschieden starkem Wind ausprobiert. Geschichten über (Wirbel-) Stürme und die von ihnen verursachten Schäden wurden erzählt und diskutiert.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass bei einem Projekt ganz unterschiedliche Aktivitäten in einem thematischen Zusammenhang stehen und ein harmonisches Ganzes bilden. Die Kinder werden allseitig gefördert und sind hoch motiviert, weil sie viel Abwechslung erleben und den Verlauf eines Projekts mitbestimmen können. Oft befassen sie sich auch in der Freispielzeit mit dem Projektthema, insbesondere wenn die Kindergärtner/innen entsprechende Materialien zur Verfügung stellen – z.B. wenn bei einem Projekt "Tiere" sich in der Rollenspielecke Tierkostüme befinden, in der Bauecke Tierfiguren vorhanden sind und in der Bilderbuchecke Fotobände und reich bebildete Tierlexika ausliegen. Häufig ergeben sich dann aus dem Spiel der Kinder neue Ideen für den weiteren Verlauf des Projekts.
Somit ist Projektarbeit zu empfehlen, wenn naturwissenschaftliche Themen nicht isoliert wie in den entsprechenden Schulfächern, sondern eingebettet in ganz unterschiedliche, aber relevante Aktivitäten behandelt werden sollen. Letzteres entspricht mehr dem frühkindlichen Lernen, da sich das Kleinkind als "ganzes" Individuum angesprochen fühlt, alle seine Sinne einsetzen kann, vieles auf spielerische Weise lernt und intensiv mit den anderen Kindern kommuniziert. Anders als bei vorgegebenen Experimenten werden keine künstlichen Situationen geschaffen. Vielmehr wird der Input der Kinder, werden ihre Interessen, Ideen, Vorstellungen usw. in hohem Maße berücksichtigt. Das selbsttätige Generieren von Fragestellungen, das eigenständige Bilden von Hypothesen, das Beobachten, Interpretieren und Analysieren, das Sammeln von Informationen und die Präsentation der Erkenntnisse stehen im Vordergrund – also wissenschaftliche Aktivitäten...
Qualitativ gute Bildung und Erziehung in Schulen
Wie bereits erwähnt, bin ich kein Fachmann im Bereich der Schulpädagogik. Dennoch möchte ich als Außenstehender zumindest zwei Gedanken äußern: zur Rückgewinnung des Erzieherischen und zur ganzheitlichen Bildung.
Im Gegensatz zu Kindertageseinrichtungen steht an Schulen die Wissensvermittlung im Zentrum des Geschehens. Insbesondere an Sekundärschulen spielen hingegen Erziehung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung keine große Rolle mehr – erstere beschränkt sich zumeist auf das Herstellen von Unterrichtsbedingungen wie Ruhe und Ordnung im Klassenzimmer, letztere ist noch weniger relevant. Die Konsequenzen sind vielfältig und zumeist negativ: die laut den Forschungsergebnissen der Lernpsychologie kontinuierliche Abnahme der Lern- und Leistungsmotivation im Verlauf der Schulzeit, die beträchtliche Quote der Schulabgänger ohne Abschluss, Mobbing und Gewalt an der Schule, der hohe Prozentsatz von Schüler/innen mit Verhaltensauffälligkeiten, psychosomatischen Beschwerden, (Schul-) Stresssymptomen und anderen Problemen etc.
Seit Beginn der akademischen Diskussion pädagogischer Fragen wird betont, dass die entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Erziehung und Bildung von Kindern ein positives erzieherisches Verhältnis zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen ist. Meines Erachtens wird an heutigen Schulen viel zu wenig Wert auf die Schaffung eines solchen "pädagogischen Bezugs" gelegt. So müssten sich die Lehrer/innen erst einmal das Vertrauen ihrer Schüler/innen verdienen. Hier spielt ihre Persönlichkeit eine große Rolle – nicht nur hinsichtlich der Vorbildwirkung, sondern in diesem Zusammenhang auch hinsichtlich des Vorhandenseins von Eigenschaften, welche die Entstehung eines erzieherischen Verhältnisses fördern.
Der Pädagoge Thalmann (1978) schreibt: "Ein Lehrer, der partnerschaftlich mit seinen Schülern zusammenarbeiten will, muss sich ihnen als ganze Person stellen; dazu gehört, daß er auch Gefühle von Betroffenheit, Enttäuschung und Ärger, ja auch von Ratlosigkeit gegenüber einzelnen Verhaltensweisen von Schülern zeigt" (S. 59). Das Lehrer-Schüler-Verhältnis sollte im Sinne Martin Bubers (1962) Elemente einer Ich-Du-Beziehung enthalten, also dialoghaft sein. Dafür gilt: "Auf die Ganzheit des Zöglings wirkt nur die Ganzheit des Erziehers wahrhaft ein, seine ganze unwillkürliche Existenz" (S. 66). In einer guten Beziehung begegnen Lehrer und Schüler einander in Offenheit, nehmen einander ernst, akzeptieren einander als einzigartige Individuen und gehen unmittelbar aufeinander ein. In einem derartigen dialogischen Verhältnis kann der Lehrer in die Tiefen der kindlichen Persönlichkeit einwirken, dem Schüler bei der Personalisation helfen. Ein solches erzieherisches Verhältnis ermöglicht auch die Beratung des Schülers bei individuellen, familialen und anderen Schwierigkeiten. Gerade in Problem- oder Krisensituationen ist der innere Kern eines Kindes oder Jugendlichen für "unstetige Formen" der Erziehung (Bollnow 1959) wie Erweckung, Ermahnung, Besinnung, Begegnung und Beratung zugänglich. Dann kann die Lebensführung entscheidend beeinflusst werden.
Ansonsten sind die schulischen Lernangebote weiterhin zu sehr auf passives kognitives Lernen ausgerichtet. Somit sollte die Schule wieder mehr das praktische Lernen fördern, das Lernen durch Versuch und Irrtum sowie das Lernen durch Beobachtung. Werken, das eigene Experimentieren im Physik- und Chemieunterricht, Exkursionen, Projektunterricht usw. bieten die Möglichkeit, Materialien und ihre Veränderung bzw. Verarbeitung praktisch kennen zu lernen. Entstehen eigene Arbeitsprodukte, dann werden neue Fertigkeiten gelernt, wird die Körperbeherrschung besser, gewinnen die Schüler an Selbstachtung und Selbstbewusstsein.
Ähnliches gilt auch für Projekte wie das Schreiben und Aufführen eines Theaterstücks, das Drehen eines Films, der Befragung Erwachsener zu einem bestimmten Thema oder eigene Recherchen in Archiven, Bibliotheken und im Internet. Hier erlernen die Kinder den Umgang mit Menschen, mit Gedachtem und Geschriebenem. Auch werden ihre kreativen Fähigkeiten gefördert. Die Schüler/innen müssen sich bewähren und lernen am Ernstfall, da sie ähnliche Arbeiten wie berufstätige Erwachsene ausüben. Thalmann (1978) schreibt: "Es sei die These aufgestellt, dass ein Schüler mehr gelernt hat, wenn er Nachschlagewerke, Lexika, Wörterbücher, Fachliteratur schnell und richtig gebrauchen kann und wenn er Bescheid weiß, bei welchen Personen und Institutionen er sich bei Problemen beraten lassen kann, als wenn er abfragbare Inhalte lernt, die in der Regel rasch wieder vergessen werden" (S. 70).
Es dürfte also sinnvoll sein, wenn Lehrer/innen Unterrichtsstunden häufig als Problemlöseprozess konzipiert. Sie schaffen eine motivierende Ausgangssituation, formulieren eine Aufgabe, stellen Hilfsmittel zur Verfügung, geben auf Fragen hin Auskunft – und lassen die Schüler/innen selbst die Aufgabe bewältigen, Lösungen suchen und realisieren. Auch sollte den Kindern im Unterricht vermehrt die Möglichkeit geboten werden, sich mit sich selbst, ihren Klassenkameraden und ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen und erworbene Fertigkeiten einzubringen. Verstehen die Lehrer/innen ihre Schüler/innen als Partner im Lernprozess, werden sie ihnen Mitwirkungsrechte und Mitverantwortung für den Unterricht einräumen.
Auch die Sozialerziehung in der Schule ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtig. Team- bzw. Gruppenarbeit und Schülerprojekte, Klassen- und Schulfeste, Ausflüge und Schullandheimaufenthalte ermöglichen Kindern, ihre kommunikativen Fertigkeiten zu schulen und den Umgang mit Gleichaltrigen zu lernen. Durch das Besprechen von Konflikten im Unterricht können effektive Wege zur Konfliktlösung vermittelt werden. Prinzipiell sollten Lehrer/innen Gruppenprozesse so steuern, dass sich alle Kinder geborgen und wohl fühlen sowie das gemeinsame Lernen, Experimentieren, Diskutieren und Erforschen wertschätzen. Kooperationsbereitschaft und Leistungsmotivation sollten die Atmosphäre in der Gruppe kennzeichnen. Die Kinder müssen auch die Gewissheit haben, dass sie Fehler machen oder mangelnde Fertigkeiten eingestehen können, ohne von anderen ausgelacht oder verspottet zu werden.
Einbindung von Eltern in die pädagogische Arbeit der Kindertageseinrichtung
Wie bereits erwähnt, können die Erziehung und Bildung von Kindern verbessert werden, wenn Eltern und Kindergärtner/innen bzw. Lehrer/innen in Rahmen einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zusammenarbeiten. Nachdem ich schon über die Erziehungspartnerschaft referiert habe, möchte ich zum Schluss meines Vortrags noch auf die Bildungspartnerschaft eingehen und zunächst aufzeigen, wie Eltern in die pädagogische Arbeit von Kindergärten eingebunden werden können.
Die Hospitation ist eine gute Möglichkeit, Eltern zu verdeutlichen, wie in den Gruppen gearbeitet wird: Nach Voranmeldung nimmt eine Mutter oder ein Vater am Kita-Alltag teil, und zwar nicht als Beobachtende/r, sondern als Mitwirkende/r – der Elternteil spielt mit den Kindern in der Freispielzeit, macht bei Aktivitäten mit, beteiligt sich an Gesprächen. Viele Eltern reizt dieses Angebot, weil sie auf diese Weise "hautnah" den Kindergartenalltag miterleben können. So sind manche durchaus bereit, hierfür einen (halben) Tag Urlaub oder Zeitausgleich zu nehmen.
Die aktive Mitarbeit von Eltern im Kindergarten geht aber noch darüber hinaus – und dies ist ein heißes Eisen, wie das folgende Beispiel zeigt: Im Jahr 1993 wurde in Bayern das "Netz für Kinder" als eine innovative Form der Kindertagesbetreuung eingeführt, die in ihrem Konzept eine kontinuierliche Elternmitarbeit berücksichtigt. Gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft betreuen ein bis zwei Elternteile Kinder in weit altersgemischten Gruppen von 12 bis 15 Kindern. Den Eltern wird hier die Möglichkeit gegeben, Verantwortung für Erziehung und Bildung in einer Kindertagesstätte zu übernehmen. Zumindest ein Elternteil pro Familie muss in der Einrichtung mitarbeiten.
Können Sie sich vorstellen, wie stark diese neue Form der Kindertagesbetreuung von Kindergärtner/innen aus Regeleinrichtungen angegriffen wurde? Jeden Tag ein Elternteil in der Gruppe! Und jeden Tag andere – schließlich müssen rund 15 Eltern nacheinander mitarbeiten! Wo Eltern überhaupt nicht qualifiziert sind! Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt, zumal nur rund 160 Gruppen entstanden. Und ist es wirklich so verwerflich, wenn Eltern in Kindertageseinrichtungen mitarbeiten? Insbesondere wenn dadurch keine Arbeitsplätze für Kindergärtner/innen verloren gehen?
Werfen wir einmal einen Blick auf die USA: Hier waren 1990 laut einer Studie des U.S. General Accounting Office (1995) Eltern in Gruppen Drei- und Vierjähriger für bis zur Hälfte der Öffnungszeit als Freiwillige tätig – und zwar an 88% der Head Start, 45% der schuleigenen, 27% der gemeinnützigen und 12% der kommerziellen Kindertageseinrichtungen. In Nordamerika trifft man also auf Eltern, die z.B. kleine Gruppen von Kindern am Computer anleiten, mit ihnen in einer Fremdsprache sprechen, Beschäftigungen durchführen oder einfach nur mit ihnen spielen. Eine Bildungspartnerschaft von Kindergarten und Familie zeigt sich hier im gemeinsamen pädagogischen Handeln von Kindergärtner/innen und Eltern.
Von der Anwesenheit der Eltern im Kindergarten profitieren Kindergärtner/innen und Kinder. Erstere werden entlastet, wenn Eltern Kleingruppen von Kindern beim Freispiel beaufsichtigen, an Projekten mitwirken, die Gruppe bei Ausflügen begleiten, beim Aufräumen helfen, mit Kindern spielen, basteln oder andere Aktivitäten durchführen. So gewinnen Kindergärtner/innen Freiräume, die sie z.B. für die Beobachtung einzelner Kinder nutzen können. Auch wird die Arbeit in offenen Gruppen erleichtert, da mehr Aufsichtspersonen zur Verfügung stehen und mehr Angebote gemacht werden können. Die Kinder profitieren in ihrer Entwicklung, weil sie neben den Kindergärtner/innen andere Erwachsene als Spiel- und Gesprächspartner, als Vorbild und Rollenmodell haben. Sie erfahren mehr Stimulation, Anleitung und Förderung. Durch die intensivere Interaktion mit Erwachsenen wird ihre sprachliche und kognitive Entwicklung beschleunigt. Ferner erwerben sie soziale Kompetenzen durch den Umgang mit zuvor oft unbekannten Erwachsenen.
Eltern können aber noch mehr aktiviert werden, indem sie zur Mithilfe bei pädagogischen Angeboten bzw. zu deren (Mit-)Gestaltung aufgefordert werden. Hier ist es von Vorteil, wenn die Kindergärtner/innen über Berufe, Hobbys und besondere Fähigkeiten von Eltern gut informiert sind, sodass sie einzelne Eltern gezielt ansprechen können. Aber auch durch eine Umfrage können sie ermitteln, wie sich Eltern in der Kindertageseinrichtung engagieren wollen. Weitere Tipps:
- Schon bei den ersten Kontakten und beim ersten Elternabend sollten neue Eltern auf die Möglichkeit einer Beteiligung an pädagogischen Angeboten hingewiesen werden.
- Durch das frühzeitige Aushängen von Monats- oder Wochenplänen können Eltern informiert werden, was an Projekten und Aktivitäten geplant ist oder wo ihre Mithilfe benötigt wird. Dann können sie mittelfristig planen, sich also z.B. einen halben Tag frei nehmen.
- Eltern, die häufiger in der Kindertageseinrichtung mithelfen wollen, können in einer speziellen Veranstaltung über die an sie gerichteten Erwartungen, das "richtige" Verhalten gegenüber Kindern, relevante Gruppenregeln (Disziplin), den Datenschutz u.ä. informiert werden. Hier ist es auch sinnvoll, mit ihnen von Zeit zu Zeit über die gesammelten Erfahrungen zu sprechen, ihnen Feedback zu geben und sie zu ermutigen, sich weiter zu engagieren.
- Es ist darauf zu achten, dass bestimmte Gruppen von Eltern nicht "außen vor bleiben". Auch Väter, Alleinerziehende, Aussiedler usw. können eingebunden werden. Notfalls muss z.B. bei Ausländern mit unzureichenden Deutschkenntnissen ein Elternteil aus demselben Sprachraum als Dolmetscher gewonnen werden.
- Kommen Eltern in die Gruppe, um an einem besonderen Angebot bzw. Projekt mitzuwirken, sollten sie herzlich begrüßt und den Kindern vorgestellt werden.
- Ist die Aktivität beendet, danken die Kindergärtner/innen den Eltern herzlich und verabschieden sie mit der Gruppe.
- Die Fachkräfte sollten Eltern, die sich häufig engagieren, auch öffentlich danken (z.B. bei einem Elternabend, in einem Elternbrief).
- Die Mitwirkung von Eltern sollte nicht nur im Team geplant, sondern dort auch evaluiert werden.
Einige Beispiele: Ein Vater, der von Beruf Masseur ist, kann seine beruflichen Fertigkeiten in die Kindergruppe einbringen. Er zeigt den Kindern einige Massagegriffe, leitet sie bei einer Partnermassage an und führt sie hin zu einer entspannten Körperhaltung und Atmung. Zu einer Mutter dürfen die Kinder in die Arztpraxis kommen, ein anderer Vater lädt die Gruppe zur Besichtigung seiner Bäckerei ein, eine weitere Mutter ist bereit, ihr Baby in der Gruppe zu baden, zu wickeln und zu füttern. Den fachgerechten Umgang mit den Werkzeugen an der Werkbank zeigt ein Großvater, der früher als Schreiner gearbeitet hat.
Wichtig ist, dass es sich hier nicht um isolierte Ereignisse handelt: Beispielsweise können die Kinder nach dem Erlernen von Massagegriffen immer wieder motiviert werden, einander zu massieren, oder sie können andere Formen der Entspannung kennen lernen – z.B. meditative Musik, Entspannungsübungen oder das Malen von Mandalas. Der Besuch bei der Mutter in der Arztpraxis kann mit Gesprächen und Aktivitäten rund um das Thema "Gesundheit und Krankheit" verknüpft werden oder die Besichtigung der Bäckerei des Vaters mit dem Kennenlernen anderer Handwerksberufe.
Dies verdeutlicht, dass eine Mitarbeit von Eltern vor allem im Rahmen von Projekten sinnvoll ist. Erzieherinnen können interessierte Eltern bereits in deren Planung einbeziehen: Diese können Ideen beisteuern, organisatorische Aufgaben übernehmen, eine besondere Aktivität mit Kindern übernehmen oder auch als Begleitpersonen bei Exkursionen mitkommen. Projekte unter Beteiligung der Eltern können z.B. die Erkundung der Gemeinde, das Leben in der Vergangenheit, Besuche in Museen, Theatern, Redaktionen oder Druckereien u.ä. umfassen (siehe Textor 2004).
Ein Elternteil kann aber auch an "ganz normalen" Aktivitäten der Kindergruppe mitwirken. In der Tabelle finden sich einige Beispiele (vgl. DiNatale 2002), die hier nur stellvertretend für eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten stehen.
|
Möglichkeiten der Beteiligung von Eltern |
|
|
Malen |
in der Malecke Kindern assistieren benötigte, von den Kindern aber nicht erreichbare Utensilien holen mit Kindern über ihre Kunstwerke sprechen den Namen der Kinder unter die Bilder schreiben |
|
Basteln/Werken |
Helfen beim Umgang mit Scheren und Klebstoff mit Kindern Perlen aufreihen, Papier falten usw. Unterstützen von Kindern im Umgang mit Werkzeug Aufpassen, dass Kinder sich nicht verletzen Herstellen von Requisiten für das Puppentheater |
|
Musik |
Singen/Einüben von Liedern interessierten Kindern ein Musikinstrument vorstellen mit Kindern tanzen zu Hause Kassetten mit Musik bespielen |
|
Spiele |
mit Kindern Bauwerke erstellen; aufpassen, dass nicht die Bauten anderer Kinder umgestoßen werden Beteiligung an Tischspielen, falls von den Kindern gewünscht zu Hause Puppen oder Spielsachen herstellen |
|
Rollenspiel |
Beteiligung an Rollenspielen neue Rollen und Themen einführen mit Kindern den Rollenspielbereich auf ein bestimmtes Thema bezogen ausstatten zu Hause Kleidung für den Rollenspielbereich nähen |
|
Medienerziehung |
Kindern ein Bilderbuch vorstellen mit Kindern über ihre Lieblingsbücher sprechen Märchen und Geschichten erzählen/vorlesen Kindern am Computer assistieren zu Hause Kassetten mit selbst vorgelesenen Geschichten bespielen |
|
Naturwissenschaften |
mit einigen Kindern experimentieren oder bei Experimenten assistieren Kinder auf Naturphänomene aufmerksam machen, mit ihnen über Tiere, Insekten und Pflanzen sprechen Kindern vor Störungen durch andere schützen, wenn sie sich z.B. alleine mit Montessori-Material beschäftigen |
|
Mathematik |
Anleiten von Kindern beim Zählen, Sortieren und Vergleichen von Objekten Eigenschaften wie größer – kleiner, schwerer – leichter miteinander in Beziehung setzen |
|
Sprache |
mit einzelnen Kindern/Kleingruppen längere Gespräche führen neue Begriffe einbringen mit Kindern über die Bedeutung von Wörtern sprechen Kindern eine Fremdsprache vorstellen Fingerspiele, Gedichte oder Reime einführen |
|
Freispiel (draußen) |
den Kindern beim Anziehen von Mänteln, Schuhen usw. helfen mit Kindern Fangen oder Verstecken spielen, ihnen einen Ball zuwerfen usw. mit Kindern im Sandkasten spielen |
|
Mahlzeiten |
den Kindern beim Decken und Abdecken des Tisches helfen mit Kindern kochen (auch ausländische Gerichte) und backen Herrichten eines gesunden Frühstücksbuffets für die Kinder (regelmäßig/einige Male pro Monat) |
|
usw. |
usw. |
Um die Eltern zur Mitarbeit zu motivieren, kann auch die Kindergruppe an sie herantreten. Dies kann beispielsweise so geschehen: An der Tür des Gruppenraumes hängt eine von den Kindern gefertigte Collage, die einen Wald zeigt. Darunter steht geschrieben: "Wir beschäftigen uns zur Zeit mit dem Wald. Wer kann uns zu diesem Thema Bücher, Bilder und andere Materialien mitbringen? Da wir demnächst mit der Gruppe eine Walderkundung machen wollen, würden wir uns auch über 'fachkundige' Begleitpersonen freuen". Oder die Kinder werden mit dem Auftrag nach Hause geschickt, die Eltern zu einem bestimmten Thema zu "interviewen" oder sie um etwas zu bitten – z.B. um ein "historisches" Objekt zum Anschauen in der Gruppe. Diese Beispiele zeigen wie die vorgenannten, dass durch die Unterstützung der Eltern sachorientiertes Lernen und realitätsnahe Erfahrungen für die Kinder möglich werden und das pädagogische Angebot der Kindertageseinrichtung umfassender und vielfältiger wird.
Eltern können aber auch – bei entsprechender Information durch die Tageseinrichtung – Bildungsinhalte zu Hause aufgreifen und vertiefen. Beispielsweise können sie zum Monatsthema passende Bilderbücher aus der Stadtbibliothek ausleihen und mit den Kindern anschauen, mit ihnen über neue Begriffe sprechen oder mit ihnen bestimmte Aktivitäten wie ein Experiment, eine Bastelarbeit oder ein Interview durchführen. Die Erzieherin kann auch Materialien wie Bilderbücher, Lernspiele, Anleitungen, Praxisartikel usw. zusammenstellen, die Eltern ausleihen können. So kann sie diese motivieren, zu Hause bildende Aktivitäten mit ihren Kindern durchzuführen. Die Materialien können in Bezug zum Monatsplan oder zum aktuellen Projekt stehen, müssen dies aber nicht.Um die Eltern zur Mitarbeit zu motivieren, kann auch die Kindergruppe an sie herantreten. Dies kann beispielsweise so geschehen: An der Tür des Gruppenraumes hängt eine von den Kindern gefertigte Collage, die einen Wald zeigt. Darunter steht geschrieben: "Wir beschäftigen uns zur Zeit mit dem Wald. Wer kann uns zu diesem Thema Bücher, Bilder und andere Materialien mitbringen? Da wir demnächst mit der Gruppe eine Walderkundung machen wollen, würden wir uns auch über 'fachkundige' Begleitpersonen freuen". Oder die Kinder werden mit dem Auftrag nach Hause geschickt, die Eltern zu einem bestimmten Thema zu "interviewen" oder sie um etwas zu bitten – z.B. um ein "historisches" Objekt zum Anschauen in der Gruppe. Diese Beispiele zeigen wie die vorgenannten, dass durch die Unterstützung der Eltern sachorientiertes Lernen und realitätsnahe Erfahrungen für die Kinder möglich werden und das pädagogische Angebot der Kindertageseinrichtung umfassender und vielfältiger wird.
Kindergärtner/innen können im Rahmen der Bildungspartnerschaft die Eltern motivieren, beispielsweise ihre Kinder auf dem Gebiet der Spracherziehung verstärkt zu fördern. So können sie die Eltern zu folgenden Aktivitäten anhalten: Vorlesen, Bilderbücher betrachten, (Gute-Nacht-) Geschichten erzählen, dem Kind zuhören, wenn es etwas erzählt, und dann das Gespräch ausweiten etc. Als sehr hilfreich hat sich erwiesen, wenn Eltern in der Tageseinrichtung auch (Bilder-) Bücher ausleihen können, sodass sie sich nicht die oft recht teuren Bücher kaufen müssen bzw. sich den Weg zur Gemeindebücherei ersparen. Workman und Gage (1997) meinen: "Wir glauben, dass die wichtigste und effektivste Form der Mitarbeit, in der sich Eltern engagieren können, die Beschäftigung mit ihren eigenen Kindern ist, in ihren eigenen Wohnungen ..." (S. 10). Auf diese Weise werden die Lernerfahrungen des Kindes verstärkt und ausgeweitet, wird die Bildung in der Familie intensiviert.
Einbindung von Eltern in die pädagogische Arbeit an Schulen
Die gerade beschriebenen Wege zur Verwirklichung der Bildungspartnerschaft dürften auch für Schulen relevant sein. So könnten hier ebenfalls Hospitationen ermöglicht werden (wie in § 72 Hessisches Schulgesetz, in dem ausdrücklich erwähnt wird, dass Eltern unter bestimmten Voraussetzungen den Unterricht ihrer Kinder besuchen dürfen). Auch könnten Eltern durchaus gelegentlich in Schulen mitarbeiten, z.B. im Rahmen von Projekten. Auf diese Weise könnten Eltern am Vorbild der Lehrkräfte lernen, wie komplexe und vielseitige Bildungsprozesse geplant, initiiert und gelenkt werden, wie die Bedürfnisse und Interessen von Kindern berücksichtigt werden, wie diese an Entscheidungen beteiligt werden und auf welche Weise ihre Lernmotivation aufrecht erhalten wird. Wenn Eltern z.B. während eines Projekts Kleingruppen bei bestimmten Aktivitäten anleiten, ist sogar "learning by doing" möglich – mit Rückmeldung durch die Lehrer/innen.
Je mehr die Familie als Co-Produzent von Bildung wahrgenommen und je intensiver die Kooperation mit ihr wird, umso mehr müssen Lehrer/innen ihre Erziehungs- und Bildungsziele mit den Eltern abstimmen und ihre Bildungsangebote in die Familien hineintragen. So können z.B. die Eltern aufgefordert werden, Unterrichtsthemen zu Hause aufzugreifen und zu vertiefen. Auf diese Weise wird erreicht, dass Eltern und Kinder über Unterrichtsinhalte sprechen, diese vertiefen oder ergänzende Aspekte gemeinsam erarbeiten. In den USA wird beispielsweise seit Jahren mit so genannten "interaktiven Hausaufgaben" gearbeitet, die Lehrer/innen unter Berücksichtigung der Interessen von Eltern und Kindern entwickeln und die von Letzteren im Gespräch miteinander erledigt werden müssen (Bailey et al. 2004). Ergänzend werden mancherorts "homework workshops" angeboten, in denen Eltern lernen, wie sie mit solchen interaktiven Hausaufgaben umgehen sollen. Dabei geht es auch um das Erlernen von Fragetechniken, die Kinder zum Nachdenken anregen. Bei Workshops an Grundschulen wird besonders betont, wie Eltern das Lesen ihrer Kinder fördern können. Inzwischen wurde nachgewiesen, dass Eltern-Kind-Interaktionen im Zusammenhang mit dem Erledigen von Hausaufgaben das Interesse an Bildung auf beiden Seiten fördern und beim Kind zu besseren Schulleistungen führen (a.a.O.).
Abschließend ist mit DiNatale (2002) festzuhalten: "Wenn Eltern eingebunden werden, gewinnen sie ein besseres Verständnis von ihrer Rolle als primäre Erzieher ihres Kindes. Darüber hinaus lernen Eltern und Kindergärtner/innen [bzw. Lehrer/innen] einander besser kennen und lernen voneinander. Dies führt dazu, dass die Kinder mehr individuelle Beachtung erfahren und das Curriculum gehaltvoller und abwechslungsreicher wird" (S. 90). DiNatale verweist darauf, dass nach amerikanischen Forschungsergebnissen Kindertageseinrichtungen und Schulen mit einem hohen Grad konsistenter und sinnvoller Elternbeteiligung erfolgreicher sind als solche ohne Elternmitarbeit. Auch wären die Fach- bzw. Lehrkräfte mit ihrer Arbeit zufriedener und besäßen mehr Selbstachtung. Die Eltern würden sich bewusst, dass ihr Verhalten und Vorbild einen großen Einfluss auf die Erziehung und Bildung ihrer Kinder haben und würden sich dementsprechend mehr engagieren – wobei Forschungsergebnisse belegen, dass einer der wichtigsten Faktoren, die den Schulerfolg von Kindern bestimmen, das Ausmaß der Beteiligung der Eltern an ihrer Bildung ist.
Anmerkung
Eine umfassendere Darstellung der Thematik finden Sie in meinen Büchern "Bildung im Kindergarten. Zur Förderung kognitiver Kompetenzen" (Books on Demand, 2. Aufl. 2021), "Elternarbeit im Kindergarten. Ziele, Formen, Methoden" (Books on Demand, 4. Aufl. 2021) und "Elternarbeit in der Schule" (Books on Demand, 3. Aufl. 2021), die im Buchhandel und z.B. bei Amazon erhältlich sind.
Literatur
Astington, J.W.: Wie Kinder das Denken entdecken. München, Basel: Reinhardt 2000
Bailey, L.B. et al.: The Effects of Interactive Reading Homework and Parent Involvement on Children's Inference Responses. Early Childhood Education Journal 2004, 32, S. 173-178
Becker-Textor, I.: Der Dialog mit den Eltern. München: Don Bosco 1992
Bollnow, O.F.: Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung. Stuttgart: Kohlhammer 1959
Brezinka, W.: Erziehung in der Familie. Gute Beispiele und Wertüberzeugung sind gefragt. Die politische Meinung 1989, 34, S. 47-51
Buber, M.: Reden über Erziehung. Heidelberg: Schneider Lambert 1962
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hg.): Ratgeber zum Schulalltag. Wien: Selbstverlag 2002
Coleman, J.S. et al.: Equality of Educational Opportunity. Washington 1966
DiNatale, L.: Developing high-quality family involvement programs in early childhood settings. Young Children 2002, 57 (5), S. 90-95
Eliot, L.: Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren. Berlin: Berlin Verlag 2001
Fraser, B.J. et al.: Syntheses of Educational Productivity Research. International Journal of Educational Research 1987, 11, S. 147-251
Hentig, H. von: Was ist eine humane Schule? München, Wien: Hanser 1976
Hibon, M./ Niggemeyer, E.: Spielzeug Physik. Hundert Welten entdeckt das Kind. Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand 1998
Hochschild, A.R.: Keine Zeit. Wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit wartet. Opladen: Leske + Budrich 2002
Katz, L.G./ Chard, S.C.: Engaging children's minds: the project approach. Norwood: Ablex 1989
Krumm, V.: Schulleistung – auch eine Leistung der Eltern. Die heimliche und die offene Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern und wie sie verbessert werden kann. Manuskript, o.J.
Lück, G.: Handbuch der naturwissenschaftlichen Bildung. Theorie und Praxis für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Freiburg, Basel, Wien: Herder 2003
Plowden, B. (Hrsg.): Children and Their Primary Schools. London 1967
Sodian, B.: Entwicklung begrifflichen Wissens. In: Oerter, R./ Montada, L. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz/PVU, 5. Aufl. 2002, S. 443-468
Textor, M.R.: Kooperation mit den Eltern. Erziehungspartnerschaft von Familie und Kindertagesstätte. München: Don Bosco Verlag 2000
Textor, M.R.: Projektarbeit im Kindergarten: Planung, Durchführung, Nachbereitung. Freiburg: Herder, 9. Aufl. 2004
Thalmann, H.-C.: Den Schulalltag bestehen. Psychohygiene des Lehrerberufs. Freiburg: Herder 1978
Tietze, W. (Hrsg.): Wie gut sind unsere Kindergärten? Eine Untersuchung zur pädagogischen Qualität in deutschen Kindergärten. Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand Verlag 1998
U.S. General Accounting Office: Early childhood centers: Services to prepare children for school often limited. GAO/HEHS-95-21. Washington: Selbstverlag 1995
Workman, S.H./Gage, J.A.: Family-school partnerships: A family strengths approach. Young Children 1997, 52 (4), S. 10-14