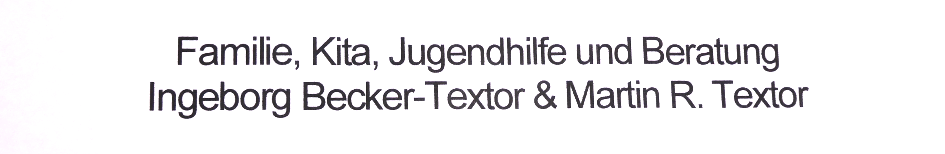Beratung von Eltern behinderter Kinder
Martin R. Textor
Eltern mit behinderten oder chronisch kranken Kindern können vielfältige Beratungsbedürfnisse haben: Zum Zeitpunkt der Diagnose - und in den ersten Jahren danach - gebrauchen sie Unterstützung bei der Verarbeitung der dadurch geweckten Gefühle. Ferner benötigen sie Informationen über die jeweilige Behinderung bzw. chronische Krankheit, die Prognose, den richtigen Umgang mit ihrem Kind sowie über Behandlungs- und Fördermöglichkeiten in der Familie und durch besondere medizinisch-therapeutische oder psychosoziale Dienste. Im Verlauf der Zeit können dann Probleme wie z.B. Anpassungsstörungen der Eltern, Verhaltensauffälligkeiten des behinderten Kindes, Erziehungsschwierigkeiten (auch bei seinen Geschwistern) oder Konflikte zwischen den Eltern auftreten, die eine Erziehungs- bzw. Familienberatung indizieren. Dabei gilt es, sowohl das einzelne Familienmitglied als auch das gesamte Familiensystem einschließlich seiner Einbettung in eine bestimmte Alltagswirklichkeit und soziokulturelle Umwelt zu berücksichtigen.
In diesem Kontext werden schon seit langem folgende Probleme thematisiert (z.B. Speck 1996, Thurmair/ Naggl 2000; Weiß 1989):
- Bei Behinderungen und chronischen Krankheiten werden viele Spezialisten tätig, die einen bestimmten Fachjargon benutzen. Die von ihnen benutzen Begriffe sind den Eltern oft fremd und bleiben manchmal sogar nach ihrer Erklärung unverständlich. So führen verschiedene "Sprachcodes" häufig zu einer gewissen Distanz zwischen Fachleuten und Eltern, die eine Beratung erschweren.
- Diese Distanz wird vielfach noch dadurch vergrößert, dass die Spezialisten sich den Eltern überlegen fühlen und in diesen "Laien" Hilfs- und Beratungsbedürftige sehen, die (noch) nicht richtig mit ihrem Kind umgehen: "Das professionelle System geht von seiner überlegenen Position aus. Diese wird insbesondere von ihrer wissenschaftlichen Fundierung, aber auch von der internen Kompliziertheit und externen Undurchschaubarkeit ihres Apparates bestimmt. Demgegenüber befinden sich die Eltern als Vertreter des Kleinsystems 'Familie' in einer prinzipiell schwächeren Position. In dem Maß, in dem sie sich dem anderen System ausliefern, verlieren sie an selbstbestimmter Erziehungspotenz" (Speck 1996, S. 486 f.).
- Oft werden die Eltern in die Behandlung und Förderung eines behinderten Kindes eingebunden, müssen also z.B. mit ihm zu Hause bestimmte Übungen machen. Sie werden dadurch zu "Kotherapeuten", die von den Therapeuten angeleitet werden. Damit ist ein hierarchisches System verbunden, das einer Beratungsbeziehung zwischen zwei gleichwertigen Menschen entgegen steht. Ferner kann eine Konkurrenzsituation entstehen, wenn Spezialisten und Eltern miteinander wetteifern, wer das jeweilige Kind am besten fördern und seine Bedürfnisse befriedigen kann. Außerdem entsteht ein Konfliktpotenzial, wenn sich das jeweilige Kind nicht so entwickelt wie prognostiziert und die Eltern offen oder verdeckt dafür verantwortlich gemacht werden: Sie hätten wohl zu wenig mit dem Kind geübt...
- Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an allen Kindern eines Jahrgangs steigt kontinuierlich an. Somit dürften auch immer mehr behinderte oder chronisch kranke Kinder zu dieser Gruppe gehören. Berater werden hier nicht nur mit Sprachproblemen konfrontiert, sondern auch mit verschiedenen Milieus (Merkle/ Wippermann 2008), die sich in den kommenden Jahren noch weiter ausdifferenzieren dürften. Sie treffen hier auf unterschiedliche Geschlechtsrollenleitbilder, Familienstrukturen, Einkommensverhältnisse, Lebensweisen, Werte, Bildungsziele, Erziehungsstile usw., die ihnen weitgehend unbekannt sind. Dies dürfte die Beratung erschweren.
Offensichtlich ist, dass diese Probleme in unterschiedlichem Ausmaße auftreten, je nachdem ob die Beratung im Krankenhaus, in einer Frühförderstelle, in einer Förderschule, in einem Heim oder in einer Erziehungs- bzw. Familienberatungsstelle erfolgt. So könnte es z.B. manchmal sinnvoll sein, Beratungsangebote aus einem medizinisch-therapeutischen Kontext auszugliedern.
Eine erfolgversprechende Beratung setzt also voraus, dass die Berater eine gleichberechtigte Beziehung zu den Eltern herstellen, diese als gleichwertig behandeln, sich mit ihnen in einer allgemein verständlichen Sprache austauschen und die Besonderheiten des jeweiligen Familien- bzw. Migrantenmilieus berücksichtigen. Vor allem aber müssen sie anerkennen, dass die Elternrealität eine andere als die Spezialistenrealität ist: "Die häusliche Wirklichkeit ist unendlich vielfältiger bedingt und von einer Fülle und einer zeitlichen Konsistenz bestimmt, die von der ausschnitthaften therapeutischen Situation nicht eingeholt werden kann. Sie ist auch von einer anderen Qualität, weil sie viel stärker subjektiv und emotional bzw. von Beziehungen (Betroffenheit) bestimmt wird und daher unmittelbarer ganzheitlich wirkt" (Speck 1996, S. 489). Wenn Eltern als Experten für ihre Familie und ihr behindertes bzw. chronisch krankes Kind wahrgenommen und akzeptiert werden, begegnen sie dem Berater als Experten für therapeutische, heilpädagogische bzw. psychologische Fragen auf der gleichen Ebene.
Beratung während des Bewältigungsprozesses
Je nach Art der Behinderung bzw. chronischen Krankheit erfolgt die Diagnose ganz plötzlich oder nach einer längeren Phase, in der sich der Zustand des Kindes verschlechtert hat oder immer mehr Beeinträchtigungen beobachtet wurden. "Als Zeitpunkt der Erstdiagnose geben Eltern von Kindern mit Down-Syndrom etwa die ersten Tage nach der Geburt an. Bei mehrfachbehinderten Kindern erfolgte die Diagnose im Schnitt nach 7.0 Monaten, bei körperbehinderten Kindern mit 9.7 Monaten und bei geistigbehinderten Kindern mit 15.6 Monaten (...). Diese Durchschnittswerte spiegeln die erhebliche individuelle Streubreite nicht wider. Über ein Drittel der Kinder mit geistiger Behinderung werden erst nach dem zweiten, davon etwa 5% erst nach dem vierten Lebensjahr diagnostiziert" (Krause 2002, S. 18 f.).
Die meisten Eltern reagieren auf die Diagnose zunächst mit einem Schock. Sie empfinden einen starken Schmerz oder eine große innere Leere. Manche sind enttäuscht und wütend. Viele Eltern leugnen die Diagnose zunächst und konsultieren weitere Ärzte, später auch andere Professionen, in Einzelfällen sogar "Wunderheiler". Sie haben auch lange die Hoffnung, man könne die Behinderung bzw. chronische Krankheit "wegtherapieren", wenn man nur intensiv genug mit dem Kind arbeite und alle externen Behandlungs- bzw. Förderangebote nutze.
Erkennen Eltern mit der Zeit die Grenzen therapeutischer Maßnahmen, resignieren sie oft. Sie ergeben sich in ihr Schicksal, sind verbittert oder deprimiert. Nach einem mehr oder minder langen Zeitraum akzeptieren Eltern die Diagnose und nehmen ihr Kind so an, wie es ist. Sie gehen immer offener mit der Tatsache der Behinderung ihres Kindes um - auch gegenüber ihnen unbekannten Menschen. Viele schließen dann den Trauerprozess ab; andere leiden ihr ganzes Leben darunter, ein behindertes Kind zu haben. Das Familiensystem und das Verhalten der einzelnen Familienmitglieder werden immer besser an die Bedürfnisse und Bedarfe des behinderten bzw. chronisch kranken Kindes angepasst.
Kommt es direkt in Anschluss an die Diagnose zu einer psychologischen Beratung, so gilt es, zunächst einmal den Eltern einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie offen über den Schock und ihre Gefühle sprechen - und auch weinen - können: "Zunächst sollte Verständnis ... zum Ausdruck gebracht und dem Betroffenen gestattet werden, sich so zu zeigen, wie ihm jetzt im Moment zu Mute ist - man gibt ihm also zu verstehen, dass man ihn in seinem 'So-Sein' annimmt. Trost kann es in dieser Phase ohnehin noch nicht geben" (Strobel 2005, S. 173). Die Berater akzeptieren alle Emotionen unbedingt. Dies gilt auch für Reaktionen wie Abwehr und Ambivalenz.
In der Folgezeit gilt es, Eltern bei der Bewältigung neuer Anforderungen zu unterstützen: Sie müssen lernen, wie man mit einem behinderten bzw. chronisch kranken Kind umgeht, wie man es pflegt, behandelt, erzieht und fördert. "Die fachliche Beratung macht den Eltern Wissen und Erfahrung zugänglich, die sie selbst nicht haben. Sie informiert, leitet an, macht vor, demonstriert, bespricht Fragen der kindlichen Entwicklung und der Lebensperspektiven des Kindes und hilft auch den Eltern besser zu verstehen, was mit ihrem Kind ist und warum es sich so und nicht anders verhält" (Thurmair/ Naggl 2000, S. 181). Die Eltern werden über Entwicklungschancen und -besonderheiten ihres Kindes unterrichtet, erfahren Anleitung bei Alltagsaktivitäten (An-/Ausziehen, Füttern usw.) und erlernen den Umgang mit behinderungsspezifischen Besonderheiten (z.B. die Kommunikation mit hörgeschädigten Kindern, das richtige Reagieren auf die Signale schwerbehinderter Kinder, das Fördern eines Schlafrhythmus bei blinden Kindern, das Ertragen der für Eltern besonders schmerzlichen Kontaktabwehr bei autistischen Kindern).
Während die fachliche Beratung den jeweiligen Spezialisten an Kliniken, Frühförderstellen und anderen medizinisch-therapeutischen Diensten überlassen werden sollte, können psychische und soziale Probleme oft besser von Psychologen und Sozialarbeitern geklärt werden. Diese können sich z.B. aus den Reaktionen von Geschwistern oder Großeltern, aus der Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten oder aus dem Verhalten von Behörden und Versicherungen ergeben. Manchmal müssen auch externe Hilfen wie z.B. mobile pflegerische Dienste vermittelt oder Eltern auf Selbsthilfegruppen und Verbände aufmerksam gemacht werden, in denen sie sich mit Eltern in der gleichen Lage austauschen und wechselseitig unterstützen können.
Besonders wichtig ist, dass den Eltern im Rahmen der Beratung die Trauerarbeit erleichtert wird. Sie können darüber sprechen, was es für sie bedeutet, ein behindertes Kind zu haben, und wie dies ihre ganze Zukunftsplanung und ihren Lebensstil verändert hat. Die Berater unterstützen sie dabei, sich verdrängten Gefühlen zu stellen, sich der eigenen Enttäuschung zu nähern und Idealvorstellungen loszulassen. Sie definieren Trauerarbeit als einen normalen Prozess, der nicht in allen Fällen abgeschlossen werden kann.
Beratung bei später auftretenden Problemen
Wie in anderen Familien können auch in Familien mit behinderten bzw. chronisch kranken Kindern Erziehungsschwierigkeiten auftreten. Diese können aus behinderungsspezifischen Besonderheiten (z.B. bei autistischen Kindern), aus einem problematischen Erziehungsverhalten (Überbehütung, Verwöhnung, Vernachlässigung, Misshandlung usw.) oder aus allgemeinen Verhaltensauffälligkeiten (Aggressivität, Ängstlichkeit, Kontaktschwäche usw.) resultieren, die ein Kind beispielsweise aufgrund von Frustrationserfahrungen (weil es nicht dasselbe wie Gleichaltrige kann) oder von Diskriminierung entwickelt hat.
Eine Erziehungsberatung kann aber auch aufgrund des Verhaltens nicht behinderter Geschwister notwendig sein. Diese fühlen sich oftmals vernachlässigt (wenn die Eltern den größten Teil ihrer Zeit und Energie dem behinderten bzw. chronisch kranken Kind widmen) oder überfordert (wenn sie intensiv an der Pflege und Betreuung desselben beteiligt werden). So benötigen sie laut Hackenberg (2008)
- Zeiten der ungeteilten Aufmerksamkeit ihrer Eltern und Erklärungen, wieso diese seltener als beim behinderten Kind sind,
- eine ausdrückliche Wertschätzung ihrer Person und nicht nur ihrer Funktion als Helfer sowie
- Anerkennung ihres Engagements für ihr behindertes Geschwister und gleichzeitig Freiräume für eigene Interessen bzw. soziale Kontakte.
Manche Geschwister gebrauchen auch Unterstützung beim Aufbau einer positiven Beziehung zum behinderten Kind. Dazu gehören auch eindeutige und altersgemäße Informationen über die jeweilige Behinderung bzw. chronische Krankheit und deren Auswirkungen: "Geschwister gewinnen an persönlicher Sicherheit, wenn sie Hinweise erhalten, wie sie mit bestimmten Verhaltensschwierigkeiten des behinderten Kindes umgehen können, wie sie anderen Kindern sein Verhalten erklären können oder was sie auf diskriminierende Bemerkungen in der Öffentlichkeit antworten sollten. Hierzu gehört auch, dass die Geschwister sich angemessen gegen Angriffe und Übergriffe des behinderten Kindes wehren dürfen" (Hackenberg 2008, S. 130).
Oftmals benötigen Eltern eine Beratung für sich selbst: Manche wollen über ihre Alltagsprobleme und Belastungen durch das behinderte bzw. chronisch kranke Kind sprechen. Hier können Berater nicht nur Verständnis und Empathie zeigen, sondern auch relevante Hilfsangebote psychosozialer Dienste vermitteln. Andere Eltern möchten problematische Gefühle gegenüber dem behinderten Kind wie Ablehnung oder Wut sowie die damit verbundenen Gewissensbisse ansprechen. Ihnen kann verdeutlicht werden, dass auch solche Emotionen "normal" und als Zeichen ihres Leidens akzeptabel sind, sofern sie nicht zu einem unangemessenen Verhalten gegenüber dem Kind führen. Wieder andere Eltern wollen über ihre privaten Sorgen und Zukunftsängste sprechen. Ihnen muss die Zuversicht vermittelt werden, dass sie auch Herausforderungen wie die Einschulung, die Pubertät oder das sexuelle Verhalten ihres behinderten Kindes bewältigen können. Auch kann mit ihnen besprochen werden, wie ihr Kind als Erwachsener leben und wer später einmal als Vormund fungieren könnte.
In Einzelfällen muss im Rahmen der Beratung auch auf
- Paarkonflikte (z.B. wegen des unterschiedlichen Engagements der Eltern bei der Pflege und Betreuung des behinderten Kindes, wegen Vernachlässigung der Paarbeziehung oder wenn ein Partner dem anderen die Schuld für die Behinderung zuschreibt),
- psychische Probleme eines Elternteils (Depressivität, Albträume, Ängste, Panikattacken, emotionale Stumpfheit, Teilnahmslosigkeit, Suizidgedanken, Suchtmittelmissbrauch usw.) oder
- Anpassungsstörungen (keine Routine bei alltäglichen Aufgaben, Überforderung, Aggressionsneigung, Selbstisolation der Familie usw.)
eingegangen werden. In solchen Fällen ist oft eine Psychotherapie indiziert.
Entsprechend des Konzepts des Empowerment gilt es immer, die Kompetenzen, Stärken und Ressourcen der Familien behinderter und chronisch kranker Kinder ausfindig zu machen. Nur wenn sich die Familienmitglieder ihrer bewusst werden, können sie sie auch nutzen. Zudem gewinnen sie an Selbstvertrauen und Zuversicht. Familien, die ihre Lebenssituation erfolgreich bewältigt haben, können dann in Selbsthilfegruppen und Verbänden zum Vorbild für andere werden: "In wissenschaftlich begleiteten 'Eltern-helfen-Eltern-Programmen' wurde festgestellt, dass Eltern, die den persönlichen Gewinn durch ihr behindertes Kind als hoch einschätzen und die über effektive Bewältigungsstrategien verfügen, eine wichtige Ressource für stärker belastete Familien darstellen können" (Hackenberg 2008, S. 68).
Literatur
Hackenberg, W.: Geschwister von Menschen mit Behinderung. Entwicklung, Risiken, Chancen. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag 2008
Krause, M.P.: Gesprächspsychotherapie und Beratung mit Eltern behinderter Kinder. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag 2002
Merkle, T./Wippermann, C.: Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in verschiedenen Lebenswelten. Stuttgart: Lucius & Lucius 2008
Speck, O.: System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 3. Aufl. 1996
Strobel, B.U.M.: Heilpädagogik für ErzieherInnen. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag 2005
Thurmair, M./Naggl, M.: Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag 2000
Weiß, H.: Familie und Frühförderung. Analysen und Perspektiven der Zusammenarbeit mit Eltern entwicklungsgefährdeter Kinder. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag 1989