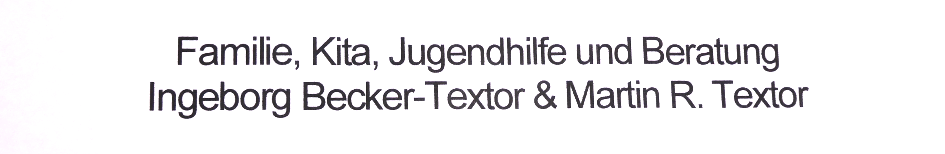Professionelle Mütter zwischen Mutterbildern und wissenschaftlichen Ansprüchen
Martin R. Textor
Seit mehr als 10 Jahren setze ich mich für die Weiterqualifizierung von Adoptiv- und Pflegeeltern ein - eine Zielgruppe, die in mancherlei Hinsicht vergleichbar mit Kinderdorf-Müttern ist. Die Überschneidungen sind besonders groß, wenn Pflegeeltern mehrere Kinder, z.B. in einem "Pflegenest", betreuen. Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit diesem Themenkreis war ein Forschungsprojekt über offene Adoptionsformen. Im Anschluss daran führte ich im Freistaat Bayern eine Befragung aller Adoptionsvermittler/innen und etwas später eine Untersuchung aller im Jahr 1990 abgeschlossenen Adoptionen durch. Während dieser Zeit arbeitete ich mehrere Jahre lang mit einer Gruppe von Adoptiveltern und Adoptionsbewerbern, mit der ich mich einmal pro Woche traf. Auch führte ich zusammen mit meiner Frau mehrere Wochenendfreizeiten durch. Die Gruppe besteht immer noch; sie trifft sich nun mit einer Psychologin. Viele meiner in dieser Zeit gesammelten Erkenntnisse befinden sich in dem Sammelband "Adoption", den ich zusammen mit Prof. Hoksbergen herausgab.
Mitte der 90er Jahre begann ich, mich intensiver mit Pflegefamilien zu befassen. Beispielsweise führte ich 1995 eine Umfrage zur Qualifikation von Pflegeeltern durch. Der Fragebogen wurde in der Zeitschrift KINDESWOHL des Bundesverbandes der Pflege- und Adoptiveltern Deutschlands abgedruckt. Allerdings war der Rücklauf sehr gering: Nur 92 Pflegeeltern sowie 13 Adoptiv- und Pflegeeltern beteiligten sich.
Als übliche Form der Vorbereitung von Pflegefamilien erwiesen sich Gespräche mit der Fachkraft des Pflegekinderdienstes im Büro, vereinzelt auch in der Wohnung der Befragten: 89% der gesamten Stichprobe berichteten von dieser Art der Vorbereitung. Ansonsten zeigte sich, dass bei Inpflegegaben ab 1991 häufiger weitere Formen eingesetzt wurden: 26% der Pflegeeltern berichteten von Vorbereitungsseminare, 22% hatten eine Literaturliste sowie 36% schriftliche Materialien erhalten; 25% wurden in Kontakt mit erfahrenen Pflegeeltern gebracht (Inpflegenahme ab 1991). Selbst wenn mehrere Formen der Vorbereitung auf die Pflegeelternschaft eingesetzt werden, ist aber nicht gesagt, dass alle relevanten Themen abgehandelt werden. So fühlten sich nur 57% der Pflegeeltern über die Problematik der Beziehung zur Herkunftsfamilie des Kindes ausreichend aufgeklärt. Und jeweils mehr als die Hälfte der Befragten vermissten Informationen über die kindliche Entwicklung, über Verhaltensauffälligkeiten bzw. Behinderungen, über Probleme in der Eingewöhnungsphase, über die Problematik der doppelten Elternschaft und über die Aufgaben der Jugendämter. Am seltensten fühlten sich die Pflegeeltern über die mit der Rückführung eines Pflegekindes verbundenen Gefühle und die Probleme leiblicher Kinder bei Aufnahme eines Pflegekindes ausreichend informiert.
Vor der Aufnahme des zuletzt in ihrer Familie platzierten Pflegekindes führten 27% der Pflegeeltern ein Gespräch mit dem zuständigen Sozialarbeiter, 44% zwei oder drei, 13% vier oder fünf und 8% sechs oder mehr Gespräche. Kontakte zwischen Pflegeeltern und zukünftigem Pflegekind wurden in mehr als der Hälfte der Fälle angebahnt. In 49% der Fälle kam es zu Treffen mit dem Kind in Anwesenheit des Sozialarbeiters, in 32% der Fälle übernachtete das Pflegekind vorab bei seinen zukünftigen Pflegeeltern. Von mehrtägigen Aufenthalten wurde von 24% der Pflegeeltern berichtet. Allerdings fanden bis zu 56% der Pflegeeltern, dass sie z.B. über folgende Punkte hinsichtlich der Herkunft ihres Pflegekindes nicht informiert wurden: Entwicklung im Säuglings- bzw. Kleinkindalter, traumatische Erfahrungen in der Herkunftsfamilie, Beziehung zu den leiblichen Eltern bzw. Geschwistern, Gesundheit/Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, Intelligenz, Sozialverhalten, Stärken und Schwächen. Als "gut informiert" erlebten sich maximal 26%. Ähnliches galt für Informationen über die Herkunftsfamilie des Kindes: Zwischen einem Fünftel und der Hälfte der Pflegeeltern fühlten sich über vorgegebene Charakteristika wie Bildung, psychischer Zustand, Belastungen, Erziehungsverhalten oder Partnerbeziehung der leiblichen Eltern nicht informiert. Nur hinsichtlich der Gründe für die Inpflegegabe und der Familienverhältnisse bezeichnete sich mindestens ein Viertel der Befragten als gut informiert.
Alle Befragungsergebnisse zur Bewertung der Fachdienste und ihrer Mitarbeiter/innen machen deutlich, dass die Vorbereitung von Pflegeeltern zu wünschen übrig lassen. Werden aufgrund des Kostendrucks im Sozialbereich noch verhaltensauffälligere Kinder in Familienpflege gegeben, dürfte es m.E. noch häufiger zur Überforderung und damit auch zu vielen Pflegestellenabbrüchen kommen. Deshalb fordere ich weiterhin eine Verbesserung der Qualifizierung von Pflegeeltern. Zu diesem Zweck habe ich zusammen mit Herrn Prof. Warndorf ein Handbuch "Familienpflege" im Lambertus Verlag veröffentlicht.
Eine gute Vorbereitung ist natürlich noch wichtiger für SOS-Kinderdorf-Mütter und Fachkräfte in Kinderwohngruppen, da sie nicht nur mit ein oder zwei Pflegekindern, sondern mit einer ganzen Gruppe oft verhaltensauffälliger Kinder konfrontiert werden. In meinem Referat möchte ich nun auf zwei Aspekte der Qualifizierung von SOS-Kinderdorf-Müttern, aber auch von Pflegemüttern, eingehen: Zum einen beinhaltet die Bezeichnung in beiden Fällen den Begriff "Mutter". Dies impliziert, dass sich sowohl SOS-Kinderdorf-Mütter als auch Pflegemütter an der Mutterrolle orientieren bzw. orientieren sollen. Allerdings sind die Erwartungen an eine Mutter in unserer Gesellschaft sehr widersprüchlich. So werde ich in den folgenden Abschnitten meines Artikels auf die verschiedenen Mutterbilder eingehen. Zum anderen handelt es sich bei Pflegemüttern und SOS-Kinderdorf-Müttern um Personen, die im Auftrag von Behörden und weitgehend mit staatlicher Finanzierung eine Jugendhilfe-Maßnahme durchführen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich im Umgang mit den ihnen anvertrauten Kindern nicht von so etwas "Obskuren" wie "Mutterliebe" oder "mütterlichen Instinkten" leiten lassen, sondern von Fachwissen. Sie sollen also Professionelle sein, wobei diese Forderung natürlich SOS-Kinderdorf-Mütter stärker als Pflegemütter betrifft.
Mutterschaft - Leben mit Widersprüchen
Mutterschaft dient der biologischen und der soziokulturellen Reproduktion; sie beinhaltet sowohl das Gebären und physische Versorgen als auch die Erziehung und Bildung von Kindern. Das bedeutet, dass Mutterschaft einerseits biologische und andererseits gesellschaftliche bzw. kulturelle Aspekte umfasst. Zu Letzteren gehören Vorstellungen in der Form von Leitbildern, wie Mutterschaft zu verstehen und zu leben ist. Bedenkt man, dass wir in einer pluralistischen, postmodernen Gesellschaft leben, so überrascht nicht, dass es heute mehrere miteinander konkurrierende Idealbilder gibt. Einige von ihnen sollen im Folgenden dargestellt und kritisch reflektiert werden.
Das traditionelle Mutterideal
Das "traditionelle" Mutterbild erlebte seine Blütezeit in den 50er und frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, wird aber heute noch immer in konservativen Bevölkerungsgruppen vertreten. Alle Frauen sollen Mütter werden, da Mutterschaft als ihre Lebenserfüllung und als "Essenz" ihrer Weiblichkeit gesehen wird. Aus ihr würden sie eine tiefe Befriedigung gewinnen: Mutterschaft sei eine ganz und gar positive Erfahrung.
Mütter sollten laut dem traditionellen Leitbild verheiratet sein und ihren Beruf zugunsten ihrer Kinder aufgegeben haben, also Hausfrauen sein. Sie sind nahezu ausschließlich für die Erziehung, Versorgung und Betreuung der Kinder zuständig, da sie hierfür am besten geeignet seien: Sie wären von Natur aus liebevoll, selbstlos, fürsorglich, treusorgend, empathisch, zärtlich, emotional, aufopferungsbereit, familienorientiert usw. So wäre es ganz "normal" und selbstverständlich, wenn sie sich intensiv um ihre Kinder kümmern. Zudem benötigen Säuglinge und Kleinkinder für eine gesunde Entwicklung die totale Präsenz ihrer Mütter - wofür z. B. die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Hospitalismusforschung, der Bindungstheorie und klassischen Psychoanalyse sprechen. Sie könnten sich nur positiv entwickeln, wenn Mütter ihren Bedürfnissen die höchste Priorität einräumen, sich ihnen anpassen und sich emotional stark für sie engagieren. Vor allem müssten Mütter ihre Entwicklung in allen Bereichen konsequent, kontinuierlich und intensiv fördern. Außerdem sind sie für die Reproduktion der liberalen Demokratie und der (westlichen) Kultur verantwortlich.
Das traditionelle Mutterideal negiert weitestgehend die Bedeutung des Vaters. Dies ist selbst dann unverständlich, wenn man von dieser Sichtweise aus argumentiert. So macht z.B. Laub (1992) hinsichtlich von Familien mit Kleinstkindern auf Folgendes aufmerksam: "Die permanente Unterstützung der Mutter durch den Vater als eine Conditio sine qua non für das Gelingen ihrer Aufgabe ist weder bei den Betroffenen noch in Fachpublikationen vermerkt. In Folge der hohen Isolation der Kleinfamilie stünde dem Vater die Aufgabe zu, der Mutter-Kind-Dyade jenen notwendigen emotionalen Rückhalt und Schutz zu vermitteln, der der Mutter die Teilregression, die ihr den adäquaten Kontakt mit ihrem Baby psychisch (und physisch!) überhaupt erst erlaubt", ermöglicht (S. 7). Noch weniger verständlich ist die Negierung der Bedeutung von Vaterschaft im Lichte der seit den 70er Jahren gesammelten Forschungsergebnisse, die den großen Einfluss von Vätern auf die kindliche Entwicklung belegen (vgl. z. B. Fthenakis 1988). Anzumerken ist, dass aber auch andere, z. B. von außen kommende Einflüsse (seitens der Gleichaltrigengruppe, Schule, Medien usw.) ignoriert werden - die gesamte Verantwortung für die Entwicklung der Kinder wird den Müttern aufgebürdet.
Obwohl der Kindererziehung von der Gesellschaft eine große Bedeutung beigemessen wird, haben Mütter nur einen niedrigen Status - schließlich verdienen sie kein Geld, machen sie keinen Profit, haben sie keine Untergebenen. Vor allem aber wird am traditionellen Mutterbild kritisiert, dass eine so verstandene Mutterschaft zur patriarchalischen Struktur des Familienlebens und der Gesellschaft beitrage: Mütter hätten zu Hause zu bleiben und dort ihre Identität, Selbstbestätigung und Zufriedenheit zu finden - und nicht im Beruf oder gar in einem politischen Engagement.
Ferner erschwert das "rosige" Bild von Mutterschaft, dass sich Frauen die mit der Mutterrolle verbundenen negativen Gefühle wie Zorn, Widerwillen, Depressivität u. Ä., ihre Belastung, Erschöpfung, Isolation, Frustration, mangelnde Erfüllung usw. eingestehen. Zugleich birgt die Vorstellung von der "Natürlichkeit" des "Bemutterns" die Gefahr, die großen physischen und psychischen Leistungen und Belastungen von Müttern zu übersehen. Außerdem könnten die extrem hohen gesellschaftlichen Erwartungen an die Kindererziehung von vielen Frauen nicht erfüllt werden, sodass sie unter Selbstzweifel, Versagensängsten und Schuldgefühlen litten. Schließlich würde die Betonung einer sehr engen, "symbiotischen" Bindung zwischen Mutter und Säugling bzw. Kleinkind verneinen, dass beide Personen separate, eigenständige, selbstbestimmte und handelnde Wesen seien (Glenn 1994).
Das traditionelle Mutterideal wird z. B. von Hays (1998) als "historisch konstruierte Ideologie" bezeichnet. Es wurde aus der Situation bürgerlicher Familien abgeleitet, wie sie vor allem in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bestand. Dieses Mutterbild trägt zu einer negativen Sicht von erwerbstätigen Müttern, Alleinerziehenden, Stiefmüttern usw. bei - was verdeutlicht, dass es in einen moralischen Kontext eingebettet und mit "moralisierenden" Werthaltungen verbunden ist (Woodward 1997). Zugleich ist es mit der Ablehnung der Fremdbetreuung von Unter-Drei-Jährigen verknüpft. Noch heute wird das traditionelle Mutterideal von konservativen Bürgerinnen und Bürgern vertreten, streben viele Mütter danach, diesem Verhaltensmodell zu entsprechen.
Die Madonna
Dieses Mutterbild hat seine Wurzeln im Christentum: Die ideale Frau ist - analog zur Jungfrau Maria - Mutter und asexuell. Diese Vorstellung ist auch heute noch weit verbreitet, wie z. B. zwei Untersuchungen von Friedman, Weinberg und Pines (1998) zeigten. Diese Wissenschaftler befragten mehr als 300 Israelis und stellten fest, dass eine Frau umso eher als eine gute, sorgende und engagierte Mutter erlebt wird, je weniger sie als sexuell aktiv beschrieben wurde. Schon die Information, dass sie gerne Lust empfindet und ihren Mann befriedigt, reichte den Befragten aus, um ihr als Mutter negative Eigenschaften anzudichten: Eine solche Frau würde nicht viel in ihre Kinder investieren, sich wenig um deren alltäglichen Bedürfnisse kümmern und sie oft als Bürde sehen.
Nach Auffassung von Friedman, Weinberg und Pines (a.a.O.) würden hier tief verwurzelte, weitgehend unbewusste Stereotype und Einstellungen offenbar: "Die Ergebnisse der jetzigen Studie belegen eindeutig die Existenz einer Aufspaltung von Mutterschaft und Sexualität. Sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Analysen stimmen darin überein, dass in der Wahrnehmung von Frauen Sexualität und Mutterschaft einander ausschließen. Je sexueller eine Frau ist, umso weniger mütterlich wird sie wahrgenommen" (S. 796).
Der Gegenentwurf: die berufstätige kinderlose Frau
Vor allem im "frühen" Feminismus der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde ein Frauenbild vertreten, das als Gegenentwurf zum traditionellen Stereotyp der idealen Mutter verstanden werden kann: Anstatt dass ihr Verhalten durch die Logik uneigennütziger Fürsorge geprägt wird, folgt die moderne Frau der in den weitaus meisten Lebensbereichen vorherrschenden Logik eigennützigen Profitstrebens - d.h., sie trachtet nach einer guten Schul- und Berufsbildung, ist voll erwerbstätig und karriereorientiert, strebt nach Selbstverwirklichung im Beruf und entspricht somit dem Paradigma des homo oeconomicus. Ein (Ehe-)Mann wird nur akzeptiert, wenn er für eine partnerschaftliche Beziehung und eine gerechte Aufteilung der Hausarbeit ist; auf Kinder wird verzichtet, wenn sie dem eigenen Streben nach beruflichem Erfolg, Macht und Prestige entgegenstehen.
Dieses Idealbild der erwerbstätigen, erfolgreichen, finanziell unabhängigen Frau wird heute vor allem durch Frauenmagazine weiter verbreitet. In ihnen findet man überwiegend Reportagen und Fotos von gut gekleideten, perfekt gestylten Frauen, die sexuell attraktiv und glücklich wirken. Über Mutterschaft wird hingegen selten berichtet; Kinder tauchen kaum auf den Fotos auf.
Die Supermutter
Dieses Idealbild wird ebenfalls von Medien und feministischen Gruppierungen verbreitet: Frauen sollen - und könnten - attraktive Sexualpartnerinnen, erfolgreiche Berufstätige, perfekte Hausfrauen und gute Mütter sein. Als "Beziehungsexpertinnen" sichern sie eine befriedigende Partnerschaft mit ihrem Mann und entwicklungsfördernde Eltern-Kind-Beziehungen, ohne dass die eigene Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsintegration zu kurz kommen. Und trotz ihrer Vollerwerbstätigkeit erbringen sie einen enormen Aufwand an Zeit und Energie für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder. Hays (1998) fasst das Leitbild der Supermutter etwas überspitzt zusammen: "Mühelos schafft sie den Spagat zwischen Heim und Arbeit. Diese Mutter kann mit der einen Hand einen Kinderwagen schieben und mit der anderen die Aktentasche tragen. Sie ist immer gut frisiert, ihre Strumpfhosen haben nie Laufmaschen, ihr Kostüm ist stets frei von Knitterfalten, und ihr Heim ist natürlich blitzsauber. Ihre Kinder sind makellos: Sie haben gute Manieren, sind aber nicht passiv, sondern putzmunter und strotzen vor Selbstbewusstsein" (S. 174f.).
Es ist offensichtlich, dass dieses Leitbild mit einer enormen Überforderung von Frauen verbunden ist - mit Mehrfachbelastung, Zeitdruck und Stress. Viele scheitern an dem Versuch, sowohl Mutter als auch Karrierefrau und Idealpartnerin zu sein, und erleben sich dann als minderwertige Versager. Obwohl sie ihre Kinder intensiv "bemuttern", bleibt immer das schlechte Gewissen, ob sie diese aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit nicht doch etwas vernachlässigen. Zugleich wird bei diesem Frauenbild die Notwendigkeit von Veränderungen in Familie, Wirtschaft und Gesellschaft ignoriert - z. B. sollten sich analog die Ehemann- und Vaterrolle ändern, müsste die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt werden, sind adäquate Kinderbetreuungsangebote notwendig.
Das Drei-Phasen-Modell
Dieses Leitbild wurde vor allem in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts proklamiert. Hier wurde nach einem Kompromiss gesucht zwischen dem traditionellen Mutterideal und der rasch zunehmenden Frauenerwerbstätigkeit: Junge Frauen sollten nach einer guten Schul- und Berufsausbildung trachten und ihren Beruf so lange ausüben, bis das erste Kind geboren ist (1. Phase). Dann sollten sie sich ausschließlich um Kindererziehung und Haushalt kümmern (2. Phase). Wenn die Kinder sie nicht mehr in hohem Maße gebrauchen würden, könnten die Mütter wieder erwerbstätig werden (3. Phase).
Das Drei-Phasen-Modell wird auch heute noch von vielen Eltern, von (konservativen) Politiker/innen und anderen Meinungsmachern vertreten. Allerdings lässt sich feststellen, dass der Zeitpunkt des Wiedereintritts in die Arbeitswelt immer mehr nach vorne verlegt wird: Während früher viele Frauen bis zur Pubertät oder gar bis zum Jugendalter ihrer Kinder warteten, erfolgt heute der Wiedereinstieg zumeist während der ersten Grundschuljahre oder schon nach dem Kindergarteneintritt. Ein Grund für diese Entwicklung liegt darin, dass aufgrund des raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandels einmal erworbene berufliche Qualifikationen immer schneller veralten und damit ein Wiedereintritt in die Arbeitswelt mit zunehmender Dauer der Familienphase immer schwieriger wird. Auch ermöglicht der Ausbau von (ganztägigen) Kinderbetreuungsangeboten die frühzeitigen Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit.
Die "neuen" Mütter
In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass vor allem Frauen aus der Mittelschicht nach der Geburt eines Kindes bewusst auf die Berufsausübung verzichten, ohne jedoch das traditionelle Mutterbild zu übernehmen: "Wenn sich sogar erfolgreiche Berufsfrauen aus dem Erwerbsleben partiell wieder zurückziehen und zugleich in Familienbeziehungen leben, so muss das nicht gemäß der traditionellen Frauenrolle aus Rücksicht für Mann und Kinder geschehen, sondern kann auch erfolgen, um sich selbst einerseits den Belastungen der Konkurrenz, Vereinzelung und Austauschbarkeit im Beruf zu entziehen (...), und andererseits, um die vorrangig in primären Beziehungen mögliche Befriedigung emotionaler Bedürfnisse und Sicherung der eigenen Identität zu gewinnen" (Herlyn et al. 1993, S. 55).
Diese Mütter folgen in mehr oder minder bewusster Abgrenzung vom Feminismus einem Leitbild, nach dem Individualisierung, Selbstverwirklichung und Personalisation in der Ausübung der Hausfrauen- und Mutterrolle realisierbar sind - und zwar eher als in der fremdbestimmten, rational geprägten und wettbewerbsorientierten Arbeitswelt. Nur in der Familie können Frauen sie selbst sein und ihre eigenen Vorstellungen vom Leben realisieren. Vor allem in der Mutter-(Eltern-)Kind-Beziehung sind Liebe, Fürsorge, Selbstlosigkeit, Uneigennutz u. Ä. lebbar und erlebbar - nur in der Familie kann somit letztlich nach moralischen Prinzipien gelebt werden (vgl. Hays 1998).
Zum Umgang mit verschiedenen Mutterbildern
Eine (werdende) Mutter wird also in unserer Gesellschaft mit mehreren Mutterbildern konfrontiert, die widersprüchlich sind und miteinander konkurrieren. Sie hat somit einerseits die Wahlfreiheit, kann sich also für das eine oder andere Ideal entscheiden, ohne - heute - mit irgendwelchen gesellschaftlichen Sanktionen rechnen zu müssen. Andererseits kann diese Situation zu Desorientierung, Verunsicherung und Ambivalenz führen: Die Frau mag es als sehr schwierig erleben, eine eigene Mutteridentität zu entwickeln.
Aber auch wenn eine Mutter sich (unbewusst) an einem bestimmten Leitbild orientiert, muss sie mit Problemen rechnen - wie zuvor immer wieder angedeutet wurde: mit Problemen wie Isolation und einem niedrigen sozialen Status (als Hausfrau), wie Überforderung (als Erziehende) oder wie Mehrfachbelastung und Stress (als Erwerbstätige). Es ist offensichtlich, dass das Befolgen eines jeden der skizzierten Leitbilder mit ganz spezifischen Chancen und Schwierigkeiten verbunden ist. Und immer bleibt das Gefühl der Unzulänglichkeit - dass man irgendetwas hinsichtlich der eigenen Individuation, der Partnerschaft oder der Kindererziehung versäumt, weil man sich für ein bestimmtes Mutterbild entschieden hat.
Darüber hinaus müssen sich Mütter mit einer Reihe weiterer Paradoxien auseinander setzen, die hier nur beispielhaft angedeutet werden können:
- Als soziale Rolle erfährt Mutterschaft nur wenig gesellschaftliche Wertschätzung; für die Mutter selbst hat sie aber eine sehr große persönliche Bedeutung und moralischen Wert.
- Kindererziehung wird auf der einen Seite als etwas "Instinktives" und "Intuitives" bezeichnet; Mütter wüssten von Natur aus, wie sie sich Kindern gegenüber zu verhalten hätten. Auf der anderen Seite wird eine fachmännische, wissenschaftlich fundierte Anleitung gefordert, veröffentlichen Fachleute Erziehungsratgeber, die hohe Auflagen erreichen und deren Ratschläge von Müttern unwidersprochen übernommen werden (vgl. Marshall 1991).
- Müttern wird einerseits ein großer erzieherischer Einfluss zugesprochen; andererseits gelten Kinder als durch ihr Erbgut und durch die Gesellschaft (Kindergarten, Schule, Gleichaltrigengruppe, Medien usw.) geprägt.
- Viele (Erziehungs-)Probleme von Müttern sind gesellschaftlich bedingt, sollen aber in der Familie gelöst werden. Gelingt dies nicht, werden vor allem die Mütter als unfähig etikettiert.
- Kindererziehung in der Familie ist einerseits Privatsache, unterliegt aber andererseits auch der gesellschaftlichen Kontrolle - wobei vor allem die Mütter (insbesondere aus unterprivilegierten sozialen Gruppen) von Interventionen seitens der Institutionen Schule, Kindergarten, Jugendamt, Polizei usw. betroffen sind.
- Kinder gelten einerseits als Zukunft unserer Gesellschaft. Andererseits erleben aber insbesondere Mütter mit Kleinkindern viel Kinderfeindlichkeit außerhalb der Familie, z. B. in Kaufhäusern oder Restaurants.
- (Klein-)Kinder sollen sich einerseits in der Wohnung frei entfalten können, andererseits soll diese aufgeräumt, ordentlich und sauber wirken.
Besonders problematisch ist aber, dass die in unserer Gesellschaft vorherrschenden Mutterbilder den Blick dafür verstellen, dass es neben den Müttern viele (potentiell) wichtige Bezugs- und Erziehungspersonen für Kinder gibt. Im familialen Bereich können dies neben Vätern auch Großeltern oder ältere Geschwister sein; im außerfamilialen Bereich sind dies Erzieher/innen, Lehrer/innen, Nachbar/innen u.v.a.m. Deren Einbeziehung in ein umfassendes Erziehungs- und Sozialisationskonzept würde Mütter von einer Überbewertung ihrer Rolle sowie von der damit verbundenen Überlastung und anderen negativen Folgen (s.o.) befreien.
Zur besonderen Situation von SOS-Kinderdorf-Müttern und Pflegemüttern
Pflegemütter und insbesondere SOS-Kinderdorf-Mütter werden mit einer noch widersprüchlicheren und verwirrenderen Situation konfrontiert: Obwohl sie als Mütter bezeichnet werden und oft auch so von den ihnen anvertrauten Kindern gesehen werden, sind sie keine leiblichen Mütter. Sie haben die Kinder nicht geboren und sind mit ihnen nicht verwandt. Auch stehen sie nicht in einem anderen, von unserer Gesellschaft als "normal" bezeichneten Verhältnis zu den Kindern, d.h., sie sind weder Stiefmütter noch Adoptivmütter. So kommt letztlich keines der skizzierten Mutterbilder für sie wirklich in Frage - weder das traditionelle Mutterideal noch das Bild der Supermutter, das Drei-Phasen-Modell oder das Leitbild der "neuen Mutter". Höchstens träfe die Vorstellung der Madonna zu - auch bei Pflegemüttern und noch stärker bei SOS-Kinderdorf-Müttern wird die Sexualität abgespalten, gibt es keine Empfängnis und sogar keine Geburt. Und wie bei der Madonna gibt es - zumindest in Teilen der Gesellschaft - eine Erhöhung der Pflegemutterschaft und vor allem der Kinderdorf-Mutterschaft: das Bild von Frauen, die für arme, verlassene, misshandelte, behinderte oder verstoßene Kinder die Mutterrolle übernehmen. Aber auch dieses Mutterideal führt letztlich nicht weiter.
Während Pflegemütter immerhin noch in einer Familie erziehen, ist bei SOS-Kinderdorf-Müttern eher eine Wohnheimsituation gegeben. Beide werden im Gegensatz zu "echten" Müttern für "Mutterschaft" bezahlt - wenn auch nur für Kinderdorf-Mütter "Mutterschaft" ein Beruf ist, da sie ein Gehalt bekommen und sozial abgesichert sind. Für Pflegemütter ist hingegen das Pflegegeld nur ein Zubrot; sie können davon nicht leben, sondern sind wie Hausfrauen auf das Einkommen der Ehemänner angewiesen. In beiden Fällen ist aber die Bezahlung für die erzieherische Tätigkeit ein entscheidender Unterschied gegenüber der "normalen Mutterschaft".
Während schon die gesellschaftlichen Erwartungen an "echte" Mütter sehr hoch sind, so sind - wie schon angedeutet - die Anforderungen an Pflegemütter und SOS-Kinderdorf-Mütter noch höher. Bei der Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder haben in der Regel die leiblichen Eltern versagt; die Ersatzmütter sollen es nun besser machen. Ja, sie sollen nicht nur die Kinder "normal" erziehen, sondern auch die aus der missglückten Sozialisation in der Herkunftsfamilie resultierenden Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und seelischen Behinderungen ausgleichen. Letztlich wird von ihnen erwartet, dass sie Supermütter sind - auf jeden Fall sollen sie viel besser als die leiblichen Mütter sein. Diese spielen aber weiterhin eine große Rolle im psychischen Erleben der Kinder. So entsteht zusätzlich eine Konkurrenzsituation, mit der "normale" Mütter nicht konfrontiert werden, - eine Wettbewerbssituation, die leicht zu Konflikten mit dem jeweiligen Kind oder seinen leiblichen Eltern führen kann.
Im Gegensatz zu leiblichen Müttern ist die gesellschaftliche Kontrolle größer: bei Pflegeeltern durch die Jugendbehörde, bei SOS-Kinderdorf-Müttern durch Jugendbehörde und Kinderdorfleitung. Durch die Präsenz von heilpädagogischen und psychologischen Diensten im Kinderdorf wird zugleich impliziert, dass "mütterliche" Erziehungstätigkeit allein nicht ausreicht: Selbst "Supermütter" bedürfen der Unterstützung durch Therapeuten. Letztlich wissen nur die gut bezahlen Spezialisten, wie eine Frau "richtig" erzieht - siehe die Unmenge an Erziehungsratgebern und Elternzeitschriften, die sich fast immer nur an Mütter wenden. Handelt es sich bei Kinderdorfleitung, Behördenvertretern und Therapeuten auch noch um Männer, so entsteht eine besonders prekäre Situation, da dann leicht der Eindruck "patriarchalischer Strukturen" entsteht.
Hier wird deutlich, dass SOS-Kinderdorf-Mütter und Pflegemütter trotz mancher Unterschiede dennoch Vieles mit "normalen" Müttern gemeinsam haben:
- Die erzieherische Tätigkeit wird als Aufgabe von Frauen festgeschrieben: Es gibt keine SOS-Kinderdorf-Väter; Pflegeväter spielen eine nachgeordnete Rolle, da sie in anderen Berufen voll erwerbstätig sind.
- Ihre Qualifizierung erfolgt auf einem recht niedrigen Niveau, sodass sie in schwierigen Erziehungssituationen auf die Hilfe von Fachleuten angewiesen sind.
- Sie werden seitens der Gesellschaft mit hohen Erwartungen hinsichtlich ihrer erzieherischen Tätigkeit konfrontiert. So kommt es leicht zu Überforderung, Stress und Überlastung. Aufgrund der erfahrenen Weiterqualifizierung fällt es ihnen noch schwerer als leiblichen Müttern, sich selbst Beratungsbedürftigkeit oder gar ein Versagen einzugestehen.
- Insbesondere Pflegemütter haben einen niedrigen sozialen Status und erfahren wenig gesellschaftliche Anerkennung. Auch werden sie für ihre Erziehungstätigkeit schlecht bezahlt.
- Die Ansprüche des eigenen Partners und der leiblichen Kinder müssen mit den Anforderungen durch die anvertrauten Kindern ausbalanciert werden. Hier kommt es leicht zu Mehrfachbelastung und Stress.
Trotz dieser Überschneidungen wird aber deutlich, dass Pflegemütter und insbesondere SOS-Kinderdorf-Mütter letztlich wenig Orientierung bei den tradierten und modernen Mutterbildern finden. Sehen sie sich zu sehr als "Mütter", wird dies bald zu Verwirrung, Verunsicherung, Ambivalenz, Frustration, Unzufriedenheit, psychischen Konflikten u.Ä. führen. Sie sind nun einmal keine leiblichen Mütter, die von der Empfängnis bzw. der Geburt an für ein Kind verantwortlich sind und dieses von Anfang an positiv beeinflussen können. So kann für sie "Ersatzmutterschaft" nicht "Essenz der Weiblichkeit" oder "Lebenserfüllung" sein. Sie haben die Verantwortung für Kinder übernommen, deren biologischen Eltern zumeist noch leben, - die Verantwortung für zumeist in ihrer Entwicklung gestörte Kinder, bei denen das "normale Beziehungsexpertentum" von Frauen, ihre Intuition oder so etwas wie "in ihrer Natur liegende Mütterlichkeit", wie "Mutterliebe" oder "Mutterinstinkte" nicht ausreichen. Deshalb sollten sich Pflegemütter und SOS-Kinderdorf-Mütter insbesondere von den verklärenden und überfordernden Aspekten der Mutterideale distanzieren: Sie sind keine Supermütter oder "Heilsbringer"; sie haben nicht die Alleinverantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder und können sie nicht ohne Weiteres zu glücklichen Menschen machen; sie können ihnen nicht immer nur starke positive Gefühle entgegenbringen, sondern müssen auch negative zulassen.
Pflegemütter und SOS-Kinderdorf-Mütter sollten deshalb eine ihnen eigene, eine ganz besondere Identität entwickeln, die nur zum Teil Aspekte von Mutteridealen enthalten kann. Vorrangig sollte m.E. die Professionalisierung sein: Pflegemütter und insbesondere SOS-Kinderdorf-Mütter leisten Erziehungsarbeit, die mit großen physischen und psychischen Belastungen verbunden ist. Als Arbeitende sollten sie eine Identität als Berufstätige entwickeln und sich an Erwartungen hinsichtlich einer angemessenen Berufsausübung orientieren. Je schwieriger die ihnen anvertrauten Kinder sind und je größer deren Anzahl ist, umso wichtiger wird ihre Professionalisierung.
Pflegefamilien sind nur in Teilaspekten mit "Normalfamilien" vergleichbar. Identifizieren sich Pflegeeltern mit den in unserer Gesellschaft vorherrschenden Familienleitbildern, können demzufolge große Probleme auftreten: Beispielsweise ignorieren sie dann leicht, dass Pflegekinder "Kinder auf Zeit" sind, die laut § 33 SGB VIII letztlich nur so lange in Familienpflege bleiben sollen, bis sich die Verhältnisse in der Herkunftsfamilie verbessert haben. Selbst wenn Pflegekinder bis zur Volljährigkeit oder gar darüber hinaus in der Pflegefamilie bleiben, werden sie nicht zu leiblichen Kindern, werden die Kontakte später immer lockerer.
Bei der Orientierung an den in der Gesellschaft vorherrschenden Familienleitbildern ignorieren Pflegeeltern auch zu oft, dass es noch biologische Eltern gibt, die häufig das Kind lieben - und noch häufiger von diesem geliebt werden. Sie stürzen die Pflegekinder damit in Loyalitätskonflikte oder "zwingen" sie, ihre Gefühle zu verheimlichen. Auch tendieren sie dann dazu, Kontakte zur Herkunftsfamilie zu erschweren und diese dem Kind gegenüber abzuwerten. Schließlich erleben sie die geplante Rückführung ihres Pflegekindes als Angriff auf ihre Familie und stürzen sich in Auseinandersetzungen mit der Jugendbehörde bis hin zu Gerichtsprozessen.
Identifizieren sich Pflegeeltern mit den in unserer Gesellschaft vorherrschenden Familienleitbildern, ignorieren sie oft, dass ein schwer verhaltensauffälliges, psychisch gestörtes oder entwicklungsverzögertes Kind der professionellen Hilfe bedarf. Sie glauben, dass es zur "Gesundung" ausreicht, wenn es in einer "normalen" Familie mit liebevollen Pflegeeltern lebt. Damit erhalten manche Pflegekinder nicht - zumindest nicht frühzeitig - eine dringend benötigte heilpädagogische oder psychotherapeutische Behandlung, wird dem Kindeswohl nicht genügt.
Zur Notwendigkeit einer Distanzierung von Familienleitbildern
Es ist also nur begrenzt sinnvoll, sich an Familienkonzepten zu orientieren. So plädiere ich für die Professionalisierung von Pflegeeltern und SOS-Kinderdorf-Müttern: Gelingt es ihnen, sich von Mutter- und Familienleitbildern zu distanzieren, dann akzeptieren sie eher die leiblichen Eltern der ihnen anvertrauten Kinder und sind weniger geneigt, mit ihnen zu konkurrieren und sie vor den Kindern schlecht zu machen. Sie sind eher zu einer Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern bereit, wie dies in § 37 Abs. 1 SGB VIII von ihnen verlangt wird. Dann können sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Eltern-Kind-Beziehungen und eventuell sogar zur Verbesserung der Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie leisten. Schließlich werden sie zum Abschluss der Jugendhilfemaßnahme "Vollzeitpflege" die Reintegration des Kindes in seine Herkunftsfamilie fördern.
Erleben sich Pflegeeltern und SOS-Kinderdorf-Mütter als Professionelle, akzeptieren sie eher, dass die "normalen" erzieherischen Fähigkeiten von "Ersatzeltern" aufgrund der besonderen Anforderungen durch die ihnen anvertrauten Kinder in der Regel nicht ausreichen, sondern dass sie einer Weiterqualifizierung bedürfen. Und sie akzeptieren eher, dass es bei Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen oder Entwicklungsverzögerungen der Kinder - und insbesondere während der Eingewöhnungszeit - oft notwendig ist, die Hilfe von Therapeuten und anderen Spezialisten einzuholen. Dies könnte zumindest bei Pflegefamilien zu einer Reduzierung der Zahl der Pflegestellenabbrüche führen. Zugleich dürfte diese Haltung - auch bei SOS-Kinderdorf-Müttern - die Bereitschaft zur Kooperation mit Jugendbehörden erhöhen.
Letztlich lässt sich die Grundaussage meines Artikels in folgendem Satz zusammenfassen: Meines Erachtens sollten sich Pflegemütter und insbesondere SOS-Kinderdorf-Mütter von den in unserer Gesellschaft weit verbreiteten Mutteridealen und Familienkonzepten distanzieren und sich selbst als "Professionelle" verstehen. Und daraus folgt, dass sie einer besonderen Ausbildung bedürfen, aber auch der Fortbildung und Supervision.
Literatur
Deutscher Städtetag: Pflegekinder - Hinweise und Empfehlungen. Köln: Selbstverlag 1986
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Handbuch Beratung im Pflegekinderbereich. München: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut 1987
Friedman, A./Weinberg, H./Pines, A.M.: Sexuality and motherhood: mutually exclusive in perception of women. Sex Roles 1998, 38, S. 781-800
Fthenakis, W.E.: Väter. Band 1 und 2. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1988
Glenn, E.N.: Social constructions of mothering: A thematic overview. In: Glenn, E.N./Chang, G./Forcey, L.R. (Hrsg.): Mothering: Ideology, experience, and agency. New York: Routledge 1994, S. 1-29
Hays, S.: Die Identität der Mütter. Zwischen Selbstlosigkeit und Eigennutz. Stuttgart: Klett-Cotta 1998
Heinze, E.: Eltern spielen "Vater, Mutter, ... (Pflege-)Kind". Ein Vorbereitungsseminar für Pflegeeltern-Bewerber. Humanistische Psychologie 1995, 18 (2), S. 37-62
Herlyn, I./Vogel, U./Kistner, A./Langer, H./Mangels-Voegt, B./Wolde, A.: Begrenzte Freiheit - Familienfrauen nach ihrer aktiven Mutterschaft. Eine Untersuchung von Individualisierungschancen in biographischer Perspektive. Bielefeld: Kleine 1993
Laub, T.: Aspekte des Mutter-Seins. System Familie 1992, 5, S. 3-9
Marshall, H.: The social construction of motherhood: An analysis of childcare and parenting manuals. In: Phoenix, A./Woollett, A./Lloyd, E. (Hrsg.): Motherhood: Meanings, practices and ideologies. London: Sage 1991, S. 66-85
Textor, M.R.: Erfahrungen mit Pflegekinderdiensten und Adoptionsvermittlungsstellen. Ergebnisse der KINDESWOHL-Umfrage. Münster: Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern 1995
Textor, M.R.: Angebote für Pflege- und Adoptiveltern. Zentralblatt für Jugendrecht 1995, 82, S. 538-540 und 1996, 83, S. 57
Wiemann, I.: Die besondere Lebenssituation von Pflegekindern und ihren beiden Familien. Beratung von Pflegefamilien. In: Cremer, H./Hundsalz, A./Menne, K. (Hrsg.): Jahrbuch für Erziehungsberatung, Band 1. Weinheim: Juventa 1994, S. 15-32
Wiemann, I.: Psychologische und soziale Voraussetzungen für die Rückführung von Pflegekindern zu ihren leiblichen Eltern. Unsere Jugend 1997, 49, S. 229-237
Woodward, K.: Motherhood: Identities, meanings and myths. In: Woodward, K. (Hrsg.): Identity and difference. Culture, media and identities. Milton Keynes: Open University Press 1997, S. 239-297