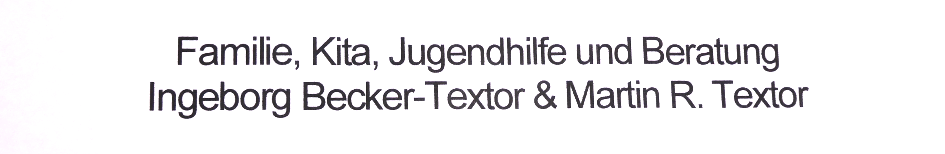Familien – Lebenslagen von „Problemkindern“
Martin R. Textor
Die Entwicklung von Kleinkindern wird zum einen durch ihre Anlagen, zum anderen durch ihre soziale Umwelt bestimmt. Kinder unter drei Jahren verbringen fast den ganzen Tag in der Familie; eine Fremdbetreuung ist bei dieser Altersgruppe die recht seltene Ausnahme. Somit umfasst die ihre Entwicklung mitprägende Umwelt nahezu ausschließlich die Familie. Aber auch bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren behält die Lebenswelt „Familie“ in der Regel den größten Einfluss, wenn auch die Kindertageseinrichtung sowie zunehmend die Medien und die Gleichaltrigengruppe als neue und bedeutende Sozialisationsinstanzen hinzutreten.
So ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Gründe für eine als problematisch erlebte Entwicklung von jüngeren Kindern in ihrer Familiensituation liegt. Deshalb verwundert, dass weder in der empirischen noch in der klinischen Forschung genügend Aufmerksamkeit der pathologischen Entwicklung in der frühen Kindheit und ihren Ursachen gewidmet wurde. Und das überrascht um so mehr, wenn man bedenkt, dass Eltern, die von Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Kindern im Säuglingsalter berichtet haben, häufig ihre Kinder auch im Kleinkind- und Schulalter als verhaltensauffällig erleben (Campbell et al. 1991).
Geht man davon aus, dass (1) eine problematische Entwicklung bereits in der frühesten Kindheit beginnen kann und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis in das Schulalter hinein fortsetzt und (2) ein Großteil der problemverursachenden und -aufrechterhaltenden Faktoren in der Familie liegt, dann muss man größten Wert darauf legen, dass diese Faktoren zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfasst und auf eine für das Kind positive Weise verändert werden. In diesem Kapitel sollen nun mögliche Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten von (Klein-) Kindern zusammengestellt werden. Es wird hier nur die Familiensituation berücksichtigt, da problemverursachende Faktoren im Kind, im Kindergarten oder in dem soziokulturellen Kontext in anderen Kapiteln des Buches (Textor 1996) beschrieben werden.
Die Eltern
Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Verhaltensmodelle für Kinder. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich ihr psychischer und emotionaler Zustand auf das Befinden und die Entwicklung ihrer Kinder auswirkt. So leiden die Eltern von „Problemkindern“ überdurchschnittlich oft an Depressionen, Suchtkrankheiten, Psychosen, Angstzuständen und anderen psychischen Störungen, haben sie relativ häufig Beratungseinrichtungen besucht (Campbell et al. 1991; Mattejat 1985). Zwei Beispiele:
Depressive Mütter zeigen weniger Zuwendung, stimulieren ihre Kinder weniger, ignorieren sie vielfach und berichten häufiger von Verhaltensauffälligkeiten. Ihre Kinder benehmen sich oft schon im Säuglingsalter ähnlich wie die Mütter: Sie lächeln weniger, wirken unzufriedener und sind reizbarer als andere Kinder (Ludwig 1985; McLoyd/ Wilson 1990).
Alkoholkranke Eltern sind häufig aggressiv oder depressiv, verhalten sich ihren Kindern gegenüber wechselhaft und vernachlässigen die Erziehung und andere Familienfunktionen. Ihre Kinder sind überdurchschnittlich oft unsozial, impulsiv, rebellisch und ungehorsam oder ängstlich, unsicher und verschüchtert (Fitzgerald et al. 1993; Tubman 1993).
Für solche Untersuchungsergebnisse gibt es jedoch verschiedene Erklärungsmöglichkeiten: So ist denkbar, dass die Kinder das depressive (aggressive, ängstliche usw.) Verhalten ihrer Eltern nachahmen oder dass sie von diesen die genetische Prädisposition für Depressionen oder andere psychische Störungen geerbt haben. Auch ist möglich, dass depressive oder sehr ängstliche Eltern Verhaltensweisen ihrer Kinder als auffällig und belastend empfinden, die für andere Eltern normal und altersgemäß sind, so dass die Kinder ungerechtfertigterweise als „schwierig“ bezeichnet werden. Schließlich können die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder die Ursache für die Depressionen, den psychischen Stress oder die emotionale Labilität der Eltern sein. Beispielsweise weinen manche Säuglinge häufig und untröstlich (sogenannte „cry-babies“), wecken einige Kleinstkinder ihre Eltern mehrmals pro Nacht, sind manche Kleinkinder sehr „anstrengend“ und verlangen fortwährend die Aufmerksamkeit ihrer Eltern – wodurch es schnell zu einer Überlastung kommt. Hier können auch „Teufelskreise“ entstehen: Der Säugling weint oft, die Mutter ist gestresst und ignoriert zunehmend das Kind, dieses weint noch häufiger, um die Aufmerksamkeit der Mutter zu erlangen, diese wird mit der Zeit depressiv und vernachlässigt das nun schon etwas ältere Kind, das nur noch durch sehr auffällige Verhaltensweisen Reaktionen der Mutter hervorrufen kann.
Pathogene Familienstrukturen und Ehekonflikte
Im vorausgegangenen Abschnitt wurde zum einen deutlich, dass pathogene Faktoren in Familien wie die Depressivität oder Alkoholkrankheit eines Elternteils direkt oder über vermittelnde Faktoren (z.B. einen vernachlässigenden Erziehungsstil) auf ein Kind einwirken und die Prozesse auf unterschiedliche Weise erklärt werden können (Nachahmungslernen, genetische Prädisposition, mangelnde Belastbarkeit usw.). Zum anderen wurde offensichtlich, dass es sich hier oft um Wechselwirkungen zwischen elterlichem und kindlichem Verhalten handelt, die zur gegenseitigen Verstärkung unerwünschter Reaktionen führen.
Solche Rückkoppelungsprozesse zwischen Eltern und Kindern sind in Familien eher die Regel als die Ausnahme. Sie machen letztlich die Unterscheidung von Anfang und Ende, Ursache und Wirkung, Reiz und Reaktion unmöglich. So ist unter systemtheoretischen Gesichtspunkten die Untersuchung der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten ein wenig erfolgversprechendes, ja letztlich sinnloses Unterfangen – wichtiger sind die in der Gegenwart stattfindenden Prozesse, die zumeist automatisch ablaufen und voraussagbar sind.
Nach der Systemtheorie muss jede Familie als ein System verstanden werden, d.h. als ein Komplex von miteinander interagierenden und zugleich voneinander abgegrenzten Subsystemen (Ehe-, Eltern-Kind-, Geschwistersubsystem, Individuum), aber auch als Teil größerer Systeme (Verwandtschaft, Netzwerk, Gemeinde, Gesellschaft usw.). Jedes Familiensystem besitzt eine charakteristische Struktur (Hierarchie), erfüllt bestimmte Funktionen und strebt nach der Bewahrung seiner Ganzheit sowie nach Aufrechterhaltung des in ihm bestehenden Gleichgewichts (Äquilibrium). Die Beziehungen zwischen den Subsystemen sind durch Regeln, Interaktionsmuster, Rollenerwartungen usw. genau definiert. Jedes Subsystem wirkt wie ein „Regler“ (Haley), der das Verhalten der anderen überwacht, bei Abweichungen von der „Norm“ aktiv wird und dann den Erhalt oder die Wiederherstellung des Äquilibriums anstrebt. So hat ein Ereignis in irgendeinem Subsystem (z.B. Ehe), eine Veränderung desselben oder ein von ihm initiierter Prozess Auswirkungen auf alle anderen Subsysteme und das Gesamtsystem, wirken sich von außen kommende Einflüsse auf die ganze Familie und alle ihre Teile aus.
Dies bedeutet, dass die „Ursachen“ von Verhaltensauffälligkeiten nicht nur im Eltern-Kind-Subsystem, sondern auch in anderen Subsystemen und im Gesamtsystem liegen können.
Beispielsweise kann die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit durch die Mutter (nach dem Erziehungsurlaub) das Äquilibrium im Familiensystem für längere Zeit nachhaltig stören und zu Konflikten und Belastungen führen, unter denen dann auch die Kinder leiden. In manchen Fällen ist das Äquilibrium so starr, sind die Familienregeln so unveränderbar, die Interaktionsmuster so eingeschliffen, die Grenzen zur Außenwelt hin so undurchdringlich, dass notwendige Veränderungen und Anpassungen ausbleiben, also das ganze Familiensystem pathogen wird. Im gegenteiligen Fall (labiles Gleichgewicht, fehlende oder inkonstante Regeln, ganz offene Grenzen) kommt die Familie hingegen nie zur Ruhe, herrscht Chaos, gibt es immer wieder Einmischung von außen. Problematisch ist auch, wenn sich die Subsysteme zu stark oder zu wenig voneinander abgrenzen, es über die natürlichen Subsysteme hinweg zu Symbiosen oder Bündnissen kommt bzw. einzelne Familienmitglieder ausgeschlossen oder ausgestoßen werden (Textor 1992).
Eine große Bedeutung für die kindliche Entwicklung hat das Ehesubsystem, insbesondere die Ehequalität. Beispielsweise berichten Weindrich und Kollegen (1992): „Kinder aus disharmonischen Partnerbeziehungen weisen im Alter von 2 Jahren hochsignifikant mehr Symptome auf als Kinder aus harmonischen Beziehungen“ (S. 115). Bei einer Verschlechterung der Paarbeziehung entwickeln sich Kinder ungünstiger, bei einer Verbesserung positiver. „Offensichtlich werden bei einer sich verschlechternden Beziehung Kräfte aus der Erziehung und Betreuung des Kindes abgezogen, die für die Auseinandersetzungen zwischen den Eltern bzw. zur Neuorientierung der Eltern gebraucht werden“ (a.a.O., S. 117). Auch nach einer Trennung kommt es oft zur Ausbildung oder verstärkten Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten, wozu einschneidende Veränderungen in der Lebenssituation (wie Schul- und Wohnungswechsel) und der häufige Verlust eines Elternteils beitragen (Textor 1991a).
Zumeist sind aber chronisch disharmonische Ehen belastender für die kindliche Entwicklung als das Erleben von Trennung und Scheidung. Im erstgenannten Fall treten eher folgende Prozesse auf: Beispielsweise werden schon Kleinkinder verhaltensauffällig, um unbewusst die Ehe ihrer Eltern zu retten – durch ihre Symptome lenken sie diese von ihren Konflikten ab und zwingen sie, sich auf ihr Kind zu konzentrieren, über es zu sprechen und zwecks Kontrolle seines Verhaltens zusammenzuarbeiten. Das Kind kann auch zum Sündenbock gemacht und für die Familienprobleme verantwortlich erklärt werden. Dann können die Ehepartner ihre Aggressionen an ihm anstatt aneinander abreagieren. Dies verhindert aber eine Lösung der Ehekonflikte. In anderen Fällen wird Kindern die Rolle eines Ersatzpartners zugeschrieben. Sie sollen die affektiven Bedürfnisse eines Elternteils befriedigen und werden an diesen symbiotisch gebunden. Ältere Kinder können auch zum Verbündeten oder Schiedsrichter gemacht und in die Konflikte hineingezogen werden. Alle diese Rollen sind nicht kind- und altersgemäß; sie führen damit oft zur Ausbildung von Verhaltensauffälligkeiten (Textor 1992).
Sehr negativ auf die Entwicklung wirkt sich aus, wenn Kinder immer wieder Zeuge von Gewalttätigkeiten zwischen ihren Eltern werden. Nach Untersuchungen weisen sie dann schon im Kleinkindalter überdurchschnittlich viele internalisierende oder externalisierende Verhaltensauffälligkeiten auf – und zwar schlimmere als Kinder, die nur verbale Aggressivität zwischen ihren Eltern erleben (Fantuzzo et al. 1991; Sternberg et al. 1993). Ihre Familiensituation wird häufig noch durch weitere Stressoren belastet, wie Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch oder niedriges Einkommen. Ähnliches gilt für Kinder, die selbst Opfer von Gewalt werden. Auch sie wachsen überdurchschnittlich oft in einkommensschwachen Familien auf, in denen es häufig zu Konflikten zwischen den Mitgliedern kommt. Diese sind sozial isoliert und erfahren wenig Unterstützung aus ihrem Netzwerk. Die Eltern zeigen ihren Kindern nur wenig Zuneigung und Liebe, vernachlässigen sie, lehnen sie ab, fördern kaum ihre Autonomie und Weiterentwicklung, ärgern sich immer wieder über sie und verfügen zumeist nur über körperliche Disziplinierungstechniken (Trickett 1993). Viele physisch misshandelte Kinder sind z.B. aggressiv, ungehorsam und abweisend, zeigen wenig Lernmotivation und entwickeln Verhaltensauffälligkeiten. Ähnliches gilt für Kinder, die sexuell missbraucht wurden (Einbender/ Friedrich 1989).
Problematische Erziehungsstile
Im vorausgegangenen Absatz wurde erneut deutlich, dass es keine monokausalen Erklärungen gibt wie „Häufige körperliche Misshandlungen führen zu Verhaltensstörungen“. In der Regel muss von einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren ausgegangen werden, die gemeinsam eine für das jeweilige Kind negative Familiensituation erzeugen. Hier spielt das Erziehungsverhalten der Eltern eine entscheidende Rolle, und so überrascht nicht, dass sich viele Fachleute mit der Identifizierung problematischer Erziehungsstile befasst haben. Erneut muss betont werden, dass auch hier von einem interaktionalen Modell auszugehen ist: Nicht nur das Verhalten der Eltern beeinflusst das Verhalten des Kindes, sondern auch umgekehrt. Dies verdeutlicht Ludwig (1985): „Ein feindselig-ablehnender Erziehungsstil der Eltern kann so im Extrem als Ursache der kindlichen Verhaltensauffälligkeit, wie auch als Reaktion der Belastung und Überforderung auf die Verhaltensweisen des Kindes angesehen werden“ (S. 88).
Eltern von „Problemkindern“ zeigen überdurchschnittlich oft eine feindselig-ablehnende Haltung gegenüber letzteren, ordnen mehr an, kontrollieren deren Verhalten weniger effektiv und greifen häufiger zu (Körper-)Strafen. Sie reagieren stärker auf abweichende Verhaltensweisen und geraten öfters in aggressive Auseinandersetzungen mit ihren Kindern (Ludwig 1985; Rutter 1987). Besonders schädlich ist, wenn die übertretenen Regeln und die Gründe für eine Bestrafung nicht erklärt werden oder wenn wortlos gestraft wird. In diesen Fällen zeigen Kleinkinder häufig ein aggressives Verhalten, Wutanfälle und Trotzreaktionen. Andere problematische Erziehungsstile sind (Textor 1992):
- Verwöhnung und Überbehütung: Die Eltern erfüllen ihren Kindern jeden Wunsch und versuchen, ihnen Versagungen und negative Erfahrungen zu ersparen. Sie ergreifen Besitz von ihnen, binden sie an sich und erdrücken sie mit ihrer Liebe. Ihr Verhalten wird fortwährend kontrolliert, und schon kleine Auffälligkeiten werden ängstlich registriert. Die Kinder bleiben abhängig und unselbständig, sind unterfordert und wenig leistungsorientiert, können ihre Fähigkeiten nicht erproben und haben wenig Möglichkeiten zur Selbstbewährung. Sie entwickeln kaum Selbstvertrauen und zeigen ein ängstlich-gehemmtes Verhalten.
- Autoritäre Erziehung: Die Eltern lenken das Verhalten ihrer Kinder durch Ge- und Verbote, Anordnungen und Befehle. Sie kontrollieren fortwährend deren Verhalten, werden schon bei kleinen Abweichungen von den Familienregeln aktiv und erzwingen dann ihren Gehorsam durch Strenge und Bestrafung. Die Eltern zeigen wenig Verständnis und Empathie, loben und ermutigen selten. Ihre Kinder sind oft verschüchtert, ängstlich, übergehorsam und unselbständig, manchmal aber auch aggressiv und trotzig.
- Antiautoritäre Erziehung: Manche Eltern sind unfähig, ihren Kindern klare, eindeutige und konstante Verhaltensregeln zu setzen, während andere bewusst auf Normen, Ge- und Verbote verzichten. Die Kinder sind orientierungslos, nutzen die Nachgiebigkeit ihrer Eltern aus und setzen sich ihnen gegenüber durch. So überschätzen sie oft ihre Macht, werden egozentrisch und können sich nicht in Gruppen einordnen. In diesen und den nachfolgenden Fällen werden besonders häufig Verhaltensauffälligkeiten ausgebildet (Feehan et al. 1991; Ludwig 1985).
- Inkonsistente Erziehung: Haben Eltern unterschiedliche Erziehungsziele und -praktiken, setzen sie positive und negative Verstärkungen willkürlich ein, wechseln sie fortwährend zwischen einem autoritären und einem permissiven Erziehungsstil, dann sind ihre Kinder orientierungslos und wissen nicht, wie sie sich benehmen sollen. Ihr Verhalten wird mit der Zeit immer weniger kontrollierbar.
- Vernachlässigung: Manche Eltern sind ihren Kindern gegenüber gleichgültig und desinteressiert, kümmern sich kaum um sie, zeigen nur wenig Zuwendung, loben und unterstützen sie selten. Die Kinder sind sich selbst überlassen und werden hinsichtlich ihres Verhaltens kaum kontrolliert. Sie haben häufig nur wenig Selbstachtung und zeigen ein ängstlich-gehemmtes oder ein eher aggressives Verhalten.
Die letzten Sätze machen deutlich, dass nicht nur negativ bewertete Erziehungspraktiken von Eltern (z.B. Körperstrafen, Über- oder Unterforderung, wechselhafter Erziehungsstil) Problem erzeugend sind – vielmehr gilt dasselbe auch für das Fehlen positiver Praktiken, wie Stimulierung und Beantwortung von Fragen des Kindes, Anleitung, Unterweisung, Unterstützung, Motivierung zu entwicklungsfördernden Aktivitäten, Zeigen von Aufmerksamkeit oder Ausdruck von Zuneigung. Pettit und Bates (1989) stellten bei einer Untersuchung sogar fest, „dass das Fehlen positiver elterlicher Verhaltensweisen hinsichtlich der Entwicklung von Verhaltensproblemen genauso wichtig ist wie das Vorhandensein negativer elterlicher Verhaltensweisen“ (S. 419). Im erstgenannten Fall bemühen sich Kleinkinder fortwährend um die Zuwendung ihrer Eltern, die sie aber ignorieren. Da sie damit wenig Erfolg haben, versuchen sie dann oft, durch auffällige Verhaltensweisen die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zu ziehen.
Krisen im Lebens- und Familienzyklus
Sowohl der einzelne Mensch als auch die Familie durchlaufen in seinem Leben bzw. in ihrer Existenz verschiedene Entwicklungsphasen. In den letzten beiden Jahrzehnten haben Psychologen, Psychotherapeuten und Familienforscher ermittelt, dass die Zeit des Übergangs von einer Phase zur nächsten von vielen Menschen bzw. Familien als Krise erlebt wird. Es handelt sich hier um relativ kurze Zeiträume, in denen vom einzelnen und vom Familiensystem eine große Zahl einschneidender Veränderungen erwartet wird bzw. diese zu verarbeiten sind. Obwohl die Übergänge (Transitionen) regelmäßig auftreten, also voraussagbar und vorhersehbar sind, treffen sie den einzelnen bzw. die Familie zumeist unvorbereitet und überraschend. In dieser Zeit der Diskontinuität zwischen den Phasen des Lebens- bzw. Familienzyklus sind viele Stressoren zu bewältigen, muss eine große Anpassungsleistung erbracht werden. Eine besonders problematische Situation entsteht, wenn zusätzliche Belastungen (z.B. Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit der Großmutter, Schulschwierigkeiten eines älteren Geschwisterteils) hinzukommen (Falicov 1988).
Häufig werden in diesen Zeiträumen des Übergangs nicht alle Stressfaktoren bewältigt, werden „alte“ Verhaltens- und Interaktionsmuster zu lange beibehalten, bleibt ein Teil der notwendigen Veränderungen aus. Nicht alle anstehenden Entwicklungsaufgaben werden gelöst. Der einzelne Mensch bzw. die Familie gerät in eine Sackgasse. Er/sie ist für die kommende Zeit schlecht gerüstet; die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Bewältigung der nächsten Krise oder Transition noch schwerer fällt. So werden die Zahl belastender Faktoren und der Stress immer größer (Falicov 1988). In dieser Situation mag der einzelne Mensch bzw. ein Familienmitglied (z.B. ein Kleinkind) psychische Störungen entwickeln oder verhaltensauffällig werden.
In Familien, die den Übergang von einer Phase des Familienzyklus in die nächste nicht geschafft haben, leidet die Erfüllung der Familienfunktionen, einschließlich der Sozialisationsfunktion. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens problematischer Erziehungsstile wird größer. Das Familienklima verschlechtert sich, es treten vermehrt Ehe- und Familienkonflikte auf. Im Extremfall kann es zu psychischen oder Suchtkrankheiten der Eltern kommen. Wie bereits beschrieben, treten Verhaltensauffälligkeiten bei (Klein-) Kindern unter solchen Umständen besonders häufig auf. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
Die Geburt eines zweiten Kindes bringt sowohl für das Erstgeborene als auch für die ganze Familie große Veränderungen mit sich. Die Reaktionen von älteren Kindern können in diesem Zeitraum des Übergangs von einer Ein-Kind- zu einer Zwei-Kind-Familie höchst unterschiedlich sein – je nach Alter, Temperament, Vorbereitung auf dieses Ereignis durch die Eltern, Erziehungsverhalten, emotionale Stabilität der Mutter, Familienklima usw. (Dunn 1988). Bei Kleinkindern ist zumeist eine Zunahme von als problematisch erlebten Verhaltensweisen festzustellen, wie Regression, Weinerlichkeit, Anklammerung, Rückzug, Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme oder Einnässen. In der Regel verschwinden diese Reaktionen auf die Geburt eines Geschwisterteils im Verlauf der ersten Wochen oder Monate. Manche Kinder bewältigen aber diese Transition nicht, insbesondere dann nicht, wenn auch ihre Eltern mit ihr schlecht zurechtkommen. In diesen Fällen kann es zu sich wechselseitig verstärkenden negativen Prozessen kommen: „Störungen in der Mutter-Kind-Beziehung können anfangs entweder aufgrund des zunehmend schwieriger werdenden Verhaltens des 'entthronten' Zweijährigen oder aufgrund der wachsenden Gereiztheit einer erschöpften Mutter entstehen, die bei sehr wenig Schlaf mit zwei kleinen Kindern zurechtkommen muß; in jedem Fall ist der wahrscheinliche Effekt, dass das negative Verhalten der anderen Person gesteigert wird“ (Dunn 1988, S. 233).
Auch der Eintritt in den Kindergarten ist ein wichtiger Übergang im Lebenszyklus von Menschen. Die Kinder werden mit vielen neuen Aufgaben konfrontiert: Sie müssen sich in eine große Gruppe von Kindern einfügen, Beziehungen zu den Erzieher/innen aufbauen, mehrere Stunden pro Tag ohne ihre Eltern zurechtkommen, sich an eine unbekannte Lebenswelt anpassen, neue Regeln und Erwartungen kennenlernen. Jedes Kleinkind meistert diese Transition mehr oder minder schnell und gut; einige reagieren auffällig.
Andere Belastungen von Familien
Neben vorhersehbaren Krisen während des Übergangs von einer Phase des Lebens- bzw. Familienzyklus zur nächsten können auch unerwartete Schicksalsschläge eine Familie treffen. Eine schwere Erkrankung, ein Unfall oder ein Todesfall, die Geburt eines behinderten Kindes, eine ungeplante Schwangerschaft oder die plötzliche Trennung der Ehepartner können zu Familienkrisen führen. Deren Bewältigung hängt davon ab, ob die Eltern z.B. über genügend Ressourcen verfügen und ausreichend durch ihr soziales Netzwerk unterstützt werden und ob sie in ihrer Jugend und im frühen Erwachsenenalter gelernt haben, mit Problemen konstruktiv umzugehen (Peterander et al. 1992; Pittman 1988). Unbewältigte Krisen können zu den im vorletzten Absatz beschriebenen pathogenen Entwicklungen führen.
Manche Schicksalsschläge wie ein langer Krankenhausaufenthalt aufgrund einer schweren Erkrankung können natürlich ein Kind direkt treffen – und so überrascht nicht, dass ein statistischer Zusammenhang zwischen einer Hospitalisierung im frühen Kindesalter und Deprivationssymptomen bzw. späteren Verhaltensauffälligkeiten besteht (Rutter 1985). Auch der durch einen Umzug bedingte Wechsel von einem Kindergarten in einen anderen kann von einem Kleinkind als Krise erlebt werden und zu Verhaltensproblemen führen (Dunn 1988).
Andere Belastungen von Familien können längerfristig und dauerhaft sein: Bei Familien, deren Situation durch Langzeitarbeitslosigkeit, Überschuldung oder Armut gekennzeichnet ist, kommt es häufig im Verlauf der Zeit bei den Erwachsenen zu psychischen Problemen und Ehekonflikten, manchmal auch zu Alkoholmissbrauch und Gewalttätigkeiten. Die Eltern legen vielfach nur einen geringen Wert auf Erziehung und Bildung, vernachlässigen ihre Kinder oder sind sehr streng (Körperstrafen). Im Verlauf der Zeit entwickeln viele Kinder Verhaltensauffälligkeiten wie Depressivität, Rückzug und Aggressivität. Sie wirken unsicher, haben wenig Selbstvertrauen und Angst vor der Zukunft (Haberkorn et al. 1983; McLoyd/ Wilson 1990). Unter besonderen Belastungen leiden z.B. auch Scheidungs-, Teil- und Stieffamilien (Textor 1991a, b, 1993b), Ausländer- und Aussiedlerfamilien (Deutscher Caritasverband 1991; Haberkorn et al. 1983) sowie Familien mit behinderten oder pflegebedürftigen Mitgliedern (Textor 1993a).
Zur Kumulation von Risikofaktoren
In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass Verhaltensauffälligkeiten von (Klein-) Kindern in Beziehung stehen zu Risikofaktoren wie:
- psychische Probleme, Suchtkrankheiten u.Ä. bei den Eltern,
- Ehe- und Familienkonflikte,
- pathogene Charakteristika von Familiensystemen,
- schlechte Eltern-Kinder-Beziehungen und problematische Erziehungsstile,
- unbewältigte Krisen beim Übergang von einer Phase des Lebens- bzw. Familienzyklus zur nächsten,
- andere Belastungen von Familien.
Mehrere Untersuchungen weisen nach, dass ein einzelner Risikofaktor (oder ganz wenige) nicht mit einer nennenswert höheren Wahrscheinlichkeit kindlicher Verhaltensauffälligkeiten einhergeht (Fantuzzo et al. 1991; Fergusson/ Horwood/ Lawton 1993; Garmezy 1987; Lösel/Breuer-Kreuzer 1990; Rutter 1981). Je mehr Risikofaktoren aber im Einzelfall zusammenkommen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensauffälligkeiten – wobei diese dann exponentiell wächst.
Quelle
Aus: Martin R. Textor (Hrsg.): Problemkinder? Auffällige Kinder in Kindergarten und Hort. Weinheim, Basel: Beltz 1996, S. 12-21
Literatur
Campbell, S.B./March, C.L./Pierce, E.W./Ewing, L.J./Szumowski, E.K.: Hard-to-manage preschool boys: Family context and the stability of externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology 1991, 19, S. 301-318
Dunn, J.: Normative life events as risk factors in childhood. In: Rutter, M. (Hrsg.): Studies of psychosocial risk: The power of longitudinal data. Cambridge: Cambridge University Press 1988, S. 227-244
Einbender, A.J./Friedrich, W.N.: Psychological functioning and behavior of sexually abused girls. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1989, 57, S. 155-157
Falicov, C.J.: Family sociology and family therapy contributions to the family development framework: A comparative analysis and thoughts on future trends. In: Falicov, C.J. (Hrsg.): Family transitions: Continuity and change over the life cycle. New York: Guilford Press 1988, S. 3-51
Fantuzzo, J.W./DePaola, L.M./Lambert, L./Martino, T./Anderson, G./Sutton, S.: Effects of interparental violence on the psychological adjustment and competencies of young children. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1991, 59, S. 258-265
Feehan, M./McGee, R./Stanton, W.R./Silva, P.A.: Strict and inconsistent discipline in childhood: Consequences for adolescent mental health. British Journal of Clinical Psychology 1991, 30, S. 325-331
Fergusson, D.M./Horwood, L.J./Lawton, J.M.: Vulnerability to childhood problems and family social background. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 1993, 31, S. 1145-1160
Fitzgerald, H.E./Sullivan, L.A./Ham, H.P./Zucker, R.A./Bruckel, S./Schneider, A.M./Noll, R.B.: Predictors of behavior problems in three-year-old sons of alcoholics: Early evidence for the onset of risk. Child Development 1993, 64, S. 110-123
Garmezy, N.: Stress, competence, and development: Continuities in the study of schizophrenic adults, children vulnerable to psychopathology, and the search for stress-resistant children. American Journal of Orthopsychiatry 1987, 57, S. 159-174
Haberkorn, R./Hagemann, U./Seehausen, H./Gerlach, F.: Verhaltens- und Beziehungsprobleme – eine Herausforderung an den Kindergarten. Bonn: Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1983
Lösel, F./Breuer-Kreuzer, D.: Metaanalysen in der Evaluationsforschung: Allgemeine Probleme und eine Studie über den Zusammenhang zwischen Familienmerkmalen und psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 1990, 4, S. 253-268
Ludwig, T.B.: Verhaltensstörungen bei Vorschulkindern. Formen und Ursachen: Soziale Schicht, Erziehungsstil und Persönlichkeit der Eltern. Frankfurt/Main: Fachbuchhandlung für Psychologie, Verlagsabteilung 1985
Mattejat, F.: Pathogene Familienmuster. Theoretische und empirische Analysen zum Zusammenhang zwischen Familienmerkmalen und psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Enke 1985
McLoyd, V.C./Wilson, L.: Maternal behavior, social support, and economic conditions as predictors of distress in children. In: McLoyd, V.C./Flanagan, C.A. (Hrsg.): Economic stress: Effects on family life and child development. San Francisco: Jossey-Bass 1990, S. 49-69
Peterander, F./Bailer, J./Henrich, G./Städler, T.: Familiäre Belastungen, Elternverhalten und kindliche Entwicklung. Zeitschrift für Klinische Psychologie 1992, 21, S. 411-424
Pettit, G.S./Bates, J.E.: Family interaction patterns and children's behavior problems from infancy to 4 years. Developmental Psychology 1989, 25, S. 413-420
Pittman, F.S. III: Family crises: Expectable and unexpectable. In: Falicov, C.J. (Hrsg.): Family transitions: Continuity and change over the life cycle. New York: Guilford 1988, S. 255-271
Rutter, M.: Stress, coping, and development: Some issues and some questions. Journal of Child Psychology and Psychiatry 1981, 22, S. 323-356
Rutter, M.: Family and school influences: Meanings, mechanisms and implications. In: Nicol, A.R. (Hrsg.): Longitudinal studies in child psychology and psychiatry: Practical lessons from research experience. Chichester: Wiley 1985, S. 357-403
Rutter, M.: Psychosocial resilience and protective mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry 1987, 57, S. 316-331
Sternberg, K.J./Lamb, M.E./Greenbaum, C./Cicchetti, D./Dawud, S./Cortes, R.M./Krispin, O./Lorey, F.: Effects of domestic violence on children's behavior problems and depression. Developmental Psychology 1993, 29, S. 44-52
Textor, M.R.: Integrative Familientherapie. Eine systematische Darstellung der Konzepte, Hypothesen und Techniken amerikanischer Therapeuten. Berlin: Springer 1985
Textor, M.R.: Scheidungszyklus und Scheidungsberatung: Ein Handbuch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991a
Textor, M.R.: Teilfamilien: Strukturen, Probleme, Beratung. Soziale Arbeit 1991b, 40, S. 358-365
Textor, M.R.: Gestörte Familienstrukturen und -prozesse. In: Textor, M.R. (Hrsg.): Hilfen für Familien. Ein Handbuch für psychosoziale Berufe. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2. Aufl. 1992, S. 65-90
Textor, M.R.: Familien: Soziologie, Psychologie. Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg: Lambertus, 2., erw. Aufl. 1993a
Textor, M.R.: Stieffamilien: Entwicklung, Charakteristika, Probleme. Unsere Jugend 1993b, 45, S. 33-44
Textor, M.R.: (Hrsg.): Problemkinder? Auffällige Kinder in Kindergarten und Hort. Weinheim, Basel: Beltz 1996
Trickett, P.K.: Maladaptive development of school-aged, physically abused children: Relationships with the child-rearing context. Journal of Family Psychology 1993, 7, S. 134-147
Tubman, J.G.: A pilot study of school-age children of men with moderate to severe alcohol dependence: Maternal distress and child outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 1993, 31, S. 729-741
Weindrich, D./Laucht, M./Esser, G./Schmidt, M.H.: Disharmonische Partnerbeziehung der Eltern und kindliche Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1992, 41, S. 114-118