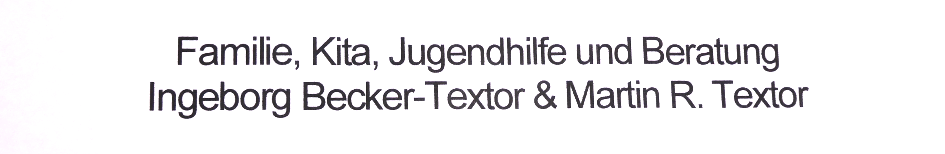Einstellungen von Adoptionsvermittlern: Eine empirische Studie
Martin R. Textor
Einstellungen sind überdauernde, mehr oder weniger komplexe Systeme von Anschauungen, Meinungen oder Überzeugungen, die sich auf bestimmte Aspekte der Welt beziehen. Sie sind relativ stabil und resistent gegenüber Veränderungsversuchen. Einstellungen führen zu einer gewissen Gerichtetheit und/oder Selektivität des Erkennens und Handelns, d.h., sie wirken sich auf Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Motivation aus, dienen der Orientierung, bringen Verhaltensdispositionen mit sich und reduzieren die Zahl der Response-Alternativen. Jedoch sind äußere Handlungen nicht monokausal aus inneren Attitüden erklärbar: Neue Informationen, Erwartungen, Normen, kognitive Urteils- und Entscheidungsvorgänge, Motivationen usw. sind ebenfalls zu beachten.
Es ist anzunehmen, dass sich auch die Einstellungen von Adoptionsvermittlern zu ihren Klienten und zu adoptionsspezifischen Fragen auf ihre berufliche Praxis auswirken - ohne diese zu determinieren. So wurden im Rahmen eines mehrjährigen, noch laufenden Forschungsprojekts mit der Bezeichnung "Inkognitoadoption und offene Formen der Adoption im Freistaat Bayern" relevante Einstellungen von 117 der rund 145 bayerischen Adoptionsvermittler mit Hilfe eines detaillierten Fragebogens erfasst. Etwa 70% der befragten Fachkräfte waren weiblich. Etwas mehr als 3% waren unter 25 Jahre alt, 39% waren zwischen 26 und 35; 28% zwischen 36 und 45 sowie 29% über 46 Jahre alt. Knapp 9% der Adoptionsvermittler waren unter einem Jahr, fast 15% zwischen einem und drei Jahren, knapp 38% zwischen vier und zehn Jahren sowie 39% seit mehr als 10 Jahren im Adoptionsbereich tätig. Die Fachkräfte verwendeten im Durchschnitt aber 65% ihrer Jahresarbeitszeit auf nicht adoptionsbezogene Tätigkeiten (was bei der geringen Zahl von Adoptionen - bundesweit 7.114 im Jahr 1989, davon 3.140 Fremdadoptionen - nicht überrascht), wobei die Variationsbreite der Antworten allerdings zwischen 4 und 99% schwankte.
Adoption als Alternative zur Abtreibung
Die Frage, ob Adoption eine Alternative zum Schwangerschaftsabbruch sei und als solche besonders gefördert werden müsse, wird von Vertretern der Katholischen Kirche und von Politikern immer wieder diskutiert. Allerdings wurde schon bei einer im Jahr 1986 durchgeführten Untersuchung über 206 anerkannte Schwangerenberatungsstellen in katholischer Trägerschaft (Deutscher Caritasverband 1987) festgestellt, dass sich nur wenige Frauen im Schwangerschaftskonflikt auf das Thema "Adoption" einlassen und dass dieses nur in 4,6% der 34.839 erfassten Fälle ausführlicher besprochen wurde. Es wurde der Eindruck festgehalten, dass der Schwangerschaftsabbruch in unserer Gesellschaft zunehmend akzeptiert, die Freigabe eines Kindes zur Adoption hingegen weiterhin geächtet wird.
Für 72% der befragten Adoptionsvermittler war die Adoption keine Alternative zum Schwangerschaftsabbruch. Eine hochsignifikante Korrelation bestand zum Geschlecht der Fachkräfte; 82% der Frauen, aber nur 48% der Männer waren dieser Meinung. Ferner stimmten Adoptionsvermittler, die weniger adoptionsfremde Aufgaben zu erledigen hatten, signifikant häufiger der Aussage zu, dass die Adoption keine Alternative zum Schwangerschaftsabbruch sei. Dieses Befragungsergebnis wird aber dadurch relativiert, dass drei Viertel der Fachkräfte "in wenigen Einzelfällen" eine Alternative in der Adoption und knapp 70% eine zusätzliche Alternative in der offenen Adoption (mit Kontakten zwischen leiblichen Müttern/Eltern und Adoptiveltern) sahen. Allerdings stimmten nur 26% der, Befragten der Aussage zu, dass die Zahl der Abtreibungen sinken würde, wenn Frauen im Schwangerschaftskonflikt bewusst wäre, dass die Adoption eine Alternative zum Schwangerschaftsabbruch ist. Auch hier ließen sich wieder hochsignifikante geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen: 86% der weiblichen Fachkräfte, aber nur 44% der Männer lehnten dieses Statement ab.
Bei unserer Untersuchung wurde ferner danach gefragt, wie Adoptionsvermittler zu leiblichen Müttern von Adoptivkindern stehen. Nur ein sehr kleiner Teil der Fachkräfte reagierten mit "ja" oder "häufig" auf die Statements, dass diese Mütter bedauernswerte Wesen sind, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen (9%), dass sie in der Regel selbst die Schuld an ihrer Situation tragen (2%), dass sie sich zumeist durch einen Mangel an Elterngefühlen und Mutterliebe auszeichnen (1%) und dass sie meistens ihr Kind schnell vergessen (0%) - ablehnend antworteten zwischen 64 und 91% der Befragten. Wenig Zustimmung fand auch die Aussage, dass leibliche Mütter keine Schuld an der Schwangerschaft trifft, da diese zumeist auf Verhütungspannen beruht (14%; 46% wählten die Antwortvorgabe "teils, teils"). Hingegen bejahten viele Fachkräfte die Statements, dass diese Mütter zumeist von ihren Partnern und Eltern ausgenutzt und im Stich gelassen wurden (5% antworteten mit "ja", 44% mit "häufig"), dass sie in der Regel unter starken psychischen Problemen leider oder sehr labil sind (9% "ja", 41% "häufig"), dass sie Verantwortung und großen Mut zeigen, wenn sie sich für die Freigabe ihres Kindes entscheiden (68% "ja", 26% "häufig") und dass sie ihr Leben lang unter der Freigabe eines Kindes leiden (16% "ja", 47% "häufig"). Nach diesen Befragungsergebnissen ist nicht anzunehmen, dass ein großer Teil der Adoptionsvermittler leibliche Mütter stigmatisiert oder negativ typisiert, wie dies Napp-Peters (1978) bei ihrer Adoptionsstudie von 1969 feststellte. Wie bei den meisten Einstellungsbefragungen ist jedoch auch bei unserer der Einfluss des Faktors "soziale Erwünschtheit" auf die Antworttendenzen unbekannt.
Einstellungen zur Adoptivfamilie
Kirk (1981) und Hoffmann-Riem (1934) kamen bei ihren Untersuchungen von Adoptivfamilien zu dem Ergebnis, dass es für die Entwicklung von Adoptivkindern und das Familienleben besser ist, wenn sich die Familie als "Adoptivfamilie" definiert. Napp-Peters (1978) vermutete, dass Adoptionsvermittler eine derartige Haltung nicht fördern würden. Diese würden Adoptiveltern durch Praktiken wie die Gewährleistung des Inkognitos, das Zurückhalten von Informationen über die Herkunft der Adoptivkinder und den Abbruch des Kontaktes nach Vollzug der Adoption in der Auffassung bestärken, dass sie eine ganz normale Familie seien, bei der es keine Unterschiede zu biologisch gegründeten Familien gäbe. Napp-Peters stellte bei ihrer Studie über 64 Adoptionsvermittlungsstellen ferner fest, dass 52% der befragten Fachkräfte der Meinung waren, dass die Schwierigkeiten von Adoptiveltern völlig denen natürlicher Eltern entsprächen. Nur 20% bejahten eindeutig, dass es adoptionsspezifische Probleme gäbe.
Unsere Befragung erbrachte zu dieser Fragestellung Ergebnisse, die eher auf eine Anerkennung des Sonderstatus der Adoptivfamilie schließen lassen. So meinten 94% der befragten Fachkräfte, dass Adoptivfamilien sich ihrer besonderen Familienstruktur bewusst sein sollten. In diesem Kontext verliert das Befragungsergebnis an Bedeutung, dass 42% der Adoptionsvermittler das Statement "Adoptivfamilien sind Familien wie jede andere" bejahten. Es ist anzunehmen, dass hier eher an das Familienleben u.Ä. gedacht wurde als an adoptionsspezifische Charakteristika.
Die Fachkräfte sind heute auch bereit, umfassende und detaillierte Informationen über die Vorgeschichte des Adoptivkindes weiterzugeben, so dass diese von Adoptiveltern nicht mehr so leicht ignoriert werden kann. Rund 97% der Befragten bejahten das Statement, dass Adoptiveltern ein Recht auf vollständige Aufklärung über das Kind haben und auch sehr negative Informationen verkraften können. Und ebenfalls 97% der Fachkräfte verneinten die Aussage, dass man bestimmte negative Informationen über die leiblichen Eltern, wie z.B. Prostitution der Mutter oder Alkoholismus des Vaters, den Adoptiveltern vorenthalten sollte, um sie nicht zu beunruhigen. Hier hat sich die Situation gegenüber 1969 sehr geändert: Damals vertraten noch 53% der von Napp-Peters (1978) befragten Vermittler die Auffassung, dass man Adoptiveltern nicht unnötig mit Angaben über die Herkunft des Kindes belasten sollte.
Da es in den "Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung" der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen Erziehungsbehörden (1988) heißt, dass Adoptivkinder bevorzugt zu Bewerbern vermittelt werden sollten, bei denen nur ein Partner außerhäuslich erwerbstätig ist, wurde auch zu dieser Fragestellung die Auffassung bayerischer Adoptionsvermittler erfasst. Nur 26% waren der Meinung, dass ein Ehegatte bei der Adoption eines Kindes seine Erwerbstätigkeit in jedem Fall aufgeben sollte. Rund 62% bejahten, dass er dies bis zum Eintritt des Kindes in den Kindergarten tun sollte. Nur 7% bzw. 5% der Befragten wählten die Antwortvorgaben "ja, falls keine Teilzeitarbeit möglich ist" und "nein, falls die Betreuung des Kindes gesichert ist".
Zur Vermittlungstätigkeit
In den "Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung" der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen Erziehungsbehörden (1988) finden sich Einschränkungen für die Vermittlung an Alleinstehende und Behinderte. So sollte ein Adoptivkind nur bei einer alleinstehenden Person platziert werden, wenn bereits ein Bekanntschafts- oder Verwandtschaftsverhältnis besteht oder wenn für das Kind "aufgrund persönlicher Vorerfahrungen die Vermittlung in eine Vollfamilie nicht förderlich ist" (S. 17). An Behinderte darf nur ein Kind vermittelt werden, falls dies nicht "zu einer besonderen Belastung für das Kind" (S. 18) führt. Ferner sollen bei der Vermittlung die Religionszugehörigkeit des Kindes bzw. entsprechende Wünsche der leiblichen Eltern berücksichtigt werden. Im Jahr 1969 lehnten noch alle von Napp-Peters (1978) befragten Fachkräfte eine Vermittlung an Alleinstehende ab, nur ein Drittel war bereit, eventuell eine Ausnahme zu machen. Auch eine Vermittlung an konfessionslose Paare wurde nur von einem Teil der Befragten für Ausnahmefälle in Betracht gezogen. Auch sprach sich ein Drittel der Fachkräfte gegen eine Vermittlung in konfessionelle Mischehen aus.
Bei unserer Umfrage erklärten 38% der Befragten, dass sie grundsätzlich auch an Alleinstehende vermitteln würden. Rund 29% wären auch bereit, Kinder in nichteheliche Lebensgemeinschaften zu platzieren, wobei rein rechtlich das Kind nur an einen Partner vermittelt werden darf. Alle Fachkräfte würden grundsätzlich in konfessionelle Mischehen, 90% an konfessionelle Bewerber und 99% an wiederverheiratete Bewerber vermitteln. Rund 65% würden prinzipiell auch behinderte Bewerber und 78% solche mit behinderten Kindern in Betracht ziehen - wobei jüngere Adoptionsvermittler sich (hoch-) signifikant häufiger hierfür aussprachen. Bedenkt man, dass 1989 bundesweit 20.507 Bewerber registriert, aber nur 3.140 Fremdadoptionen durchgeführt wurden, wird deutlich, dass Fachkräfte zwischen vielen Paaren auswählen können und nicht auf die genannten Sondergruppen zurückgreifen müssen. Auch beachten sie häufig Wünsche der abgebenden Eltern. So lässt sich aus den erwähnten Befragungsergebnissen nicht schließen, dass in der Praxis Kinder an die jeweiligen Bewerbergruppen vermittelt werden.
Ferner wurde danach gefragt, wie bayerische Fachkräfte zur Vermittlung besonderer Gruppen von Kindern stehen. Zunächst wurden sie aber um Beurteilung des Statements "Prinzipiell ist jedes Kind vermittelbar" gebeten. Rund 21% bzw. 19% antworteten mit "ja" oder "häufig", etwa 39% bzw. 4% mit "nein" oder "selten"; die übrigen entschieden sich für "teils, teils". Je weniger adoptionsfremde Aufgaben die Fachkräfte zu erledigen hatten, um so signifikant häufiger stimmten sie diesem Statement zu. Fasst man die Antwortkategorien "ja" und "häufig" zusammen, waren etwa 6% der Befragten der Auffassung, dass Kinder mit mittleren oder schweren Behinderungen im Heim besser gefördert werden können als in Adoptivfamilien; 45% waren anderer Meinung (Rest: "teils, teils"). Und nur 4% bejahten das Statement, dass psychisch kranke und stark verhaltensgestörte Kinder im Heim eher "gesund" werden als in einer Adoptivfamilie; 60% verneinten es (Rest: "teils, teils"). Rund 29% waren zudem der Meinung, dass im Freistaat Bayern zu viele Kinder im Heim bleiben, die durchaus zur Adoption freigegeben werden könnten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Napp-Peters (1978) bei ihrer Befragung feststellte, dass vor 20 Jahren 50% der von ihr erfassten Adoptionsstellen keine körperlich behinderten, 95% keine geistig behinderten und 60% keine seelisch behinderten Kinder vermittelten. Hier wird ein großer Einstellungswandel deutlich.
Insgesamt 37% der Befragten reagierten mit "ja" oder "häufig" auf das Statement, dass sehr viel mehr misshandelte, sexuell missbrauchte oder vernachlässigte Kinder zur Adoption freigegeben werden könnten, wenn öfters die Ersetzung der Einwilligung ihrer Eltern beantragt werden würde (33% antworteten mit "selten" oder "nein"). Sie schienen der Meinung zu sein, dass von dieser Alternative, die den genannten Zielgruppen das Aufwachsen in eher entwicklungsfördernden Familienverhältnissen ermöglichen würde, noch zu wenig Gebrauch gemacht wird. Generell wird selten die Einwilligung von Eltern in die Adoption ersetzt; dies traf beispielsweise 1987 in Bayern nur auf 50 der 999 Adoptionsfälle zu.
Die bayerischen Adoptionsvermittler wurden auch befragt, ob Kinder in Dauerpflege von ihren Adoptiveltern adoptiert werden sollten - von dieser Möglichkeit wird einerseits mehr Rechts- und Bindungssicherheit für das Kind sowie andererseits eine Kostenersparnis (Wegfall des Pflegegeldes) erwartet. Nur 22% der Befragten sprachen sich in diesen Fällen für eine Adoption aus (Zusammenfassung der Antwortkategorien "ja" und "häufig"); 36% waren dagegen. Noch eindeutiger war die Ablehnung des Statements: "Wollen Pflegeeltern ein Kind nicht adoptieren, das sich in Dauerpflege befindet, sollte es an Adoptionsbewerber vermittelt werden". Hier reagierten 70% der Befragten ablehnend und nur 3% zustimmend, wobei jüngere Fachkräfte signifikant häufiger die Aussage zurückwiesen. Wenig Zustimmung (4%) fand auch das Statement: "Nach dem Scheitern eines Pflege- oder Adoptionsverhältnisses ist das Kind in einem Heim besser aufgehoben". Etwa 51% der Befragten lehnten es ab, 44% wählten die Antwortkategorie "teils, teils". Es ist somit anzunehmen, dass die meisten Adoptionsvermittler wohl in einem derartigen Fall das Kind in eine andere Adoptiv- oder Pflegefamilie platzieren würden.
In der Vergangenheit spielte das "matching" eine große Rolle: Das ausgewählte Kind sollte seinen zukünftigen Adoptiveltern in möglichst vielerlei Hinsicht ähneln. Laut der Umfrage von Napp-Peters (1978) berücksichtigten Fachkräfte vor mehr als 20 Jahren folgende Charakteristika bei der Vermittlung: Intelligenz (88%), soziokultureller Hintergrund (78%), Konfession (73%), physische Ähnlichkeiten (67%; 78%, falls von Bewerbern ausdrücklich gewünscht) und Temperament (61%). Durch ein derartiges Verhalten könnte es Adoptiveltern erleichtert werden, den Sonderstatus ihrer Familienform zu ignorieren und adoptionsspezifische Probleme (ihres Kindes) zu übersehen (vgl. Kirk 1981; Hoffmann-Riem 1984).
Auch bei unserer Untersuchung wurde danach gefragt, welche Ähnlichkeiten zwischen Kind und Adoptionsbewerbern berücksichtigt werden. Bis zu neun Fachkräfte verweigerten eine Antwort auf die jeweiligen Fragen; zwischen zwei von sieben Personen ergänzten die vorgegebenen Kategorien "ja" und "nein" um "teils, teils". So beziehen sich nachstehende Prozentangaben nur noch auf 94-107 der 117 Befragten. Knapp 3% der Adoptionsvermittler berücksichtigten Ähnlichkeiten in der Augenfarbe, 6% in der Haarfarbe, 11% in der Konstitution, 12% in der zu erwartenden Körpergröße, 19% im Temperament und 29% in der Intelligenz (weitere sieben Fachkräfte antworteten hier mit "teils, teils"). Das "matching" spielt also weiterhin eine gewisse Rolle, wobei äußerliche Merkmale wenig beachtet werden.
Offene Adoption - eine Alternative?
In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts setzte sich in der sozialpädagogischen Praxis die Inkognitoadoption durch. Wichtige Beweggründe waren u.a. der Wunsch der (damals sehr wenigen) Adoptionsbewerber, die Orientierung am "biologischen" Familiengründungsmuster, die Diskriminierung "gestrauchelter" Frauen, das Bestreben, Adoptivkinder vor dem Stigma ihrer nichtehelichen Geburt zu bewahren, sowie die (angenommene) Notwendigkeit, die Adoptivfamilie vor unerwünschten Einwirkungen durch die leiblichen Eltern oder Dritte zu schützen.
Heute wird die bisherige Praxis immer häufiger in Frage gestellt. Es werden "halboffene" und "offene" Adoptionsformen diskutiert, bei denen mehr oder weniger Kontakt zwischen leiblichen Eltern und Adoptivfamilie besteht (z.B. Austausch von Informationen über die Adoptionsvermittler, einmaliges Zusammentreffen unter Wahrung des Inkognitos, direkter brieflicher Kontakt, persönlicher Kontakt). Hierdurch soll vor allem die Situation leiblicher Mütter nach Freigabe ihres Kindes zur Adoption verbessert und Adoptivkindern die Verarbeitung der doppelten Elternschaft erleichtert werden.
Bei unserer Untersuchung beurteilten 18% der Befragten eine Adoption mit fortlaufendem persönlichem Kontakt zwischen leiblichen Eltern und Adoptivfamilie als "positiv" oder "sehr positiv" und 28% als "negativ" oder "sehr negativ"; 53% entschieden sich für "teils, teils". Jedoch wurden die Folgen einer derartigen "offenen" Adoption häufiger als "positiv" oder "sehr positiv" bezeichnet, und zwar vor allem für die leiblichen Eltern (von 51% der Befragten), das Adoptivkind (37%) und den Adoptionsvermittler (37%), weniger jedoch für die Adoptiveltern (24%). Im letztgenannten Fall wurde mit 19% der höchste Wert für eine (sehr) negative Bewertung erzielt. Auch werden offene Adoptionen für folgende Gruppen von Kindern als (häufig) geeignet bezeichnet: Pflegekinder (von 81% der Befragten), ältere Kinder (67%), Säuglinge (48%), Kinder Alleinerziehender (48%) und behinderte Kinder (46%).
Der Widerspruch zwischen der zuerst genannten, mit 18% recht schwachen positiven Bewertung der offenen Adoption und den nachfolgenden Befragungsergebnissen lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass viele Adoptionsvermittler meinen, dass offene Adoptionen leibliche Mütter (häufig) vor der Freigabe ihres Kindes zurückschrecken lassen könnten, wenn diese großen Wert auf Anonymität legen (so 54% der Befragten), dass für offene Adoptionen sehr viel mehr Zeit für Vorbereitung und Nachbetreuung der Klienten anzusetzen ist (95%) und dass offene Adoptionen den Fachkräften zusätzliche Fähigkeiten und Kenntnisse (z.B. in Familienberatung und Familiendynamik) abverlangen (87%). Auch wurden auf einer vorgegebenen Liste so viele Bedingungen für offene Adoptionen als (sehr) sinnvoll bezeichnet, dass diese danach kaum zu realisieren wären. Beispielsweise sollen leibliche Eltern und Adoptiveltern ein hohes Maß an persönlicher Reife erreicht haben (so 96% der Befragten), darf kein negativer Einfluss der leiblichen Eltern auf die Beziehung zwischen Adoptiveltern und Kind zu erwarten sein (94%) und muss genügend Zeit für eine intensive Vorbereitung und Begleitung der Adoption zur Verfügung stehen (92%). Auch sei eine offene Adoption (sehr) sinnvoll, wenn das Kind Bindungen an seine leiblichen Eltern entwickelt hat (so 90% der Fachkräfte), leibliche Eltern nur unter der Bedingung einer offenen Adoption ihr Kind freigeben würden (89%), positive Beziehungen zu leiblichen Großeltern und anderen Verwandten bestehen (84%), die Schichtunterschiede zwischen leiblichen Verwandten und Adoptiveltern nicht zu groß sind, also z.B. ähnliche Erziehungsvorstellungen und Geschlechtsrollenleitbilder vertreten werden (83%), beide leiblichen Elternteile interessiert sind (82%), die Adoptiveltern wenig Angst vor Einmischung und der Konkurrenz durch die leiblichen Eltern haben (77%) usw. Bei derartigen Bedingungen ist es nicht verwunderlich, dass offene Adoptionen in Bayern wenig praktiziert werden: Auf eine zeitlich nicht eingegrenzte Frage hin berichteten nur 26 Fachkräfte, dass sie (insgesamt 63) offene Adoptionen durchgeführt hätten - wobei die häufigste Antwort (Modalwert) "1 Fall" war.
Haltung zu suchenden Adoptierten
In den meisten Staaten der USA haben erwachsene Adoptierte keine (kaum) Möglichkeiten, ihre leiblichen Eltern ausfindig zu machen oder auch nur Informationen über sie aus amtlichen Quellen zu erlangen. Hingegen können Adoptierte in der Bundesrepublik Deutschland nach Vollendung des 16. Lebensjahrs beispielsweise eine Abstammungsurkunde beantragen, die Angaben über ihre leiblichen Eltern enthält. Bei unserer Untersuchung wurde indirekt danach gefragt, ob Adoptionsvermittler mit dieser Situation einverstanden sind: Nur 11% waren der Meinung, dass die Anonymität der leiblichen Eltern besser geschützt werden sollte - 62% waren dagegen (27% antworteten mit "teils, teils"). Es waren sogar 37% der Befragten dafür, dass auch die leiblichen Eltern das Recht haben sollten, mit einem volljährigen Adoptierten von sich aus Kontakt aufzunehmen (33% waren dagegen, 31% stimmten mit "teils, teils").
Nach unserer Studie ist zu vermuten, dass Fachkräfte ein recht unterschiedliches Verhalten Adoptierten gegenüber zeigen, die Informationen über ihre leiblichen Eltern wünschen oder diese plötzlich kennenlernen wollen. Rund 51% der Befragten meinten, dass Adoptionsvermittler (ab 16 Jahren) auf deren Wunsch hin alle ihnen zugänglichen Informationen geben sollten, 14% waren dagegen, 35% entschieden sich für "teils, teils". Fast 60% waren der Auffassung, dass Adoptionsvermittler alles in ihrer Kraft stehende tun sollten, um auf Antrag eines Adoptierten (ab 16 Jahren) dessen leibliche Eltern ausfindig zu machen; 5% antworteten mit "nein" und 35% mit "teils, teils". Hingegen meinten 29% der Fachkräfte, es sollte dem Ermessen der Adoptionsvermittlungsstelle vorbehalten sein, Kontakt mit den leiblichen Eltern herzustellen, wenn ein Adoptierter (ab 16 Jahren) dies wünscht; 43% waren dagegen.
Da britische und amerikanische, allerdings nichtrepräsentative Untersuchungen (Triseliotis 1973; Sobol und Cardiff 1983; Aumend und Barrett 1984) zu dem Ergebnis kamen, dass suchende Adoptierte im Vergleich zu nicht suchenden eher eine unbefriedigende Beziehung zu ihren Adoptiveltern haben und häufiger unter psychischen Problemen leiden, wurden bei unserer Studie auch Fragen nach den Meinungen bayerischer Adoptionsvermittler gestellt. Fast 91% der Befragten lehnten das Statement ab, dass die Suche eines Adoptierten nach seinen leiblichen Eltern ein Zeichen dafür ist, dass er mit den Adoptiveltern große Probleme (gehabt) hat; der Rest antwortete mit "teils, teils". Und 63% verneinten die Aussage, dass die Suche ein Zeichen von großen intrapsychischen Konflikten sei (4% bejahten sie, 33% wählten die Antwortalternative "teils, teils"). Fast 94% der Befragten betrachteten die Suche von Adoptierten nach ihren leiblichen Eltern als völlig normal. Anzumerken ist jedoch, dass 51% der Fachkräfte weniger als einmal und 44% zwischen ein- und sechsmal pro Jahr Kontakt zu älteren Adoptierten hatten - den erfassten Einstellungen liegen also nur wenige Erfahrungen zugrunde.
Haltung zu Auslandsadoptionen
Auslandsadoptionen werden in den letzten Jahren immer mehr kritisiert, weil in manchen Fällen illegale Wege beschritten (Kinderhandel, Bestechung, Urkundenfälschung) und Adoptionsvermittlungsstellen nicht eingeschaltet wurden, weil in ihnen eine neue Form der Ausbeutung der Dritten Welt gesehen oder mit negativen Folgen für die Identitätsentwicklung und Integration der betroffenen Kinder gerechnet wird. Bei unserer Untersuchung konnten hierzu eindeutige Einstellungen nicht ermittelt werden. So reagierten 66% der Befragten mit "teils, teils" auf das Statement: "Die Zahl von Auslandsadoptionen sollte verringert werden, da es ausländischen Kindern schwer fällt, sich in die deutsche Gesellschaft einzugliedern"; 14% bejahten und 21% verneinten es. Ebenfalls mit "teils, teils" antworteten 52% der Fachkräfte auf die Aussage, dass die Zahl von Auslandsadoptionen verringert werden sollte, da die Kinder in der eigenen Kultur bessere Entwicklungsmöglichkeiten haben; 25% stimmten mit "ja" und 23% mit "nein". Hingegen sprachen sich 67% der Befragten dagegen aus, dass die Zahl vergrößert werden sollte, da es in der Dritten Welt Millionen verhungernder und vernachlässigter Kinder gibt.
Eindeutiger ist hingegen die Ablehnung von Privatadoptionen, die z.B. in den USA sehr häufig sind. So lehnten 83% der Fachkräfte das Statement ab, dass Privatadoptionen und die Vermittlung von Adoptionen durch private Organisationen wie in anderen Ländern erlaubt und gesetzlich geregelt werden sollten; jeder zehnte Befragte stimmte der Aussage zu. Jedoch wurde nicht deutlich, wie Privatadoptionen und Kinderhandel am besten bekämpft werden könnten - 38% stimmten für hohe Strafen und 29% dagegen; 19% für mehr Vermittlungen durch anerkannte Adoptionsvermittlungsstellen und 57% dagegen; 25% für eine Erhöhung der Zahl der Inlandsadoptionen und 47% dagegen.
Schlussbemerkung
Unsere Untersuchung zeigt, dass sich die erfassten Einstellungen in der Regel über die gesamte Bandbreite der vorgegebenen Möglichkeiten verteilen, wobei die Unterschiede zumeist nicht auf Kriterien wie Geschlecht, Alter, Dauer der Tätigkeit im Adoptionswesen oder zeitlicher Umfang adoptionsspezifischer Aufgaben zurückgeführt werden konnten. Es ist zu fragen, ob die gezeigte Übereinstimmung professionellen Standards genügt oder nicht. Auf jeden Fall dürfte es sinnvoll sein, wenn 1. eindeutige, detaillierte und wissenschaftlich fundierte Kriterien für die Adoptionsvermittlung entwickelt würden, die als Orientierungsmaßstab dienen könnten, wenn 2. Adoptionsvermittler im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen und regionalen Arbeitskreisen mehr Gelegenheit zum Diskutieren und Hinterfragen ihrer Einstellungen geboten würde sowie wenn 3. Attitüden auch bei der Supervision stärker bewusst gemacht und besprochen würden.
Quelle
Aus: Soziale Arbeit 1992, 41, S. 116-121
Literatur
Aumend, S.A.; Barrett, M.C., 1984: Self-concept and attitudes toward adoption. A comparison of searching and nonsearching adult adoptees. Child Welfare 63, S. 251-259.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen Erziehungsbehörden, 1988: Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung. Köln: Selbstverlag, 2. Auflage.
Deutscher Caritasverband (Hrsg.), 1987: Erhebung werdende Mütter in Not- und Konfliktsituationen in katholischen Beratungsstellen. Zeitraum 1986. Freiburg: Selbstverlag.
Hoffmann-Riem, C., 1984: Das adoptierte Kind. Familienleben mit doppelter Elternschaft. München: Fink.
Irle, M., 1975: Lehrbuch der Sozialpsychologie. Göttingen, Toronto, Zürich: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe.
Kirk, H.D., 1981: Adoptive kinship. A modern institution in need of reform. Toronto: Butterworths.
Napp-Peters, A., 1978: Adoption. Das alleinstehende Kind und seine Familien. Geschichte, Rechtsprobleme und Vermittlungspraxis. Neuwied, Darmstadt: Luchterhand.
Sobol, M.P.; Cardiff, J., 1983: A sociopsychological investigation of adult adoptees' search für birth parents. Family Relations 32, S. 477-483.
Textor, M.R., 1988: Offene Adoption von Säuglingen. Unsere Jugend 40, S. 530-536.
Textor, M.R., 1989: Vergessene Mütter, die nicht vergessen können. Leibliche Eltern von Adoptivkindern. Neue Praxis 19, S. 323-336.
Textor, M.R., 1990: Die unbekannten Eltern. Adoptierte auf der Suche nach ihren Wurzeln. Zentralblatt für Jugendrecht 77, S. 10-14.
Textor, M.R., 1991: Auslandsadoptionen. Forschungsstand und Folgerungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 40, S. 42-49.
Triseliotis, J., 1973: In search of origins: The experiences of adopted people. London, Boston: Routledge & Kegan Paul