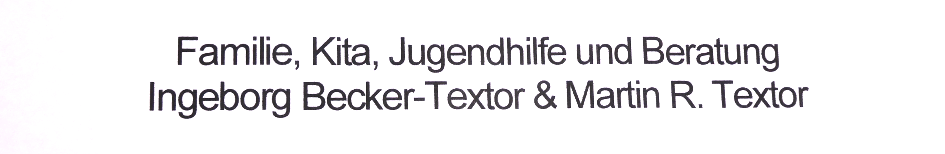Adoption: Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung - Teil 1
René A. C. Hoksbergen und Martin R. Textor (Hrsg.)
Freiburg: Lambertus 1993 - Online-Buch (Die nachfolgenden Texte können von der Printversion leicht abweichen)
Inhalt
Vorwort
Reinhart Lempp
Zur Einführung
René A.C. Hoksbergen, Martin R. Textor
Teil 1 Allgemeine Grundlagen
Zur Einführung
Das deutsche Adoptionsrecht: seine geschichtliche Entwicklung und seine gegenwärtige Ausgestaltung
Helga Oberloskamp
Das deutsche Adoptionswesen - am Beispiel einer bayerischen Untersuchung
Martin R. Textor
Teil 2 Forschungsstand
Zur Einführung
Inlandsadoptionen: Herkunft, Familienverhältnisse und Entwicklung der Adoptivkinder
Martin R. Textor
Auslandsadoptionen: Deutsche, niederländische und andere Forschungsergebnisse
René A.C. Hoksbergen
Medizinische Aspekte bei der Adoption fremdländischer Kinder
Tom Schulpen, Niels Sorgedrager
Teil 3 Fallbeispiele
Zur Einführung
Brief an meine Tochter
Eva Engelke
Aus dem Leben einer Adoptivtochter
Katrin Stoike
Ungewollt - unerwünscht. Geschichte einer gescheiterten Adoption
Leen Martens
Lernen, damit zu leben
René A.C. Hoksbergen, Wim Knappstein
Teil 4 Vor der Adoption: Vermittlung und Beratung (ab hier Teil 2)
Zur Einführung
Beratung ungewollt kinderloser Ehepaare
Joachim Arndt
Auswahl und Beratung von Adoptionsbewerbern
Bernward Gauly, Wieland Knobbe
Beratung für "abgebende Mütter" vor und nach der Freigabe des Kindes
Christine Swientek
Vermittlung älterer und behinderter Kinder
Volker Krolzik
Teil 5 Nach der Adoption: Nachbetreuung und Therapie
Zur Einführung
Voraussetzungen für die Beratung von Adoptiveltern nach erfolgter Adoption
Irmgard Schikorra
Betreuung von Adoptivfamilien nach Inlandsadoptionen
Gudrun Jänsch-Kraus
Auf der Suche nach den Eltern - auf der Suche nach Identität. Adoption - die unendliche Geschichte
Christine Swientek
Therapeutische Hilfe nach Auslandsadoptionen
Anny J. Bleeker-de Vries
Beratung von Adoptivfamilien. Die kinderpsychiatrisch-kinderpsychotherapeutische Perspektive
Margarete Berger
Teil 6 Anhang
Adoptionsrechtliche Bestimmungen
Literatur
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren
Vorwort
Reinhart Lempp
Das gemeinsame Heranwachsen einer jüngeren Generation mit der nächst älteren gehört zu den Grundvoraussetzungen der Entwicklung des Menschengeschlechts. Die jüngere lernt von der älteren, nicht nur durch Information und Nachahmung, sondern auch durch gegenseitige emotionale Beziehung, die sich aus dem gemeinsamen Leben heraus entwickelt. Kognitive Erfahrung und emotionales Erleben bilden für die heranwachsende Generation den Grundstock für ihre soziale Entwicklung, bis sie selbst ältere Generation geworden ist.
Natürlicherweise bilden die Eltern und ihre Kinder eine solche Zwei- oder Mehrgenerationengemeinschaft. Aber schon immer hat es Angehörige der älteren Generation gegeben, die keine Kinder, und Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Ein Zusammenleben von solchen genetisch nicht verwandten Angehörigen verschiedener Generationen gab es sicher, seit es menschliche Gemeinschaften gab - ihre rechtliche Anerkennung, die Adoption, gibt es schon seit dem Altertum.
Hierdurch fanden und finden zahllose elternlose Kinder Eltern und auch zahllose Eltern konnten sich den Wunsch nach einem Kind erfüllen. Die Lebensgemeinschaft genetisch nicht verwandter Eltern und Kinder, manchmal neben den verwandten Kindern, ist aber nicht immer problemlos. Auch wenn sie für viele das Glück bedeuten, erfahren wir von den Problemen eher als von dem Glück. Die Probleme rühren unter anderem von wechselnden wissenschaftlichen Auffassungen her. In einer Zeit, in der die Abstammungslehre dominierte, neigte man zu Misstrauen gegenüber dem meist unbekannten Erbgut der Kinder und verschwieg die Tatsache der Adoption soweit wie möglich. In der Zeit des naiven Glaubens an die allein entscheidende Allmacht der prägenden Umwelt übersah man manchmal die charakterliche Eigenart des Kindes oder versuchte, sie mit erzieherischen Mitteln zu überwinden. Es brauchte Zeit, um beides nebeneinander zu akzeptieren: die Anlage wie das Milieu, die Anerkennung der Eigenart wie die Wirkung der Prägung.
War die Tatsache der Adoption lange ein streng gehütetes Geheimnis gegenüber Bekannten, Freunden, ja selbst gegenüber dem Kinde, so ist man heute offener geworden - nicht nur da, wo die Annahme an Kindes Statt aufgrund der anderen Hautfarbe der Kinder ohne Erläuterung offensichtlich ist. Auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Oktober 1989 macht jetzt die Offenbarung der leiblichen Abkunft gegenüber dem Kinde zur Pflicht. Das bedeutet - entgegen mancher Meinung - nicht, dass die psychologisch-soziale Elternschaft nicht immer noch die Grundlage einer gesunden psychosozialen Entwicklung wäre, sondern es bedeutet, dass neben der emotionalen Beziehung zwischen den sozialen Eltern und dem Kind auch die Kenntnis von den eigenen genetischen Wurzeln in der Reifeentwicklung zur Identitätsfindung notwendig ist.
Auch die zur Adoption notwendige bewusste Entscheidung der leiblichen Mutter für das Kind kann im Einzelfall zum Problem werden, wenn dieser Entschluss später bereut wird.
Für diese größeren oder kleineren Probleme gibt das hier vorliegende Buch auf großer Erfahrung beruhende Hilfen - für die Vermittler, Berater und Betreuer von adoptionswilligen Eltern und solchen, die ein Kind angenommen haben.
Zur Einführung
René A.C. Hoksbergen, Martin R. Textor
Die Adoption ist neben der Fortpflanzung die bedeutendste Form der Familiengründung. Sie ist ein gesellschaftlich anerkannter Weg zur Konstituierung von Eltern-Kind-Beziehungen. Es handelt sich bei ihr nicht um einen einmaligen Akt der Annahme eines nicht leiblichen Kindes, sondern um einen langfristigen Prozess, der das ganze Leben der Adoptiveltern und -kinder sowie der biologischen Eltern prägt.
Die Adoption steckt voller Widersprüche: Beispielsweise wollen die leiblichen Eltern oft ihr Kind behalten, können es aber nicht aufziehen; die Adoptiveltern wollen das Kind zu ihrem eigenen machen, wissen aber, dass sie es nicht gezeugt und geboren haben; die Adoptivkinder lieben ihre Adoptiveltern, interessieren sich aber auch für ihre leiblichen Eltern. Aus diesen Widersprüchen, aber auch aus anderen adoptionsspezifischen Problemen, ergibt sich ein großer Beratungsbedarf, der erst in den letzten Jahren erkannt wurde.
Auch die Vermittlung von Adoptivkindern hat sich als ein sehr komplexer Prozess entpuppt. Das Kind, die Herkunftsfamilie, die Adoptivfamilie, die Adoptionsvermittlungsstelle, das Vormundschaftsgericht und häufig soziale, psychologische und medizinische Dienste spielen hierbei eine Rolle. An die Fachkräfte werden in den meisten Fällen sehr hohe Anforderungen gestellt.
Trotz der mit Adoptionsvermittlung verbundenen Schwierigkeiten und trotz der Probleme, die häufig bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern und -kindern auftreten, mangelt es an einem Handbuch für die in diesem Bereich tätigen Fachkräften. Dieser Situation soll mit dem vorliegenden Sammelband abgeholfen werden, der Grundlageninformation, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Berichte über eine zeitgemäße Praxis im Adoptionsbereich miteinander verknüpft. Es soll zugleich Studierenden und Berufsanfängern zur grundlegenden Orientierung dienen.
Im ersten Teil des Handbuches wird zum einen ein Überblick über die historische Entwicklung des Adoptionsrechts und wichtige gesetzliche Regelungen gegeben. Zum anderen werden anhand empirischer Daten aus dem Jahr 1990 ausgewählte Aspekte des Adoptionswesens von heute wissenschaftlich beleuchtet. Im zweiten Teil werden Forschungsergebnisse über die Entwicklung einheimischer und ausländischer Adoptivkinder referiert; dabei wird oft auf Untersuchungen aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden und anderen Staaten zurückgegriffen, da in der Bundesrepublik Deutschland bisher nur einige wenige Studien durchgeführt wurden. In einem weiteren Kapitel wird den medizinischen Aspekten bei Auslandsadoptionen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Im dritten Teil des Handbuches wird die Situation von Adoptivfamilien und Adoptierten anhand authentischer Berichte beziehungsweise einiger Fallbeispiele geschildert. Neben geglückten werden auch gescheiterte Adoptionen dargestellt. Im vierten und fünften Teil werden erprobte, aber erst von wenigen Adoptionsvermittlungsstellen praktizierte Methoden der Beratung ungewollt kinderloser Ehepaare sowie der Vorbereitung von Adoptionsbewerbern und der Nachbetreuung von Adoptivfamilien beschrieben. Außerdem wird dargestellt, welche Aufgaben und Probleme mit der Vermittlung ausländischer sowie älterer und behinderter Kinder verbunden sind und welche Beratungsmaßnahmen für hilfsbedürftige Adoptivfamilien von Nutzen sein können. Im sechsten Teil finden sich wichtige Gesetzestexte und das Literaturverzeichnis.
In allen Kapiteln wird bei Begriffen wie "Adoptionsvermittler", "Annehmende" oder "Sozialarbeiter" möglichst immer der Plural verwendet. Damit soll angedeutet werden, dass mit diesen Begriffen immer sowohl Frauen als auch Männer gemeint sind. Ließ sich der Singular nicht vermeiden, wurde zumeist die männliche Form verwendet - der besseren Lesbarkeit wegen, da Formulierungen wie "der/die Sozialarbeiter/in" oder der/die AdoptionsvermittlerIn" bei längeren Texten leicht den Lesefluss stören. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Teil 1
Allgemeine Grundlagen
Das deutsche Adoptionsrecht: seine geschichtliche Entwicklung und seine gegenwärtige Ausgestaltung
Helga Oberloskamp
(Neuere Gesetzesänderungen sind nicht berücksichtigt, z.B. zur Rechtsstellung des Vaters eines nicht ehelichen Kindes!)
Bereits das Römische Recht (zu den Einzelheiten siehe Sohm/Mitteis/Wenger 1949: 89) kannte die Adoption. Vor Justinian (527-565 n.Chr.) war sie eine so genannte "adoptio plena", das heißt, eine Adoption, die mit allen Folgen einer Kindschaft ausgestattet war (insbesondere mit der "patria potestas"). Seit Justinian erzeugte die "datio in adoptionem" nur noch ein Kindeserbrecht (Intestaterbrecht) gegen den Adoptivvater, dagegen kein Kindesverhältnis mehr. Dies war die so genannte "adoptio minus (quam) plena". Frauen konnten nach römischen Recht nicht adoptieren.
Über das Gemeine Recht, also über das seit dem Ende des Mittelalters in Deutschland rezipierte römische und mit kanonischen und germanischen Elementen vermischte Recht, fand die Adoption als "adoptio minus plena" Eingang in alle großen europäischen Gesetzeswerke. Im Preußischen Allgemeinen Landrecht (Teil II, 2. Titel, 10.-12. Abschnitt - PrALR) von 1794 wurden neben der vertraglich zu begründenden und wieder aufhebbaren Adoption die Institute der "Pflegekindschaft" und der "Einkindschaft" (Stiefkindschaft) zur Verfügung gestellt.
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in der Fassung, die am 1. Januar 1900 in Kraft trat, regelte die Annahme an Kindes statt als ein familienrechtliches Verhältnis, das durch einen autonomen Akt der Beteiligten unter bloßer Rechtskontrolle des Staates mit beschränkten Wirkungen geschaffen und auf gleiche Weise wieder aufgehoben werden konnte (Bosch 1984: 830-834).
Erste Reformbestrebungen setzten bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein, brachten aber noch keine Änderungen in den Rechtsgrundlagen. Jedoch entwickelten sich - allerdings ohne rechtliche Grundlage - erste Ansätze einer fachlichen Adoptionsvermittlung.
So richtete 1911 die Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge in Berlin eine Adoptionsabteilung ein (Jans/Happe/Saurbier 1988: Anhang 1 zu § 48a Vorbemerkung 3Aa), und der Verein für Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege in Düsseldorf installierte 1913 eine Adoptionsvermittlungsstelle (Engler 1972: 116-122). Die einzelnen Reformschritte von 1933 bis 1976 im Hinblick auf das materielle Adoptionsrecht sind dargestellt bei Lüderitz (1991: vor § 1741, RdNr. 13) und die des Adoptionsvermittlungsrechts bei Oberloskamp (in Druck: vor § 1 AdVermiG RdNr. 5).
Am 24. April 1967 zeichnete die Bundesrepublik Deutschland das Europäische Übereinkommen über die Adoption von Kindern (BGBl. 1980 II 1094; dazu Oberloskamp 1982: 121-125) bei seiner Verabschiedung durch den Europarat und setzte sich damit das Ziel, die in dem Abkommen enthaltenen internationalen Mindeststandards zu erfüllen. Mit der Verabschiedung des Adoptionsgesetzes vom 2. Juli 1976 und des Adoptionsvermittlungsgesetzes vom 2. Februar 1976 wurden diese Standards in nationales Recht umgesetzt, sodass sie das Abkommen ratifizieren und am 11.2.1981 in Kraft setzen konnte (Bekanntmachung über das In-Kraft-Treten des Europäischen Übereinkommens über die Adoption von Kindern vom 21.1.1981 - BGBl. 1981 II 72).
Seit dem 1. Januar 1977 sind also das Adoptionsgesetz und das Adoptionsvermittlungsgesetz in Kraft; sie sind auszugsweise im Anhang dieses Sammelbandes abgedruckt. Allerdings sind sie mittlerweile durch eine Reihe von Reformen in einzelnen Punkten überholt und ergänzt worden, die Details sind bei Lüderitz (1991: vor § 1741, RdNr. 30) nachzulesen.
Kernpunkte der Reform von 1976 waren die Folgenden: Das einzige Ziel der Adoption liegt darin, Kindern Eltern zu verschaffen. Deswegen steht das Kindeswohl-Gebot an erster Stelle (§ 1741 Abs. 1 BGB). Alle anderen Vorschriften ordnen sich diesem Gebot unter. Da die Adoption kein Vertrag ist, der dem Partnerwillen untersteht, sondern ein statusbegründender Akt, ist eine Aufhebung nur sehr eingeschränkt möglich. Durch die Adoption erwirbt das Kind die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes, mit allen Folgen, die eine eheliche Kindschaft mit sich bringt (Name, elterliche Sorge, Unterhalt, Erbrecht). Auch im öffentlichen Recht (Sozialleistungsrecht, Steuerrecht) hat der Adoptierte die Position eines leiblichen ehelichen Kindes. Damit das Kindeswohl-Ziel erreicht werden kann, darf die Adoptionsvermittlung keine Privatsache sein, sondern muss staatlich kontrolliert werden. Deswegen haben die kommunalen Jugendämter und die staatlich anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen ein Vermittlungsmonopol. Verstöße dagegen sind strafbare Handlungen bzw. Ordnungswidrigkeiten.
1. Die Ausgestaltung des geltenden Adoptionsrechts
Der Gesetzgeber ist der Meinung, dass es für ein elternloses Kind in der Regel das Beste ist, in eine vollständige Familie mit Vater und Mutter zu kommen. Deshalb steht an der Spitze der potentiellen Annehmenden ein Ehepaar (§ 1741 Abs. 2 S. 1 BGB), das grundsätzlich nur gemeinschaftlich annehmen kann. Künstliche Stiefkindverhältnisse sollen nicht geschaffen werden. In eindeutig beschriebenen Ausnahmesituationen kommt auch die Annahme durch einen Ehepartner allein in Betracht:
(a) Wenn ein verheirateter Elternteil sein eigenes nichteheliches Kind adoptiert, um ihm die Stellung eines ehelichen zu verschaffen; in diesem Fall wird kein Stiefkindverhältnis geschaffen, es ist durch die Ehe bereits da (Abs. 2 S. 2 Alt. 1);
(b) wenn ein verheirateter Elternteil das Kind seines Ehepartners, also sein Stiefkind annimmt; dann wird das Stiefkindverhältnis beseitigt (Abs. 2 S. 2 Alt. 2);
(c) wenn von einem Ehepaar der eine aus Rechtsgründen nicht adoptieren kann, nämlich weil er geschäftsunfähig ist (Abs. 2 S. 3 Alt. 3) - eine beschränkte Geschäftsfähigkeit gibt es außer bei Minderjährigkeit seit Abschaffung der Entmündigung am 1. Januar 1992 nicht mehr (die beschränkte Geschäftsfähigkeit wegen Minderjährigkeit kann hier wegen § 1743 BGB aber nicht gemeint sein); dies könnte - ohne Schaden für das Kind - zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein Elternteil nach einem Verkehrsunfall im Koma liegt.
Nicht möglich ist die gemeinsame Kindesannahme durch Geschwister, durch Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder durch Partner einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft (Lüderitz 1991: § 1741 RdNr. 33). Ob die Ehepartner in einer verwandtschaftlichen Beziehung zum Kind stehen, spielt keine Rolle; so ist beispielsweise die Annahme durch Großeltern, Tante/Onkel oder Bruder/Schwägerin möglich.
Bei einer Nichtehelichen-Adoption oder einer Stiefkindadoption ist die Kindeswohl-Prüfung genauso vorzunehmen, wie wenn fremde Kinder adoptiert werden. Gegebenenfalls bestehen gegen die erstgenannten Formen von Adoptionen mehr Bedenken als sonst, weil im ersten Fall das Kind einen ganzen Elternstamm ersatzlos verliert und weil im zweiten Fall dem Kind ein oftmals durchaus vorhandener und sogar interessierter Elternteil weggenommen und gegen einen unter Umständen nur dem leiblichen Elternteil genehmen neuen Elternteil ausgetauscht werden soll. In der Praxis machen allerdings die Stiefkindadoptionen mehr als 50% aller Adoptionen aus. Dass dies die Intention des Gesetzgebers gewesen ist, ist kaum anzunehmen. Erstrebenswert wäre es, Stiefeltern andere Möglichkeiten der Regelung ihrer Rechtsbeziehungen zum Stiefkind zu geben.
Neben der Adoption durch ein Ehepaar ist auch die Annahme durch eine nicht verheiratete Person möglich (§ 1741 Abs. 3 S. 1). Diese kann ein fremdes oder ihr eigenes nichteheliches Kind adoptieren.
Weder wenn der Adoptierende verheiratet noch wenn er ledig ist, kann er sein eigenes eheliches Kind annehmen. Dies ist zwar verschiedentlich versucht worden, wohl immer, um einen geschiedenen Ehepartner aus der Verwandtschaft zu seinem Kind herauszudrängen. Die Rechtsprechung (OLG Hamm vom 13.6.1978, FamRZ 1978, 735) hat dies jedoch wegen des eindeutigen Wortlauts des Gesetzes nicht zugelassen.
Adoptierte Kinder können in der Regel ebenfalls nicht ein zweites Mal angenommen, also erneut adoptiert werden. Vier Ausnahmen sieht das Gesetz allerdings vor:
(a) Die Erstadoptiveltern sind gestorben. Dann kann das Adoptivkind wie ein "normales" Waisenkind von einem anderen Ehepaar angenommen werden. Möglich ist die Adoption auch dann, wenn nur ein Adoptivelternteil stirbt, der Überlebende erneut heiratet und der neue Partner dann das Adoptivkind adoptieren möchte.
(b) Die Erstadoption ist aufgehoben worden. Dann ist das Kind kein Adoptivkind mehr und kann erneut adoptiert werden.
(c) Das Kind ist zunächst von einer Person alleine adoptiert worden (nichtehelicher leiblicher Elternteil; Lediger; nur ein Ehepartner konnte adoptieren); später will sein Ehepartner ebenfalls das Kind annehmen.
(d) Das Adoptivkind soll wieder seinen leiblichen Eltern zugeordnet werden (nach Scheidung der Eltern adoptiert ein Stiefelternteil. Nach erneuter Scheidung heiraten die leiblichen Eltern wieder).
2. Adoptionsvoraussetzungen zum Schutz des Kindes
Die wichtigste Voraussetzung für eine Adoption wurde bereits genannt: Die Annahme muss dem Kindeswohl dienen (§ 1741 Abs. 1 BGB). Hierzu hat sich nicht nur die Adoptionsvermittlungsstelle (§ 56d FGG) bzw. das Jugendamt als Fachbehörde (§ 49 Abs. 1 FGG), sondern im Zweifel auch ein psychologischer oder sonstiger Sachverständiger gutachtlich zu äußern.
Ferner muss ein Eltern-Kind-Verhältnis entstehen. In diesem Rahmen spielen eine Rolle: der Eltern-Kind-gerechte Altersabstand, die Bindungsfähigkeit und die Belastbarkeit der Adoptiveltern, ihre Einstellung zu Kindern und die Begründung ihres Adoptionswunsches. Beide Voraussetzungen, Kindeswohl und Eltern-Kind-Verhältnis, lassen sich einerseits vielfach schwer voneinander abgrenzen, räumen andererseits dem Rechtsanwender (Sozialarbeiter, Vormundschaftsrichter) einen relativ großen Handlungsspielraum ein.
In der Praxis sind unter anderem folgende Gründe für die Verweigerung einer Adoption relativ häufig vorgekommen (Napp-Peters 1978: 311): Krankheit oder Behinderung eines Bewerbers; fehlende wirtschaftliche Absicherung; Berufstätigkeit; zu starke Bindung an ein verstorbenes Kind; Eheschwierigkeiten; starke Fixiertheit der Bewerber; Vorstrafen; fehlende Bereitschaft zur Kooperation mit Behörden; uneingestandene egoistische Motive.
Eine vom Gesetz ausdrücklich hervorgehobene Ausprägung des Grundsatzes, dass ein Eltern-Kind-Verhältnis entstehen soll, findet sich in der Vorschrift, die sich mit dem Alter der Annehmenden beschäftigt (§ 1743 BGB). Hier ist zu unterscheiden, ob es sich um ein eigenes oder ein fremdes Kind handelt: Beim eigenen Kind ist das Alterserfordernis 21 Jahre, beim fremden Kind 21/25 (Ehepaar) oder 25 Jahre (Lediger). Damit soll verhindert werden, dass nicht genügend überlegt adoptiert wird. Dieses Ziel, so gut es ist, führt bei der Adoption von eigenen oder Stiefkindern zu seltsamen Ergebnissen: Abgesehen davon, dass es einem freisteht, Kinder "in die Welt zu setzen", unabhängig davon, wie alt man ist, und dass man als verheiratetes Elternpaar ab Volljährigkeit die volle Verantwortung für die Kinder hat, kann ein Vater sein eigenes nichteheliches Kind bereits als Minderjähriger für ehelich erklären lassen - etwas, was der Mutter verwehrt ist. Hier sollte der Gesetzgeber für sinnvollere und gerechtere Altersgrenzen sorgen.
Eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht. Hier sorgt die Voraussetzung des Eltern-Kind-Verhältnisses für einen Ausgleich. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass kein Großeltern-Kind-Verhältnis entsteht.
Dem Schutz des Kindes dient auch die Voraussetzung, dass die Einwilligung des Kindes in seine Annahme erforderlich ist. Diese ist bei Kindern unter 14 Jahren nur durch den gesetzlichen Vertreter zu erklären, bei Kindern über 14 Jahren durch das Kind persönlich, mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Die Einwilligungen bedürfen der notariellen Beurkundung und müssen dem Vormundschaftsgericht gegenüber erklärt werden (§ 1750 Abs. 1 S. 1 BGB). Sie werden wirksam mit Zugang (§ 1750 Abs. 1 S. 2 BGB). Sie sind bedingungs- und befristungsfeindlich (§ 1750 Abs. 2 S. 1 BGB), nur die Einwilligung des Kindes kann widerrufen werden (§ 1750 Abs. 2 S. 2, § 1746 Abs. 2 BGB). Wenn das Kind, das einwilligen muss, nicht adoptiert werden will, ist eine Adoption unmöglich.
Bei der erforderlichen Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ist zu unterscheiden: Sind beim ehelichen Kind noch beide Eltern gesetzliche Vertreter (§§ 1626, 1629 BGB) oder ist beim nichtehelichen Kind die Mutter gesetzliche Vertreterin (§§ 1705, 1707 BGB), so ist eine Ersetzung der Einwilligung gemäß § 1666 BGB wegen Missbrauchs des Sorgerechtes oder wegen unverschuldeten Versagens möglich (abweichende Auffassung bei Lüderitz 1991: § 1746 RDNr. 7, der über § 1746 BGB - dazu im Text unten - die Einwilligung nach § 1746 BGB wegen § 1751 Abs.1 S.1 HS 1 BGB mit ersetzt sein lässt; im Ergebnis dürfte kein Unterschied sein, da die Tatbestände von § 1748 BGB und § 1666 BGB sich decken.).
Ist ein Vormund oder Pfleger gesetzlicher Vertreter, so ist die Einwilligung durch das Vormundschaftsgericht ersetzbar, sofern der Vormund oder Pfleger keinen triftigen Grund für seine Weigerung hat (§ 1746 Abs. 3 BGB; ungeklärte Vaterschaft ist beispielsweise kein triftiger Grund, LG Ellwangen vom 4.1.1988, DAVorm 1988, 309). Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur Einwilligung des Kindes über 14 Jahre bedarf keiner Form. Auch diese Zustimmung kann auf dem beschriebenen Weg ersetzt werden.
Formaljuristisch ist der Wille des Kindes unter 14 Jahren bedeutungslos. Aus den verfahrensrechtlichen Anhörungsvorschriften (§ 55c FGG in Verbindung mit § 50b Abs. 1 FGG) ergibt sich jedoch, dass das Gericht auch solche Kinder in einem Verfahren, das die Personensorge betrifft, persönlich anhört (und sich einen Eindruck von dem Kind verschafft), "wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind" (§ 50b Abs. 1 FGG). Das wird bei Adoptionsverfahren so gut wie immer der Fall sein. Deshalb wird auch der Wille eines jüngeren Kindes Berücksichtigung finden.
Die faktisch wichtigste Voraussetzung im Interesse des Kindes ist die vorausgehende angemessene Adoptionspflegezeit (§ 1744 BGB). Sie dient der Prüfung, ob eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung entsteht. Seit die Kindesannahme eine Volladoption ist und eine Aufhebung folglich nur in seltenen Ausnahmefällen möglich ist, soll das Kind noch mehr als früher vor Fehlentscheidungen bewahrt werden. Das Gesetz spricht von "angemessener" Dauer der Pflegezeit. Dieser unbestimmte Gesetzesbegriff muss pflichtgemäß von der Adoptionsvermittlungsstelle und dem Gericht ausgefüllt werden. Beim eigenen nichtehelichen oder beim Stiefkind kann sie auf Null schrumpfen; beim Säugling und gesunden Kleinkind wird sie kürzer als beim älteren, behinderten oder gestörten Kind sein.
Handelt es sich um ein für die Adoptionsbewerber fremdes Kind, so ist dieses in dieser Phase Pflegekind im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG = SGB VIII). Demnach benötigen die Adoptiveltern in der Regel eine Pflegeerlaubnis (§ 44 Abs. 1 KJHG). Während dieser Pflegezeit sind die rechtlichen Kompetenzen der Pflegeeltern unterschiedlich, je nachdem, ob die leiblichen Eltern noch das Sorgerecht haben - zum Beispiel während der ersten acht Wochen nach der Geburt, § 1747 Abs. 3 BGB, oder wenn ein Ersetzungsverfahren gemäß § 1748 BGB läuft - oder nicht mehr (Entzug gemäß § 1666 BGB oder Einwilligung, § 1751 Abs. 1 BGB). Auch wenn die Bewerber weder Vormund noch Pfleger sind - was rechtlich möglich wäre -, stehen ihnen im Zweifel, also wenn nichts anderes vereinbart oder angeordnet ist, die "Alltagsrechte" aus § 38 KJHG zu.
3. Adoptionsvoraussetzungen zum Schutz der Annehmenden und ihrer Angehörigen
Dass die Adoptionsbewerber die Adoption wollen müssen, versteht sich von alleine. Ihre Willensäußerung, die ebenfalls notariell beurkundet sein muss, muss als Antrag dem Vormundschaftsgericht zugehen. Dieser ist bedingungs- und befristungsfeindlich (§ 1752 BGB). Bis zum Ausspruch der Adoption durch den Richter kann er widerrufen werden.
Obwohl die Adoption nicht nur Rechtsbeziehungen zu den Annehmenden selber, sondern zu ihrer gesamten Verwandtschaft knüpft, werden diese Personen nicht um ihre Zustimmung gebeten. Nicht einmal Großeltern, die nicht selten unterhaltspflichtig werden können, haben ein Mitspracherecht. Hat der Annehmende jedoch einen Ehegatten, der selber nicht adoptiert, so muss dieser - außer bei Geschäftsunfähigkeit und dauernder Abwesenheit - wenigstens seine Zustimmung geben (§ 1749 BGB). Diese erforderliche Einwilligung kann bei Verweigerung ersetzt werden, es sei denn, berechtigte Interessen des anderen Ehegatten oder dessen Familie stehen der Annahme entgegen.
Die Kinder der Annehmenden werden zwar nicht gefragt, ob sie mit einer geplanten Adoption einverstanden sind. Ihre Interessen sind jedoch vom Gericht zu berücksichtigen (§ 1745 BGB). In diesem Rahmen ist etwa von Bedeutung, dass ein schon vorhandenes Kind der Annehmenden besonderer Zuwendung bedarf und diese bei der Adoption eines weiteren Kindes gefährdet wäre.
4. Adoptionsvoraussetzungen zum Schutz der leiblichen Eltern
In der Regel müssen die leiblichen Eltern des ehelichen Kindes, muss die Mutter des nichtehelichen Kindes mit der Adoption einverstanden sein. Das Gesetz spricht von Einwilligung, die Praxis von der "Freigabe eines Kindes". Sicher ist, dass dieses geforderte Einverständnis nichts mit dem des gesetzlichen Vertreters (§ 1746 BGB) zu tun hat. Auch Eltern, die nicht oder insoweit nicht gesetzliche Vertreter sind, wird eine Einwilligung abverlangt, weil sie im natürlichen Sinne, im Sinne des Art. 6 Grundgesetz (GG) Eltern (geblieben) sind. Daher muss auch die Mutter eines nichtehelichen Kindes, wo als gesetzlicher Vertreter der Amtspfleger (§§ 1706 Nr. 1, 1709 BGB) in die Adoption einwilligt, und der Vater, dem das Sorgerecht entzogen worden ist (§ 1666 BGB oder § 1671 BGB), das Kind "freigeben".
Ist der Einwilligende minderjährig, so braucht er gleichwohl nicht die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters (§ 1750 Abs. 3 BGB). Ist er geschäftsunfähig oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt, so entfällt das Erfordernis gänzlich (§ 1747 Abs. 4 BGB). Wird die Einwilligung abgegeben, so ist sie notariell zu beurkunden und dem Vormundschaftsgericht gegenüber zu erklären. Mit Zugang bei Gericht ist sie unwiderruflich (§ 1750 Abs. 1 und 2 S. 2 BGB).
Gegenüber den anderen, oben beschriebenen Einwilligungen sind bei den leiblichen Eltern einige Besonderheiten zu beachten: Die Einwilligung kann frühestens acht Wochen nach der Geburt erteilt werden (§ 1747 Abs. 3 S. 1 BGB). Dies dient dem Schutz der Mutter, die sich zunächst von den Belastungen der Entbindung erholen soll, bevor sie eine so weitreichende Entscheidung trifft. Trotz dieses dahinter stehenden Gedanken, der eindeutig Mütter meint, lässt es das Gesetz nicht zu, Väter von dieser Frist auszusperren. Bei ehelichen Kindern haben sie also auch eine Überlegungsfrist.
Trotz dieses relativ späten Zeitpunktes der Einwilligung kann ein Kind, das seine Mutter nicht behalten will, schon sofort nach der Geburt in eine Adoptionspflegestelle gegeben werden. Die Bewerber sollten dann nur unmissverständlich darüber belehrt werden, dass die leibliche Mutter rechtlich das Sorgerecht hat und gegebenenfalls verlangen kann, das Kind herauszugeben.
Die Einwilligung der leiblichen Eltern kann nur in Bezug auf einen bestimmten Adoptionsbewerber bzw. -paar erklärt werden; eine so genannte Blankoeinwilligung ist unzulässig (Argument aus § 1750 Abs. 3: "die schon feststehenden Annehmenden"). Dagegen brauchen die leiblichen Eltern die Annehmenden nicht zu kennen (so genannte Inkognito-Adoption, § 1750 Abs. 3 BGB). Es genügt, dass sie beim Notar ihre Einwilligung zu der Adoption durch die Bewerber, "die in der Liste der Adoptionsvermittlungsstelle X unter der Nr. Y geführt werden", erklären. Inkognito-Adoption bedeutet nur, dass die Abgebenden den Namen der Annehmenden nicht kennen - aber nicht umgekehrt.
Zwar darf eine Einwilligung nicht bedingt sein (§ 1750 Abs. 2 S. 1 BGB), also von einem zukünftigen ungewissen Ereignis abhängig gemacht werden (§ 1758 BGB). Dies bedeutet aber nicht, dass die Abgebenden ihre Zustimmung nicht auf einen bestimmten Personenkreis beschränken können (Lüderitz 1991, § 1747 RdNr. 16; Diederichsen 1992, § 1747 Anm. 3). Die Abgebenden könnten sich daher beispielsweise wünschen, dass die Annehmenden evangelisch sein sollen.
Die "Freigabe" des Kindes ist verbraucht, wenn das Kind adoptiert wird. Kommt eine Adoption nicht zustande, so kann die Einwilligungserklärung nicht unbeschränkt Wirksamkeit behalten. Das Gesetz bestimmt daher, dass dann, wenn ein Adoptionsantrag gar nicht gestellt wird, wenn er gestellt, aber zurückgenommen wird, oder wenn er gestellt, aber vom Richter abgelehnt wird, die Einwilligung unwirksam wird (§ 1750 Abs. 4, S. 1, 2 BGB). Sie wird auch dann unwirksam, wenn sie angefochten wird - zum Beispiel wegen Irrtums oder arglistiger Täuschung. Das Kraftloswerden tritt in dem jeweiligen Zeitpunkt ein; lediglich in der ersten Konstellation musste der Gesetzgeber eine Frist (von drei Jahren) vorsehen für den Fall, dass Bewerber einfach untätig bleiben und nicht ausdrücklich kundtun, dass sie doch nicht adoptieren, sondern das Kind zum Beispiel als Pflegekind behalten wollen.
Ist die Einwilligung eines Elternteils nötig, verweigert dieser aber die "Freigabe", so ist zu prüfen, ob das Gericht sie ersetzen kann. Das Gesetz (§ 1748 BGB) sieht diese Möglichkeit auf Antrag des Kindes in vier Fällen vor:
(a) Bei anhaltend gröblicher Pflichtverletzung gegenüber dem Kind und einem unverhältnismäßigen Nachteil für das Kind, wenn die Annahme unterbleiben muss (Abs. 1 S. 1 Alt. 1),
- bei Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind und einem unverhältnismäßigen Nachteil für das Kind, wenn die Annahme unterbleiben muss (Abs. 1 S. 1 Alt. 2);
(b) bei besonders schwerer Pflichtverletzung und wenn das Kind voraussichtlich dauernd nicht mehr der Obhut des Elternteils anvertraut werden kann (Abs. 1 S. 2 Alt 3.);
(c) bei dauernder Unfähigkeit zur Pflege und Erziehung des Kindes, verursacht durch eine besonders schwere psychische Krankheit oder eine besonders schwere geistige Behinderung, und wenn das Kind bei Unterbleiben der Annahme nicht in einer Familie aufwachsen könnte und dadurch in seiner Entwicklung schwer gefährdet wäre (Abs. 3 Alt. 4).
Soll die Einwilligung wegen Gleichgültigkeit ersetzt werden, so darf dies nur geschehen, wenn die Eltern
(a) darüber beraten worden sind, welche Hilfen es gibt, um eine Wegnahme des Kindes zu verhindern,
(b) belehrt worden sind, dass die Möglichkeit der Ersetzung besteht, falls sie ihr Verhalten nicht ändern, und wenn
(c) seit der Belehrung mindestens drei Monate verstrichen sind, ohne dass die Eltern ihr Verhalten geändert hätten (§ 1748 Abs. 2, S. 1 BGB).
Haben die Eltern sich "abgesetzt", ohne dass ihr Aufenthalt bekannt ist, so ist die Belehrung nicht nötig. Die Frist läuft dann an, wenn das Jugendamt beraten hat oder mit den Nachforschungen beginnt (§ 1748 Abs. 2 S. 2 BGB).
Wenn die Eltern ihre Einwilligung abgegeben haben oder wenn sie gerichtlich ersetzt worden ist, treten verschiedene Rechtswirkungen ein, die das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kind lockern und erste Rechtsbeziehungen zwischen Annehmenden und Kind knüpfen. In diesem Stadium ist das Jugendamt in die Beziehung "eingespannt" (§ 1751 BGB): Die elterliche Sorge des Elternteils, der eingewilligt hat, ruht; er hat auch kein Umgangsrecht mehr. An die Stelle der leiblichen Eltern rückt das Jugendamt als Amtsvormund. Eine vorhandene Pflegschaft, meistens die Amtspflegschaft des nichtehelichen Kindes (§§ 1706, 1709 BGB), bleibt bestehen. Der Annehmende wird dem Kind vor den Verwandten des Kindes unterhaltspflichtig, sobald sich das Kind in seiner Obhut befindet. Diese Folgen treten sein, wenn beide Eltern - sofern nötig - eingewilligt haben und wenn es sich nicht um Stiefkindadoptionen handelt. Für die letztgenannten Konstellationen gelten Sonderregelungen (Abs. 1 S. 2, Abs. 2, Abs. 4 S. 2).
5. Adoptionsrechtliche Aspekte zum Schutz des leiblichen Vaters eines nichtehelichen Kindes
Der Vater eines nichtehelichen Kindes wird vom Grundgesetz nicht als vollwertiger Vater angesehen. Dies spiegelt sich in seiner Rechtsstellung im Adoptionsrecht wieder. Im engen Rechtssinne wird er "nicht gefragt", das heißt, seine Einwilligung in die Adoption seines Kindes ist nicht erforderlich (Argument aus § 1747 Abs. 2 BGB). Selbst wenn er ausdrücklich erklärt, dass er gegen eine Kindesannahme durch den Stiefvater ist, verhindert dies nicht automatisch die Adoption. Der Vormundschaftsrichter muss dies nur bei seinen Amtsermittlungen (§ 12 FGG) zur Kenntnis nehmen und im Rahmen der Kindeswohlprüfung die nötigen Folgerungen daraus ziehen. Allerdings hat der nichteheliche Vater ein zwar der Mutter nachgeordnetes, jedoch Drittbewerbern vorgehendes Adoptions- oder Legitimationsrecht (§ 1747 Abs. 2 S. 2 BGB). Das bedeutet, dass der Vater die Adoption durch die Mutter nicht verhindern kann, jedoch einen eigenen Adoptions- oder Legitimationswunsch vorrangig anmelden kann, wenn Dritte das Kind adoptieren wollen. Auch in diesem Fall wird selbstverständlich geprüft, ob der Vater sich hierfür eignet und des Kindes Zuordnung zu ihm dessen Wohl dient. Ferner muss auch bei dieser Konstellation die Mutter einwilligen. Ist diese mit Adoption oder Ehelicherklärung durch den Vater des Kindes nicht einverstanden (und sei es aus Rache), so wird dies seine Bemühungen blockieren - es sei denn, der Mutter ist ein Fehlverhalten dem Kind gegenüber anzulasten, das so schwer wiegt, dass ihre Einwilligung ersetzt werden kann (§ 1748 BGB).
Will der Vater weder adoptieren noch legitimieren, so hat er es in der Hand, das Adoptionsverfahren durch Dritte zu beschleunigen, indem er ausdrücklich auf seine Vorrechte verzichtet (§ 1747 Abs. 3 S. 3 BGB). Diese Verzichtserklärung bedarf zur Wirksamkeit der öffentlichen Beurkundung und ist unwiderruflich (S. 4). Im Übrigen wird sie wie eine Einwilligungserklärung behandelt (§ 1747 Abs. 3 S. 5 in Verbindung mit § 1750 BGB).
6. Folgen der Kindesannahme
Für die Folgen der Kindesannahme ist zu unterscheiden: Das Kind wird gemeinschaftliches eheliches Kind, wenn es durch ein Ehepaar oder ein Stiefelternteil angenommen wird. Im Übrigen wird es eheliches Kind des Annehmenden (§ 1754 BGB).
Da ein Mensch nicht zwei Eltern gleichzeitig zugeordnet werden kann, erlöschen in der Regel die Rechtsbeziehungen zu den leiblichen Eltern und deren Verwandten (§ 1755 Abs. 1 S. 1 BGB). Dieser Grundsatz erfährt in mancherlei Hinsicht Durchbrechungen, da eine künstliche Kindschaft zwar die natürliche imitieren, aber nicht völlig ersetzen kann; es bleiben trotz grundsätzlicher Volladoption Restrechte zwischen leiblichen Eltern und Kind bestehen. Ansprüche des Kindes, die bis zur Annahme entstanden sind, insbesondere auf Renten, Waisengeld und andere entsprechende wiederkehrende Leistungen, werden durch die Annahme nicht berührt, bleiben also erhalten; das gilt jedoch nicht für Unterhaltsansprüche (§ 1755 Abs. 1 S. 1 BGB). Auch das Ehehindernis der Verwandtschaft bleibt bestehen; der leibliche Vater kann beispielsweise nicht seine zur Adoption weggegebene Tochter heiraten (§ 4 I EheG). Das auf Verwandtschaft oder Schwägerschaft beruhende Zeugnisverweigerungsrecht erlischt ebenfalls nicht durch eine Adoption (§ 383 Abs. 1 Nr. 3 ZPO).
Stiefkindadoptionen werden gesondert geregelt. Es ist zu unterscheiden:
(a) Jemand adoptiert das nichteheliche Kind seines Ehegatten: Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kind und dem Elternteil, der nicht mit dem Stiefelternteil verheiratet ist, erlöschen (§ 1755 Abs. 2 BGB).
(b) Jemand adoptiert das eheliche Kind seines Ehegatten, dessen Ehe, aus der das Kind stammt, durch Tod aufgelöst worden ist (Halbwaisen-Adoption): Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kind und dem verstorbenen Elternteil sind durch dessen Tod erloschen, die zu dessen Verwandten bleiben bestehen (§ 1756 Abs. 2 BGB). Dies wirft vor allem erbrechtliche Probleme auf (dazu: Oberloskamp 1988: 171 ff.).
(c) Jemand adoptiert das eheliche Kind seines Ehegatten, dessen Ehe, aus der das Kind stammt, durch Scheidung, Eheaufhebung oder Ehenichtigerklärung aufgelöst worden ist (Trennungswaisen-Adoption): Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kind und dem Elternteil, der nicht mit dem Stiefelternteil des Kindes verheiratet ist, erlöschen (Umkehrschluss aus § 1756 Abs. 2 BGB).
Verwandtenadoptionen unterliegen ebenfalls Spezialregelungen. Verwandtenadoptionen sind solche durch Verwandte zweiten (also Großeltern und deren Ehegatten oder Geschwister und deren Ehegatten) oder dritten Grades (Tanten, Onkel). Die Verwandtschaftsbande zur Ursprungsfamilie werden nicht radikal durch solche zur Adoptivfamilie ersetzt. Vielmehr erlöschen nur die Rechtsbande zu den leiblichen Eltern. Im Übrigen bleibt die Rechtsbeziehung wie bisher bestehen. Auch dies verursacht vor allem im erbrechtlichen Bereich Schwierigkeiten (§ 1925 Abs. 4 BGB; siehe dazu im Detail: Oberloskamp 1988: 175 ff.).
Abgesehen von diesen Ausnahmen führt die Kindesannahme dazu, dass das Kind einem leiblichen ehelichen Kind des Annehmenden gleichgestellt wird. Dies hat insbesondere Auswirkungen bei der elterlichen Sorge (§§ 1626, 1629 BGB), bei den Unterhaltsrechten und -pflichten (§§ 1601 ff. BGB) und im Erbrecht (§§ 1922 ff. BGB). Grundsätzlich gilt dies auch für das Namensrecht, jedoch sieht das Gesetz hier einige Sonderregelungen für ältere, ausländische und Kinder mit sonstigen Besonderheiten vor (§ 1757 BGB).
7. Aufhebung der Kindesannahme
Der Grundsatz der Volladoption muss die zwangsläufige Konsequenz haben, dass eine Annahme in der Regel nicht beseitigt werden kann. In ganz extremen Situationen sieht das Gesetz jedoch auch hier eine Lösungsmöglichkeit in Form einer Adoptionsaufhebung für die Zukunft (§ 1764 BGB) (nicht eine Anfechtung mit Wirkung für die Vergangenheit) vor (§ 1759 BGB). Zwei Fälle sind zu unterscheiden:
(a) Aufhebung wegen fehlender oder fehlerhafter Willenserklärungen (§§ 1760 - 1762 BGB). Hier trägt das Gesetz der Tatsache Rechnung, dass die Adoption ein Rechtsgeschäft ist und die für sein Zustandekommen erforderlichen Willenserklärungen fehlen oder Mängel aufweisen können. Die Aufhebung soll in sehr beschränktem Umfang zeitlich begrenzt - innerhalb eines Jahres, wenn seit der Annahme noch keine drei Jahre verstrichen sind (§ 1762 Abs. 2 S. 1 BGB) - und unter Berücksichtigung des Kindeswohls (§ 1761 Abs. 2 BGB) möglich sein.
(b) Aufhebung von Amts wegen, wenn dies aus schwerwiegenden Gründen zum Wohl des Kindes erforderlich ist (§ 1763 Abs. 1 BGB). Dies setzt in jedem Fall voraus, dass dem Kind juristisch in irgendeiner Form ein Elternteil erhalten bleibt, es also kein juristisches "Niemandskind" wird (§ 1763 Abs. 3 BGB). Bevor zur Maßnahme der Aufhebung gegriffen wird, sind jedoch die Möglichkeiten der Jugendhilfe auszuschöpfen.
8. Adoptionsvermittlung
Wenn jemand den Wunsch hat, ein Kind zu adoptieren, muss er sich an eine autorisierte Adoptionsvermittlungsstelle (die der Jugendämter oder die anerkannter freier Träger der Jugendhilfe) wenden (§ 2 AdVermiG). Diese Stellen haben das Vermittlungsmonopol. Alle anderen Stellen oder Privatpersonen (wie Hebammen, Ärzte ...) handeln ordnungswidrig oder machen sich strafbar, wenn sie Kinder vermitteln (§§ 5, 6 AdVermiG).
Die Adoptionsvermittlungsstellen sind Fachbehörden (§ 3 AdVermiG), die die Aufgabe haben, für elternlose Kinder die passenden Eltern zu finden. Ihre Haupttätigkeit besteht darin, Bewerber auf ihre Eignung zu prüfen. Die Eignung lässt sich nicht abstrakt, sondern nur in Bezug auf ein bestimmtes Kind feststellen. Deshalb kann die übliche Praxis, Bewerbern eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen, nicht dazu führen, diesen einen Anspruch auf ein Kind einzuräumen.
Hat eine Adoptionsvermittlungsstelle passende Eltern für ein Kind gefunden, so darf sie das Kind in Adoptionspflege geben (§ 8 AdVermiG, § 1744 BGB). In dieser Zeit berät und betreut die Adoptionsvermittlungsstelle die Pflegestelle und das Kind. Sie steht den Bewerbern mit Rat und Tat zur Seite (§ 9 AdVermiG). Auch die leiblichen Eltern sind von der Stelle zu unterstützen.
Wenn die Adoptionsvermittlungsstelle der Meinung ist, dass das Kind genügend lang in der Pflegestelle gewesen ist, und feststellt, dass eine Eltern-Kind-Beziehung entstanden ist, regt sie an, einen Adoptionsantrag bei Gericht zu stellen (§ 1752 BGB).
Nach zustande gekommener Adoption bietet die Adoptionsvermittlungsstelle nachgehende Hilfe an (§ 9 AdVermiG).
9. Gerichtliches Verfahren der Adoption
Für die Kindesannahme ist das Vormundschaftsgericht zuständig, und hier nicht der Rechtspfleger, sondern der Richter (§ 14 Nr. 3 f. RPflG). Es wird tätig auf Antrag (§ 1752 BGB). Es handelt sich um ein Verfahren der so genannten freiwilligen Gerichtsbarkeit. Hierbei hat das Gericht von Amts wegen die notwendigen Ermittlungen und Nachforschungen anzustellen. In diesem Rahmen muss es die Beteiligten anhören (§§ 50a, b, c; 55 c FGG) und von der Adoptionsvermittlungsstelle beziehungsweise dem Jugendamt eine gutachtliche Stellungnahme einholen (§ 56 d FGG).
Fehlt eine erforderliche Willenserklärung und ist diese ersetzbar, so regt das Gericht ein Ersetzungsverfahren an. Dieses wird meistens als so genanntes Zwischenverfahren durchgeführt (möglich ist es auch, das Verfahren als isoliertes Verfahren noch vor Stellung des Adoptionsantrages durchzuführen). Sowohl das Ersetzungsverfahren als auch das Hauptverfahren enden mit einem Beschluss.
Gibt der Richter dem Ersetzungsantrag statt, tritt die Wirksamkeit mit Rechtskraft der Entscheidung ein (§ 53 Abs. 1 S. 2 FGG). Gegen die stattgebende Entscheidung ist daher das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde zulässig (§ 60 Abs. 1 Nr. 6 FGG). Beschwerdeberechtigt sind die leiblichen Eltern, das über 14-jährige Kind allein (§ 59 FGG) und sein gesetzlicher Vertreter - das Jugendamt aber nur, wenn es gar nicht angehört worden ist (§ 20 FGG; dies kann höchstens bei Stiefkind- oder Verwandtenadoptionen vorkommen). Lehnt der Richter den Antrag ab, hat das Kind beziehungsweise sein gesetzlicher Vertreter ein einfaches Beschwerderecht (§ 20 Abs. 2 FGG).
Gibt der Richter dem Adoptionsantrag statt, wird dieser mit Zustellung unanfechtbar (§ 56 e S. 2 FGG). Wird der Antrag abgelehnt, ist die Entscheidung mit der einfachen Beschwerde anfechtbar (§ 19 FGG). Anfechtungsberechtigt sind nur die Antragsteller (§ 20 Abs. 2 FGG). Gegen die Entscheidungen des Landgerichts haben die beschwerdeberechtigten Personen das Rechtsmittel der sofortigen weiteren Beschwerde beim Oberlandesgericht.
10. Adoptionen mit Auslandsberührung
In Fällen mit Auslandsberührung, also wenn Kind, leibliche Eltern oder Adoptionsbewerber Ausländer sind oder im Ausland wohnen, findet internationales Privatrecht (EGBGB) und internationales Verfahrensrecht Anwendung.
Soll die Adoption von einem deutschen Gericht ausgesprochen werden, so hat dieses zunächst zu prüfen, ob es international zuständig ist (§43 b Abs. 1 FGG). Ist dies zu bejahen, hat es festzustellen, ob das Kind schon nach ausländischem Recht adoptiert worden ist und gegebenenfalls ob diese Entscheidung anzuerkennen ist (§ 16 a FGG). Ist die Wirksamkeit der ausländischen Entscheidung zweifelhaft, empfiehlt sich in jedem Fall eine zusätzliche deutsche Adoption. Sie wird auch nicht wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses verweigert (Lüderitz 1987: Rd.Nr. 397). In einem dritten Schritt hat sich der Richter zu fragen, nach welchem Adoptionsrecht - dem ausländischen oder dem deutschen - die Adoption zu beurteilen und durchzuführen ist. Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus Art. 22, 23 EGBGB. Demnach wird in den meisten Fällen deutsches Recht anzuwenden sein.
Ist das Kind bereits im Ausland adoptiert worden - viele Länder der Dritten Welt lassen Kinder nur nach durchgeführter Adoption auswandern -, so sollte möglichst bald geprüft werden, ob diese Adoption in Deutschland anerkannt wird, und gegebenenfalls sollte eine deutsche Adoption "angehängt" werden. Wird dies versäumt und taucht die Frage erst Jahre später auf (zum Beispiel bei Überprüfung der Staatsangehörigkeit, die im Normalfall von deutschen Eltern abgeleitet wird), so können dem Kind inzwischen Rechte verloren gegangen sein (etwa wie bei einem Erbfall).
Das deutsche Adoptionswesen - am Beispiel einer bayerischen Untersuchung
Martin R. Textor
Nachdem die Zahl der Adoptionen in der Bundesrepublik Deutschland seit Anfang der 50er-Jahre (1950: 4.279 Adoptionen; West-Berlin nicht erfasst) zunächst ziemlich kontinuierlich angestiegen war, bis sie 1978 mit 11.224 Adoptionen ihren Höchststand erreichte, ist sie seitdem wieder am Fallen: Im Jahr 1990 wurden in den alten Bundesländern nur noch 6.947 Adoptionen durchgeführt. Zugleich stieg die Zahl der vorgemerkten Adoptionsbewerber von 2.434 im Jahr 1950 (West-Berlin nicht erfasst) auf 19.576 im Jahr 1990.
Auch die Zusammensetzung der Adoptionen änderte sich im Verlauf der letzten 30 bis 40 Jahre. So sank die Zahl der Adoptionen durch Ausländer (früher überwiegend Nordamerikaner und Skandinavier), die 1957 mit 2.628 Adoptionen ihren Höhepunkt erreichte, auf nunmehr 252 Fälle (1990). Die Zahl der Adoptionen durch Stiefeltern und Verwandte stieg von 2.169 Fällen im Jahr 1963, in dem sie zum ersten Mal statistisch ausgewiesen wurde, auf 3.908 Fälle im Jahr 1990 (darunter 344 Verwandtenadoptionen). Parallel dazu sank die Zahl der Fremdadoptionen auf nunmehr 3.039 Fälle. Darunter dürften nahezu alle Auslandsadoptionen fallen: Im Jahr 1990 wurden 693 Minderjährige zum Zwecke der Adoption in die Bundesrepublik Deutschland geholt.
Mit 6.689 von 6.947 Adoptionen wurden die weitaus meisten Fälle von Adoptionsvermittlungsstellen öffentlicher Träger (Jugendämter) bearbeitet; an den übrigen Fällen waren freie Träger (Wohlfahrtsverbände, Vereine) beteiligt. Im Jahr 1990 waren 561 adoptierte Minderjährige unter einem Jahr, 1.743 zwischen einem und drei, 1.485 zwischen drei und sechs, 2.151 zwischen sechs und 12 Jahren sowie 1.007 mehr als 12 Jahre alt. Von den 5.797 adoptierten deutschen Minderjährigen waren 2.979 nichtehelich und 2.818 ehelich geboren worden; Letztere stammten zum weitaus größten Teil aus geschiedenen Ehen. In diesen Fällen, aber auch bei den älteren adoptierten Minderjährigen, kann man davon ausgehen, dass es sich überwiegend um Stiefkindadoptionen handelte. Schließlich kann der öffentlichen Statistik noch entnommen werden, dass 505 Minderjährige vor der Adoption länger als drei Monate in einem Heim untergebracht waren. In 317 Fällen wurde die Einwilligung der leiblichen Eltern in die Adoption durch ein Vormundschaftsgericht ersetzt.
Die letzte größere Untersuchung über das deutsche Adoptionswesen wurde 1969 von Napp-Peters durchgeführt und 1978 veröffentlicht. Diese Daten dürften inzwischen veraltet sein. Die einzige neuere Untersuchung wurde von mir im Jahr 1990 durchgeführt, beschränkt sich aber auf den Freistaat Bayern. Da keine anderen Forschungsergebnisse vorliegen, sollen im Folgenden einige ausgewählte Aspekte des deutschen Adoptionswesens anhand dieser Studie beschrieben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Situation in den anderen (alten) Bundesländern vergleichbar ist.
1. Eine bayernweite Untersuchung
An der schriftlichen Befragung beteiligten sich 117 von circa 145 bayerischen Adoptionsvermittlern. Von ihnen waren 70% weiblich und 30% männlich. Nahezu alle waren 26 Jahre alt und älter; die älteren Jahrgänge waren etwas schwächer vertreten. Die meisten Adoptionsvermittler waren berufserfahren - nur 23% waren weniger als vier Jahre auf diesem Gebiet tätig.
1.1. Zur Tätigkeit von Adoptionsvermittlern
Für die meisten Fachkräfte ist die Adoptionsvermittlung nur ein Teil ihrer Aufgaben: Im Durchschnitt verwendeten die Befragten 1990 nur etwas mehr als ein Drittel ihrer Jahresarbeitszeit auf diesen Tätigkeitsbereich. Die meiste Zeit wird auf die Überprüfung, Beratung und Betreuung von Adoptionsbewerbern, Beratung und Stellungnahmen bei Stiefeltern- und Verwandtenadoptionen sowie auf die Betreuung von Adoptivfamilien und -kindern verwandt. Die Betreuung leiblicher Eltern und suchender Adoptierter sowie die Auslandsadoptionen beanspruchen hingegen weniger Zeit.
Nach den "Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung" der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen Erziehungsbehörden (1988) ist die Fachkraft in der Adoptionsvermittlungsstelle "für die gesamte Vermittlungstätigkeit verantwortlich" und nimmt "den Innen- und Außendienst wahr" (ebenda, S. 11). Laut Befragung werden in der Praxis jedoch häufig die bei einer Vermittlung anfallenden Aufgaben auf mehrere Fachkräfte verteilt (20%), oder einzelne Aufgaben werden an Kollegen mit anderen Aufgabenbereichen (wie etwa solche des Allgemeinen Sozialdienstes) delegiert.
Adoptionsvermittler müssen mit vielen Institutionen zusammenarbeiten, wollen sie ihren Aufgaben voll gerecht werden. So überrascht das Befragungsergebnis, dass beispielsweise 35% der bayerischen Fachkräfte nicht mit Sozialämtern, 30% nicht mit Schwangerschaftsberatungsstellen, 25% nicht mit Erziehungsberatungsstellen und 20% nicht mit Heimen kooperieren. Von den übrigen Befragten bewertet nur (knapp) die Hälfte die Zusammenarbeit überwiegend positiv.
Für die Beratung und Betreuung der Klienten sind in der Regel mehrere Gesprächstermine und/oder Hausbesuche notwendig. Nach der bayerischen Studie
(a) kommen bei der Überprüfung von Adoptionsbewerbern fast drei von fünf Adoptionsvermittlern mit ein oder zwei Gesprächen im Büro und mehr als zwei Drittel mit ein oder zwei Hausbesuchen aus;
(b) haben Adoptionsvermittler während der Adoptionspflegezeit in drei Fünftel aller Fälle keinen Kontakt zu den leiblichen Vätern der Adoptivkinder; zu den leiblichen Müttern haben sie in 12% der Fälle keinen Kontakt und in fast zwei Dritteln der Fälle weniger als einmal pro Monat;
(c) haben 95% der Vermittler maximal einmal im Jahr Kontakt zu den leiblichen Eltern nach Beendigung der Adoptionspflegezeit;
(d) führen drei von fünf Vermittlern höchstens drei Gespräche mit Adoptiveltern im Büro während der Adoptionspflegezeit, begnügen sich zwei von fünf Fachkräften mit maximal drei Hausbesuchen;
(e) hat die Hälfte der Vermittler höchstens einmal im Jahr Kontakt zu Adoptivfamilien in den ersten fünf Jahren nach Beendigung der Adoptionspflegezeit.
Dieser Zeitaufwand dürfte nicht ausreichen, um beispielsweise die aus der Infertilität der Adoptionsbewerber resultierenden Probleme zu klären und eventuell Beratungsbereitschaft zu wecken, leiblichen Müttern bei der Verarbeitung der Freigabeentscheidung und der Umweltreaktionen zu helfen, die Adoptivfamilie intensiv während der Eingliederung des Adoptivkindes zu beraten (insbesondere wenn man bedenkt, dass heute viele ältere und damit oft verhaltensauffällige Kinder vermittelt werden) und eine ausreichende Nachbetreuung von Adoptivfamilien nach der Adoption sicherzustellen.
In diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass die Beratungsbedürftigkeit der Klienten (insbesondere der leiblichen Mütter, der Adoptionsbewerber, der Adoptiveltern und der älteren Adoptierten) von den Adoptionsvermittlern selbst überwiegend als groß oder sehr groß bewertet wird. Vergleicht man diese Angaben mit der Häufigkeit von Klientenkontakten, so ist es nicht verwunderlich, dass die Fachkräfte das Beratungsangebot für ihre Klienten recht skeptisch beurteilen. Dies betrifft vor allem die Angebote für leibliche Väter und Mütter von Adoptivkindern sowie für ältere Adoptierte, die von 22 bis 30% der Befragten mit "mangelhaft" und nur von 23 bis 31% mit "gut" oder "sehr gut" benotet werden. Aber auch die Beratungsangebote für Adoptionsbewerber und Adoptiveltern lassen nach Meinung vieler Vermittler noch zu wünschen übrig. So ist dringend das Beratungsangebot zu verbessern, sollte der Kontakt zu den Klienten intensiviert werden.
1.2. Einstellungen von Adoptionsvermittlern
Das Verhalten von Adoptionsvermittlern dürfte zum Teil durch ihre Einstellungen zu fachspezifischen Themen geprägt werden. So wurde versucht, die Haltungen bayerischer Fachkräfte zu erfassen.
Beispielsweise wurde folgende These von Napp-Peters (1978: 306) überprüft: "Im Rollen-Set der Adoption ist die negative Typisierung und Sanktionierung natürlicher Eltern strukturell vorgegeben..." Laut der bayerischen Umfrage glaubt nur einer von zehn Adoptionsvermittlern, dass leibliche Mütter häufig bedauernswerte Wesen sind, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Die meisten gehen davon aus, dass sie an ihrer Situation keine Schuld tragen (73%), sondern von ihren Partnern und Eltern ausgenutzt und in Stich gelassen werden (49%). Auch würden die Mütter Verantwortung und großen Mut zeigen, wenn sie sich für die Freigabe ihres Kindes zur Adoption entscheiden (94%). Dies wird nicht als Mangel an Elterngefühlen und Mutterliebe gewertet (83%) - vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Mütter zumeist ihr ganzes Leben unter der Freigabeentscheidung leiden (63%). So ist die von Napp-Peters vermutete Stigmatisierung leiblicher Eltern seitens der Adoptionsvermittler in der Regel nicht vorzufinden.
Die bayerischen Fachkräfte sind überwiegend bereit, Kinder an wiederverheiratete (99%) und konfessionslose (90%) Bewerber zu vermitteln, aber auch an Bewerber mit behinderten Kindern (78%) oder an behinderte Bewerber (65%). Das Leben in einer konfessionellen Mischehe wird von keinem Befragten mehr als Ausschließungsgrund gesehen. Der Vergleich mit den Forschungsergebnissen von Napp-Peters (1978) zeigt, dass die Fachkräfte liberaler geworden sind.
Heute wird eine Adoption immer häufiger bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Betracht gezogen. So glauben nur noch 6% der bayerischen Fachkräfte, dass Kinder mit mittleren oder schweren Behinderungen im Heim besser gefördert werden können als in der Adoptivfamilie - und nur 4% vertreten diese Auffassung hinsichtlich psychisch kranker und stark verhaltensgestörter Kinder. Auch sind 29% der Befragten der Meinung, dass noch zu viele Kinder in Heimen leben, die zur Adoption freigegeben werden könnten. Mehr als ein Drittel der Fachkräfte vertritt die Auffassung, dass sehr viel mehr misshandelte, sexuell missbrauchte oder vernachlässigte Kinder zur Adoption freigegeben werden könnten, wenn öfter die Ersetzung der Einwilligung ihrer Eltern durch das Vormundschaftsgericht beantragt würde. Die meisten Fachkräfte ziehen also die Adoptivfamilie einer Heimunterbringung vor und sind der Meinung, dass noch mehr Kinder zur Adoption freigegeben werden könnten.
In den letzten Jahren wurden der Identitätsfindung von Adoptivkindern bzw. dem Verarbeiten der "doppelten Elternschaft" (Hoffmann-Riem 1984; Ebertz 1987) sowie der Suche erwachsener Adoptierter nach ihren Wurzeln (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Textor 1990) viel Aufmerksamkeit gewidmet. Von den Fachkräften wird erwartet, dass sie Adoptierte bei der Identitätsfindung unterstützen und ihnen bei der Kontaktaufnahme zu den leiblichen Eltern helfen (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen Erziehungsbehörden 1988: 24). Bei unserer Umfrage meint die Hälfte der Befragten, dass Vermittler Adoptierten (ab 16 Jahren) alle ihnen zugänglichen Informationen über deren Herkunft geben sollten - gerade jeder Siebte ist dagegen. Nur 30% der Fachkräfte sind der Meinung, dass es dem Ermessen der Adoptionsvermittlungsstelle vorbehalten sein sollte, Kontakt zwischen einem suchenden Adoptierten (ab 16 Jahren) und seinen leiblichen Eltern herzustellen. Hingegen sprechen sich 60% dafür aus, dass die Vermittler alles in ihrer Kraft stehende tun sollten, um die biologischen Eltern ausfindig zu machen. Mehr als ein Drittel der Adoptionsvermittler ist sogar der Meinung, dass auch die leiblichen Eltern das Recht haben sollten, mit einem volljährigen Adoptierten Kontakt aufzunehmen. Dies würde allerdings eine Änderung des § 1758 BGB voraussetzen.
Mehrere ältere Untersuchungen (Triseliotis 1973; Sobol/Cardiff 1983; Aumend/Barrett 1984) kamen zu dem Ergebnis, dass suchende Adoptierte im Vergleich zu nicht suchenden eine unbefriedigende Beziehung zu ihren Adoptiveltern haben und unter psychischen Problemen leiden. Die befragten Adoptionsvermittler sind anderer Meinung: 93% halten die Suche von Adoptierten nach ihren leiblichen Eltern für völlig normal. Neun von zehn Fachkräften sehen in diesem Verhalten kein Zeichen dafür, dass Adoptierte große Probleme mit den Adoptiveltern (gehabt) haben. Und nur 4% sehen in der Suche ein Symptom für große intrapsychische Konflikte.
Adoptionen ausländischer Kinder sind erst in den letzten Jahren relativ häufig geworden. Nur ein Teil dieser Kinder stammt aus der Dritten Welt - der Anteil von Kindern aus den osteuropäischen und GUS-Staaten wird in Zukunft sicher steigen, da geringere Distanzen zu überwinden sind und sich die Kinder vom Aussehen her unauffälliger in den Kreis der Deutschen einfügen. In der Presse und in der Fachöffentlichkeit wird viel Kritik an Auslandsadoptionen geübt, da in manchen Fällen illegale Wege beschritten (Kinderhandel) und Adoptionsvermittlungsstellen nicht eingeschaltet werden (Privatadoptionen), weil in ihnen eine neue Form der Ausbeutung der Dritten Welt gesehen wird oder weil für die Adoptivkinder negative Folgen (wie etwa Diskriminierung) erwartet werden.
Bei der bayerischen Studie sind zwei Drittel der Vermittler gegen eine Vergrößerung der Zahl von Auslandsadoptionen, um auf diese Weise verhungernden oder vernachlässigten Kindern aus der Dritten Welt zu helfen. Jedoch tritt nur ein Viertel für eine Verringerung der Zahl ein, da die Kinder in der eigenen Kultur bessere Entwicklungsmöglichkeiten hätten. Und nur 14% wollen die Zahl der Auslandsadoptionen reduzieren, weil es ausländischen Kindern schwer falle, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Die meisten Fachkräfte wollen also die Zahl der Adoptionen nicht vergrößern, setzen sich aber auch nicht für ihre Verringerung ein.
Seit der Gründung der ersten Adoptionsvermittlungsstellen zu Beginn dieses Jahrhunderts und bis in die 80er-Jahre hinein wurden nahezu ausnahmslos Inkognitoadoptionen durchgeführt. Diese Praxis wird zunehmend in Frage gestellt: Aus einer Vielzahl von Beweggründen, die vor allem auf eine Verbesserung der Situation leiblicher Mütter nach Freigabe ihrer Kinder zur Adoption abzielen und den Kindern die Verarbeitung der doppelten Elternschaft erleichtern sollen, wurden offene Formen der Adoption als Alternativen entwickelt (Textor 1988, 1991c). Auch bei der bayerischen Studie wurde eine große Skepsis gegenüber der Inkognitoadoption angetroffen: Nur 16% der Adoptionsvermittler sehen sie positiv; drei von fünf Befragten bewerten sie (sehr) negativ. Am besten werden halb offene Formen der Adoption beurteilt: Mehr als zwei Drittel der Adoptionsvermittler sehen eine Adoption mit fortlaufender Information der leiblichen Eltern und der Adoptivfamilie (mit Wahrung der Anonymität Letzterer) über die Situation der jeweils anderen Seite durch den Vermittler (sehr) positiv. Und 57% beurteilen eine halb offene Adoption unter Wahrung des Inkognitos der Adoptiveltern (sehr) positiv, bei der die Fachkraft Geschenke, Briefe u. Ä. zwischen den leiblichen Eltern und der Adoptivfamilie weiterleitet. Ein einmaliges Zusammentreffen von beiden Seiten wird von der Hälfte der Befragten positiv gesehen. Für eine vollständige Auflösung der Anonymität sind aber nur wenige Fachkräfte: Ein fortlaufender direkter brieflicher oder telefonischer Kontakt zwischen leiblichen Eltern und Adoptivfamilie wird nur noch von einem Viertel der Adoptionsvermittler (sehr) positiv bewertet. Und nur 18% sind für einen fortlaufenden persönlichen Kontakt, also eine offene Adoption im engeren Sinne. In diesem Fall wird mit positiven Folgen vor allem für die leiblichen Eltern gerechnet (51%), weniger aber für Adoptivkinder (37%) und Adoptiveltern (24%).
Die Befragung bayerischer Adoptionsvermittler ergab, dass halb offene Adoptionsformen bereits relativ häufig praktiziert werden (23% der erfassten 215 Fälle), offene Formen hingegen noch selten (direkter Austausch von Briefen, Fotos usw. in 2% dieser Fälle, Fortführung persönlicher Kontakte in 3% der Fälle). In rund einem Fünftel der 215 Fälle lernten sich leibliche Eltern und Adoptiveltern kennen, wobei es in der Regel bei einem Treffen (unter Wahrung der Anonymität der Adoptiveltern) blieb. Der positiveren Bewertung von halb offenen gegenüber offenen Adoptionsformen entspricht also die weitaus größere Zahl praktizierter halb offener Adoptionen. Zudem nennen einige wenige Fachkräfte besonders viele, von ihnen durchgeführte offene bzw. halb offene Adoptionen - nachdem sie irgendwann mit diesen Adoptionsformen begonnen haben, machen sie nun von ihnen häufig Gebrauch. Beides dürfte ein Beleg dafür sein, dass die Einstellungen der Adoptionsvermittler ihre Praxis mitbestimmen.
Die Befragung bayerischer Fachkräfte zeigt, dass sich die erfassten Einstellungen über die gesamte Bandbreite der vorgegebenen Möglichkeiten verteilen. Dies konnte in der Regel nicht auf Kriterien wie Geschlecht, Alter, Dauer der Tätigkeit im Adoptionswesen oder zeitlicher Umfang adoptionsspezifischer Aufgaben zurückgeführt werden. So ist zu problematisieren, ob diese Unterschiede in den Einstellungen nicht auch zu Unterschieden in der Praxis führen (siehe das gerade genannte Beispiel mit den offenen und halb offenen Adoptionsformen) und ob diese Unterschiede nicht in Widerspruch zu dem Anspruch auf professionellen Status stehen. Es scheint dringend erforderlich zu sein, die Professionalisierung der Tätigkeit der Fachkräfte voranzutreiben, indem man eindeutige Kriterien für die Adoptionsvermittlung entwickelt, die Fortbildungsangebote verbessert und mehr Möglichkeiten für den wechselseitigen Austausch zwischen Vermittlern schafft.
2. Entwicklungstendenzen im Adoptionswesen
Vergleicht man die Ergebnisse der Befragung bayerischer Adoptionsvermittler (Textor 1991a) mit den an ausgewählten (größeren) Adoptionsvermittlungsstellen gewonnenen Untersuchungsergebnissen von Napp-Peters (1978), lassen sich folgende Entwicklungstendenzen im deutschen Adoptionswesen für den Zeitraum 1969 bis 1990 herausarbeiten: Gegenüber 1969
(a) sind heute mehr Vermittler für das gesamte Adoptionsverfahren zuständig;
(b) können Fachkräfte bei schwierigen Fällen eher auf eine psychologische Beratung zurückgreifen (fast zwei Drittel gegenüber einem knappen Fünftel);
(c) berichten Vermittler häufiger davon, dass Mütter die Entscheidung, ihr Kind zur Adoption freizugeben, wieder rückgängig machen (Rückzugsquoten über 30% wurden von 22% der Befragten genannt gegenüber 7% im Jahr 1969);
(d) werden leibliche Väter von Adoptivkindern weiterhin nur selten in das Adoptionsverfahren einbezogen;
(e) werden leibliche Eltern häufiger an der Auswahl von Adoptionsbewerbern für ihr Kind beteiligt;
(f) ist mehr Offenheit anzutreffen: Adoptiveltern und leibliche Eltern erhalten mehr Informationen über die jeweils andere Seite;
(g) haben Fachkräfte etwas gleich viel Kontakt zu leiblichen Eltern nach Freigabe eines Kindes;
(h) werden Kinder heute häufiger so früh wie möglich vermittelt;
(i) werden Adoptiveltern während der Adoptionspflegezeit häufiger und in erster Linie durch die Vermittler selbst betreut, bestehen öfters die Kontakte nach der Adoption fort;
(j) sind kaum noch Prozesse der Stigmatisierung oder negativen Typisierung von leiblichen Müttern festzustellen;
(k) sprechen sich Vermittler durchwegs für eine vollständige Aufklärung der Adoptiveltern über die Herkunft des Kindes aus;
(l) erkennen Fachkräfte eher den Sonderstatus der Adoptivfamilie an;
(m) würden Fachkräfte ein Kind eher an konfessionslose und konfessionsverschiedene Bewerber, an Alleinstehende und Wiederverheiratete vermitteln;
(n) werden Adoptiveltern häufiger als geeignet für behinderte, psychisch kranke oder verhaltensgestörte Kinder gehalten;
(o) spielt das "matching", die Beachtung von Ähnlichkeiten zwischen Kind und Adoptionsbewerbern, bei der Vermittlung eine geringere Rolle;
(p) ist eine positive Sicht von strikten Inkognitoadoptionen nur noch selten anzutreffen, werden halb offene Adoptionsformen am positivsten bewertet.
Wie bereits erwähnt, werden heute auch mehr Auslandsadoptionen vollzogen und mehr ältere oder behinderte Kinder vermittelt als 1969. Ferner werden Adoptionsvermittler häufiger mit suchenden Adoptierten konfrontiert.
Teil 2
Forschungsstand
Inlandsadoptionen: Herkunft, Familienverhältnisse und Entwicklung der Adoptivkinder
Martin R. Textor
Rund 250.000 Mütter haben in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1945 und 1985 Kinder zur Adoption freigegeben (Die Tageszeitung/taz, 25. 8. 1985). Dennoch liegen nur wenig wissenschaftliche Forschungsergebnisse über die Situation dieser Mütter vor - über die leiblichen Väter von deutschen Adoptivkindern ist noch weniger bekannt. Ähnliches gilt für das englischsprachige Ausland. Außerdem sind nahezu alle Untersuchungen im Adoptionsbereich nicht repräsentativ. Sie erfolgten zumeist an kleinen und willkürlich gewählten Stichproben und weisen häufig methodische Mängel auf. So ist bei allen Forschungsergebnissen, die in diesem Kapitel referiert werden, zu beachten, dass sie nur einen groben Überblick bieten und Tendenzen aufzeigen.
1. Die leiblichen Eltern
Nach den Untersuchungen von Napp-Peters (1978), Jungmann (1987) und Textor (in Druck) sind die leiblichen Mütter deutscher Adoptivkinder nur im Ausnahmefall minderjährig; ansonsten sind alle relevanten Altersgruppen mit hoher Besetzung vertreten. Viele sind verheiratet, leben von ihren Partnern getrennt oder sind geschieden. Oft haben sie weitere eheliche oder nichteheliche Kinder. Ähnliches gilt auch für die leiblichen Väter. Generell haben abgebende Eltern eine verhältnismäßig schlechte Schul- und Berufsausbildung erfahren. Sie gehören überwiegend der Unterschicht an. Insbesondere allein stehende Frauen sind häufig großen sozialen und wirtschaftlichen Belastungen ausgesetzt.
Bei Säuglingen, die zur Adoption freigegeben werden, handelt es sich in der Regel um unerwünschte Kinder. Als Ursachen für die Schwangerschaft werden mangelnde Aufklärung, Versagen der Verhütungsmaßnahme, "Pillenpause", Nachlässigkeit und Impulsivität genannt, aber auch unbewusste Bedürfnisse (zum Beispiel Wunsch nach einem Liebesobjekt, Rettung einer zerbrechenden Ehe, Suche nach Lebenssinn), Inzest und Vergewaltigung (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Swientek 1986; Textor in Druck). Viele Frauen reagieren auf die Schwangerschaft mit Verwirrung, Angst oder Wut, fühlen sich von ihren Partnern betrogen oder verdrängen die Diagnose. Da sie häufig von ihren Geliebten, Ehemännern und Eltern in Stich gelassen werden und wenig Unterstützung durch Dritte erfahren, fühlen sie sich verlassen, einsam, hilflos und überlastet. So müssen sie neben der unerwünschten Schwangerschaft auch ihre Enttäuschung und die negativen Reaktionen ihrer Partner, Verwandten und Freunde verarbeiten (Inglis 1984; Kraft et al. 1985; Swientek 1986; Textor in Druck). Bis sie ihre Schwangerschaft erkannt und ihre Situation reflektiert haben, ist es oft schon zu spät für einen Schwangerschaftsabbruch.
Die skizzierte Situation verweist bereits auf die Gründe, warum dann die Säuglinge oder Kleinkinder zur Adoption freigegeben werden. Die Mütter sind zur Berufstätigkeit gezwungen und können ihr Kind nicht versorgen, finden keine Betreuungsmöglichkeit, können es unter den gegebenen Wohnbedingungen nicht aufziehen, sind psychologisch nicht auf Elternschaft vorbereitet, fühlen sich restlos überfordert oder befinden sich in einer Notlage. Sie erfahren keine Unterstützung durch Dritte, werden vielmehr zur Freigabe ihres Kindes zur Adoption gedrängt. Vielen Müttern geht es in dieser Situation psychisch schlecht (Swientek 1982, 1986; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Deykin/Campbell/Patti 1984; Inglis 1984; Millen/Roll 1985; Textor in Druck). Manche Mütter versuchen auch, das Kind zunächst allein großzuziehen, scheitern dann aber. Verheiratete Paare geben ein Kind zur Adoption frei, wenn ein Partner krank, gebrechlich oder behindert ist, wenn die Ehe konflikthaft oder zerrüttet ist oder wenn das Kind außerehelich gezeugt wurde (Bohman 1980; Kraft et al. 1985; Jungmann 1987). In manchen Fällen wird die Einwilligung der Eltern in die Adoption auch vom Vormundschaftsgericht ersetzt, wenn die Kinder zum Beispiel verlassen, vernachlässigt, misshandelt oder sexuell missbraucht wurden und ihre Rückführung in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist.
Den weitaus meisten leiblichen Müttern fällt die Entscheidung sehr schwer, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Sie brauchen in der Regel Monate oder gar Jahre, um die Fortgabe ihres Kindes zu verarbeiten. In dieser Zeit leiden sie unter Verlustgefühlen, Trauer, Schmerz, Reue, Gewissensbissen, mangelnder Selbstachtung und Wut. Oft kommt es zur Ausbildung psychischer und psychosomatischer Symptome. Diese Situation wird auch dadurch unerträglich, dass sie häufig keine Gesprächspartner finden, mit denen sie über ihr Kind und ihre Emotionen reden können, dass sie Ablehnung und Diskriminierung erfahren, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Swientek 1982, 1986; Inglis 1984; Millen/Roll 1985; Mantel 1987). Manche Frauen übernehmen nach der Freigabe eine Opferrolle, andere wenden sich bitter von Verwandten und Freunden ab, wieder andere versuchen, die Adoption rückgängig zu machen oder Informationen über ihr Kind zu bekommen. In der Regel verliert der Trauerprozess im Verlauf der Zeit an Intensität, kann aber zu bestimmten Zeitpunkten (zum Beispiel Geburtstag des Kindes) wieder stärker werden. Manchmal belastet die Freigabeentscheidung das ganze weitere Leben der betroffenen Frauen.
2. Die Adoptiveltern
Adoptiveltern sind zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Kindes zumeist älter als biologische Eltern. Sie haben in der Regel eine bessere Schulbildung, gehören der Mittel- oder Oberschicht an, besitzen zumeist ein Haus und haben einen hohen sozialen Status. Obwohl die meisten Frauen zumindest in den ersten Jahren nach Annahme eines Adoptivkindes nicht erwerbstätig sind, ist das Familieneinkommen überdurchschnittlich hoch (Kirk 1981; Bachrach 1983; National Commitee for Adoption 1985; Textor in Druck). Ehescheidungen sind sehr selten (Bohman 1980; Knoll/Rehn 1984/85; Jungmann 1987).
Ehepaare bewerben sich aus unterschiedlichen Gründen um ein Adoptivkind. Das vorherrschende Motiv ist aber die Infertilität eines Partners - bei Befragungen wird es von rund 70% der Adoptiveltern genannt (Knoll/Rehn 1984/85). Häufig werden aber auch Fehlgeburten und Erbkrankheiten als Gründe genannt, oder es wird auf soziale, humanitäre und christliche Motive verwiesen (Hoffmann-Riem 1984; Reid et al. 1987; Textor in Druck). Die Erfahrung der Infertilität und die nach der Diagnose häufig unter ärztlicher Anleitung erfolgten Zeugungsversuche gehen in der Regel nicht ohne psychische Folgen an den Adoptionsbewerbern vorbei. Manche erleben ihre Unfruchtbarkeit als narzisstische Kränkung (Verletzung des Selbstwertgefühls) und entwickeln ein negatives Körperbild, Gefühle mangelnder Männlichkeit beziehungsweise Weiblichkeit, eine gestörte Geschlechtsidentität und eine geringe Selbstachtung. Selbst Jahre nach der Adoption ist bei ihnen noch ein starker Leidensdruck wegen ihrer Infertilität festzustellen (Kraft et al. 1980; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Schneider/Rimmer 1984; Knoll/Rehn 1984/85). Eine mangelnde Verarbeitung dieser Erfahrung kann zu Problemen bei der Aufklärung des Adoptivkindes über seinen Status oder bei der sexuellen Aufklärung führen. So erinnert die Existenz des adoptierten Kindes die Adoptiveltern immer wieder an ihre Unfruchtbarkeit. Dies kann es ihnen erschweren, mit ihm über die Adoption zu sprechen oder kindliche Äußerungen der Triebhaftigkeit (wie sexuelle Neugier, Schmieren, Masturbation) zu akzeptieren. Ferner kann die Suche von adoptierten Jugendlichen nach erotischen und sexuellen Erfahrungen die narzisstische Verletzung und die Trauer der Eltern wieder beleben und zu unangemessenen Reaktionen führen.
Adoptionsbewerber durchlaufen ein gründliches Auswahlverfahren und müssen in der Regel eine lange Zeit warten, bis ihnen ein Kind zur Adoption angeboten wird. Sie erfahren somit eine zweite narzisstische Kränkung: Im Gegensatz zu leiblichen Eltern müssen sie ihre Eignung als potentielle Erzieher nachweisen, können sie den Zeitpunkt der Geburt beziehungsweise Aufnahme des Kindes nicht selbst bestimmen, sind sie hinsichtlich der Realisierung ihrer Pläne von anderen abhängig (Kirk 1981; Aselmeier-Ihrig 1984). Zudem sind sie während der Adoptionspflegezeit erst "Eltern auf Probe". Deutlich wird hier aber auch, dass die Adoptivfamilie gegenüber der durch Zeugung entstandenen Familie einen Sonderstatus besitzt. Ihre Mitglieder werden sich immer mit dem Problem der "doppelten Elternschaft", dem Gefühl des Andersseins und den Reaktionen Dritter auseinander setzen müssen.
Verschiedene Studien (Kirk 1981; Hoffmann-Riem 1984; Knoll/Rehn 1984/85) haben gezeigt, dass Adoptionen besser verlaufen, wenn die Mitglieder der Adoptivfamilie ihren Sonderstatus akzeptieren und damit nach einer "Normalisierung eigener Art" (Hoffmann-Riem) streben. Hier wird die Realität der besonderen Familiengründung nicht verneint, kann sich das Adoptivkind offen mit seiner Situation auseinander setzen, wird das Thema "Adoption" nicht tabuisiert. Die Akzeptanz des Sonderstatus ist laut den vorgenannten Untersuchungen mit mehr Empathie der Mütter, einer besseren Kommunikation, mehr Vertrauen und Solidarität in der Familie, festeren Bindungen, weniger Konflikten und mehr Selbständigkeit verbunden. Auch verläuft die Entwicklung des Adoptivkindes eher positiv.
3. Aufnahme eines Adoptivkindes und Eingewöhnungszeit
Das Angebot und die Aufnahme eines zur Adoption freigegebenen Säuglings ist meist ein durch Belastung und Stress gekennzeichnetes Ereignis. Den Adoptionsbewerbern wird plötzlich und unvorhersehbar per Telefon angekündigt, dass ein Kind für sie gefunden wurde. Dann müssen sie umgehend zur Adoptionsvermittlungsstelle kommen, wo sie mehr über das Kind und seine Lebensgeschichte erfahren. Oft haben sie dann noch die Möglichkeit, den Säugling anzuschauen. Zumeist müssen sie sich innerhalb weniger Stunden oder Tage entscheiden, ob sie ihn aufnehmen wollen. Auch bleibt ihnen kaum Zeit, notwendige Einrichtungsgegenstände, Kinderwagen oder Säuglingsnahrung zu besorgen.
Wird ein älteres Kind zur Adoption freigegeben, bleibt den Bewerbern zumeist mehr Zeit für die Entscheidung, ob sie es aufnehmen wollen. Auch wird der Kontakt nur langsam angebahnt. Jedoch wächst die Komplexität der Entscheidungssituation mit dem Alter des Kindes. Während der Anblick eines Säuglings meist Zuneigung, Hilfsbereitschaft und ähnliche Verhaltenstendenzen auslöst und während ein Kleinkind seine physischen und sprachlichen Fertigkeiten zur raschen Herstellung eines Kontaktes einsetzen kann, sind ältere Kinder beim ersten Zusammentreffen zumeist nervös, angespannt, distanziert oder distanzlos. Sie haben in der Regel bis zu diesem Zeitpunkt viele negativen Erfahrungen gemacht, die zu Entwicklungsverzögerungen, psychischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten geführt haben. Da Adoptionsbewerber wissen, dass vielen Bewerbern nur wenige zur Adoption freigegebene Kinder gegenüberstehen und ihnen somit in der nächsten Zeit wahrscheinlich keine zweite Chance geboten werden wird, besteht die Gefahr, dass sie sich trotz erheblicher und gegenüber der Vermittlungsstelle nicht verbalisierter Bedenken für die Aufnahme des Kindes entscheiden.
Vor der Übergabe des Kindes erhalten die Adoptionsbewerber viele Informationen über seine Herkunft, die leiblichen Eltern, die Freigabegründe, seinen Gesundheitszustand und so weiter. Manchmal sind diese oberflächlich oder geschönt, zumeist sind sie aber heute recht detailliert (Textor in Druck). Da es sich in der Regel um mündliche Informationen handelt und diese in einer durch Stress und Aufregung gekennzeichneten Situation weitergegeben werden, werden viele innerhalb kürzester Zeit vergessen oder verdrängt. Dies hat zum einen zur Folge, dass die Adoptivkinder später nur wenig über ihre Vorgeschichte erfahren. Zum anderen führt es bei Adoptiveltern zu der Tendenz, die Vergangenheit ihrer Kinder zu rekonstruieren, um zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen zu erklären. Aufgrund des mangelhaften Wissensstandes werden dann oft die leiblichen Eltern und ihre Motive typisiert, kommt es zur Schwarz-Weiß-Malerei, wird die Vergangenheit als traurige Zeit entworfen. In Einzelfällen werden auch die Ursachen für Probleme mit dem Adoptivkind in seiner Vorgeschichte - selbst wenn diese nur wenige Wochen umfasste - oder in seinem Erbgut gesucht (Hoffmann-Riem 1984). Viele Adoptiveltern sind auch den leiblichen Eltern (insbesondere den Vätern) gegenüber negativ eingestellt (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Knoll/Rehn 1984/85).
Zur Adoption freigegebene Kinder kommen manchmal in einem körperlichen und/oder psychischen Zustand in Adoptivfamilien, der eine besondere Betreuung notwendig werden lässt. Jungmann (1987) stellte bei der Analyse von 198 Akten über Adoptivkinder, die vor Vollendung des ersten Lebensjahres in West-Berliner Familien platziert wurden, fest, dass nur bei 74% der Kinder keine perinatalen Auffälligkeiten erfasst wurden (ansonsten: bei 14% Frühgeburten, bei 10% unter 2 500 g Geburtsgewicht, bei 6% intranatale Hypoxie [mangelnde Versorgung mit Sauerstoff]). Bei 24% der Kinder wurden weitere Auffälligkeiten innerhalb der ersten 12 Lebensmonate ermittelt (zum Beispiel bei 9% rezidivierende Bronchitis/Pneumonie, bei 8% angeborene Hüftgelenkluxation [Skelettmissbildung], bei 7% schwere Ernährungsstörungen, bei 6% motorische Entwicklungsverzögerung). Bei der medizinischen Adoptionseignungsuntersuchung waren dann jedoch 90% der Kinder ohne Befund. Napp-Peters (1978) stellte hingegen bei ihrer Studie fest, dass 144 von 1.362 deutschen Kindern zum Zeitpunkt der Freigabe zur Adoption unter körperlichen Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen sowie 167 unter psychischen Störungen litten.
Über die Eingewöhnungszeit von adoptierten Säuglingen und Kleinstkindern wird in der bearbeiteten Literatur nicht berichtet. Bei der Adoption älterer Kinder kommt es in dieser Phase jedoch häufig zu Problemen. Viele von ihnen haben traumatische Erfahrungen gemacht, leiden unter Deprivation, haben einen häufigen Wechsel von Betreuungspersonen erlebt und waren oft lange im Heim (Kadushin 1970; Plumez 1892; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Ebertz 1987). Vereinzelt möchten sie auch nicht adoptiert werden oder stehen einer Adoption ambivalent gegenüber (Kadushin 1970). Ältere Kinder kennen ihren Geburtsnamen, wissen von ihren leiblichen Eltern und Verwandten, fühlen sich häufig an diese gebunden und vermissen sie. Aber auch die Trennung von Pflegeeltern, Heimerziehern und Freunden fällt oft schwer. So bringen sie ihre Lebensgeschichte, ihre früheren Erfahrungen und die in anderen "settings" gelernten Verhaltensmuster in die Adoptivfamilie mit. Kadushin (1970) ermittelte, dass nur bei etwa der Hälfte der von ihm untersuchten 91 Fälle keine offenen Bindungen an die leiblichen Eltern mehr bestanden - ansonsten sprachen manche ältere Adoptivkinder positiv über dieselben, trauerten mehr oder weniger sichtbar um sie und benötigten noch viel Zeit für die Lösung der emotionalen Bande.
Manchen älteren Kindern fällt es schwer, sich in die Adoptivfamilie zu integrieren. Sie weinen, sind depressiv, ziehen sich zurück, streiten sich mit den Adoptiveltern oder laufen weg. Einige sind zunächst unsicher und misstrauisch, fürchten eine erneute Zurückweisung und testen durch auffällige Verhaltensweisen, ob sie wirklich als Person angenommen werden. Andere regredieren hingegen und verlangen nach der Nähe, Zuneigung, Liebe und Zärtlichkeit, die sie zuvor entbehren mussten (Kadushin 1970; Katz 1977; Sorosky/Baran/Pannor 1982). Viele ältere Kinder reagieren auch aufgrund neuer Verhaltensanforderungen und -normen verwirrt. Es fällt ihnen nicht leicht, sich an eine mittelschichtsorientierte Familienkultur anzupassen, Tischsitten zu erlernen, auf Schimpfworte zu verzichten, anderen Menschen gegenüber höflich zu sein (Kadushin 1970).
So überrascht es nicht, dass viele Adoptiveltern aufgrund dieser oder anderer Probleme (zum Beispiel Verhaltensstörungen) eine Beratungsstelle aufsuchen; dies geschah zum Beispiel in 68% der von der Amerikanerin Nelson (1985) untersuchten 257 Fällen. Dieselbe Forscherin stellte aber auch fest, dass diese Schwierigkeiten zumeist schnell an Bedeutung verlieren. So verbesserte sich beispielweise das Sozialverhalten rasch in 67% von 120 Fällen, in denen diesbezügliche Auffälligkeiten ermittelt wurden. In 78% der 144 Fälle, in denen die Schulleistungen unbefriedigend waren, kam es ebenfalls zu einer schnellen Besserung.
4. Das Leben in der Adoptivfamilie
Adoptivkinder scheinen sich in ihrer Familie wohl zu fühlen. Knoll und Rehn (1984/85) stellten bei ihrer Untersuchung über deutsche Adoptivfamilien fest, dass 37 Jugendliche mit der gesamten Zeit bei ihren Eltern sehr zufrieden, sieben zufrieden und sieben halb zufrieden waren; nur einer antwortete mit "unzufrieden". Auch schienen sie ein besseres Verhältnis zu ihren Eltern zu haben als gleichaltrige Jugendliche aus der Kontrollgruppe: So suchten sie zum Beispiel bei Problemen eher die Eltern auf. Generell verstanden sich 28 Adoptierte mit der Mutter sehr gut, 18 ziemlich gut und fünf ein wenig, während 22 ihr Verhältnis zum Vater als sehr gut, 22 als ziemlich gut, sechs als ein wenig gut und zwei als schlecht bezeichneten. Nur etwa 10% der Jugendlichen waren mit ihren Adoptiveltern tendenziell unzufrieden; knapp 20% fühlten sich nicht völlig wie ein leibliches Kind.
Die Beziehung zu Geschwistern aber etwas negativer beurteilt als von Jugendlichen der Kontrollgruppe. Auch waren diejenigen Adoptierten mit ihrer Situation tendenziell weniger zufrieden, die mit leiblichen Kindern der Adoptiveltern zusammen aufwuchsen. Seglow, Pringle und Wedge (1972) stellten jedoch bei einer größeren Stichprobe britischer Adoptivkinder fest, dass 80% ein gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern hatten.
Keller-Thoma (1987) ermittelte bei der Befragung von 42 schweizerischen Adoptierten, dass sich 93% in Familie und Verwandtschaft (wie ein Kind) angenommen fühlten und ihre Beziehung zu den Adoptiveltern als gut bis sehr gut beurteilten. 57% würden nichts an der Erziehung ihrer Eltern ändern wollen; nur 10% kritisierten diese sehr. Auch erlebten es 48% der Adoptierten als nicht oder wenig schwer, sich von zu Hause abzulösen. Marquis und Detweiler (1985) ermittelten bei einer Vergleichsuntersuchung mit 46 amerikanischen Adoptierten im Alter von 13 bis 21 Jahren, dass diese ihre Eltern positiver als Gleichaltrige beurteilten.
Adoptierte haben nur gelegentlich das Gefühl, nicht richtig zur Familie zu gehören (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Lindsay/McGarry 1984). Auch scheint die Eltern-Kind-Beziehung nur selten weniger tragfähig, belastbar, sicher und stabil zu sein als in biologischen Familien (Jungmann 1980b). Vereinzelt resultieren Probleme daraus, dass in einigen Fällen ein relativ großer Altersunterschied zwischen Adoptivkindern und ihren Eltern besteht; so finden zum Beispiel erstere manchmal nicht genug Verständnis für Pubertätskonflikte oder Identitätsprobleme (Sorosky/Baran/Pannor 1982). Manche Adoptierte sind auch damit unzufrieden, dass das Thema "Adoption" tabuisiert wird - beispielweise berichteten 10% der von Keller-Thoma (1987) befragten 42 schweizerischen Adoptierten, dass diese Thematik daheim totgeschwiegen wird; weitere 14% sprachen von Geheimnistuerei. In 43% der Fälle wurde im Beisein der Befragten auch außerhalb der Familie über die Adoption gesprochen. Vereinzelt greifen Adoptivkinder dieses Thema auch in Auseinandersetzungen mit ihren Eltern auf, um diese zu verletzen (Lindsay/McGarry 1984).
Auch die Adoptiveltern erleben in der Regel die Beziehung zu ihrem Kind positiv. So ermittelten zum Beispiel Knoll und Rehn (1984/85) bei der Befragung von 65 deutschen Adoptivfamilien, dass 60 Elternpaare ihr Verhältnis zum Adoptivkind wie das zu einem leiblichen Kind beschrieben. Viele berichteten von großen Ähnlichkeiten in der Wesensart, im Charakter oder im Verhalten zwischen sich und dem Adoptivkind. Auch nehmen Adoptiveltern viel Anteil am Leben ihrer Kinder und kümmern sich intensiv um sie. Das führt jedoch oft zu einer Überbehütung und Verwöhnung der Adoptivkinder, wodurch deren Individuation und Ablösung beeinträchtigt werden können (Seglow/Pringle/Wedge 1972; Jungmann 1980a; Hoopes 1982; Schneider/Rimmer 1984). Auch haben viele Adoptiveltern Schwierigkeiten, Regeln und Verbote aufzustellen und für deren Beachtung zu sorgen. So ist ihr Erziehungsstil weniger autoritär als derjenige leiblicher Eltern (Bohman 1980; Hoopes 1982; Sorosky/Baran/Pannor 1982). Adoptiveltern tendieren ferner zu einer Überforderung ihrer Kinder, insbesondere hinsichtlich der Schulleistungen. Sie stellen aber auch große Ansprüche an Ordnung, Gehorsam und Auftreten der Adoptivkinder (Seglow/Pringle/Wedge 1972; Bohman 1980; Schneider/Rimmer 1984).
5. Verhältnis zu den leiblichen Eltern
Die meisten Adoptivkinder haben nur sehr spärliche Informationen über ihre leiblichen Eltern, insbesondere über ihre Väter. Zumeist sind sie überhaupt nicht über ihre Großeltern, eventuell vorhandene Geschwister und andere Verwandte informiert. So sind sie in der Regel darauf angewiesen, ihre eigene Vorgeschichte zu rekonstruieren, wobei Phantasien, Vermutungen, Wünsche und Ängste eine große Rolle spielen (Dukette 1984; Hoffmann-Riem 1984; Jänsch/Nutzinger 1986; Ebertz 1987). Ältere Kinder und Jugendliche sind sich auch bewusst, dass die Adoptiveltern eine gewisse Informationspolitik betreiben. So stellten Jänsch und Nutzinger (1986: 473) bei einem Wochenendtreffen mit 13 deutschen Adoptierten im Alter von 14 bis 22 Jahren Folgendes über die Vermittlung von Herkunftswissen fest: "Interessant für uns war, dass einige Jugendliche überzeugt waren, immerhin hierüber alles zu wissen, was auch ihren Adoptiveltern bekannt ist, während einige andere glaubten, dass diese ihnen etwas verschweigen würden, und einige die unrichtige Vorstellung hatten, dass es gesetzlich verboten sei, hierüber etwas zu erfahren."
Die meisten Adoptivkinder waren hellhörig für Widersprüche in den Aussagen der Adoptiveltern und nahmen deren Einstellungen gegenüber den leiblichen Eltern mehr oder weniger bewusst wahr (ebd.). Von den befragten schweizerischen Adoptierten (Keller-Thoma 1987) beurteilten 57% die Haltung der Adoptiveltern ihrer Herkunft gegenüber als wohl wollend, 31% als gleichgültig und 5% als abwertend.
Generell ist ein großes Interesse von Adoptierten an ihrer Herkunft festzustellen, das sich manchmal schon im Alter von vier oder fünf Jahren zeigt und besonders stark in Pubertät und Jugendalter ausgeprägt ist, aber auch im frühen Erwachsenenalter und bei normativen beziehungsweise nichtnormativen Lebensereignissen auftritt (American Academy of Pediatrics. Commitee on Adoptions 1971; Triseliotis 1973; Hoffmann-Riem 1984; Plog 1984; Jänsch/Nutzinger 1986; Ebertz 1987; Keller-Thoma 1987). Knoll und Rehn (1984/85) stellten bei ihrer Untersuchung über 65 deutsche Adoptivfamilien fest, dass vier adoptierte Jugendliche sehr oft, sieben oft, 13 manchmal, 17 selten und 11 nie an die Zeit vor der Adoption dachten. Somit ist ihr Interesse sehr viel stärker, als viele Adoptiveltern meinen. Es wird zumeist aus Liebe zu ihnen nicht gezeigt, da die Adoptierten spüren, dass Fragen nach ihrer Herkunft Ängste und Besorgnis auslösen. Häufig soll auch nicht die von allen Seiten aufrechterhaltene Illusion zerstört werden, dass Adoptivkinder wie leibliche Kinder seien (Knoll/Rehn 1984/85; Plog 1984). Wird das Thema "Herkunft" doch einmal seitens der Adoptiveltern angesprochen, dann bricht oft zu deren Überraschung eine wahre Flut von Fragen und Gefühlen über sie herein. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird deutlich, dass die Vorgeschichte ein wichtiger Bestandteil der Lebenswirklichkeit von Adoptivkindern ist - und von großer Bedeutung für deren Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsintegration (American Academy of Pediatrics. Committee on Adoptions 1971; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Hoffmann-Riem 1984; Ebertz 1987). Manche Adoptierte suchen als Jugendliche oder junge Erwachsene nach weiteren Informationen über ihre Herkunft oder möchten ihre leiblichen Eltern kennen lernen, wobei sie jedoch ambivalente Gefühle diesbezüglich und Angst vor einer erneuten Ablehnung haben. Kommt es zu einem Zusammentreffen, entsteht aber nur selten eine engere Beziehung (Knoll/Rehn 1984/85; Stein/Hoopes 1985; Jänsch/Nutzinger 1986; Ebertz 1987; Keller-Thoma 1987; Textor 1990, 1992).
Adoptivkinder empfinden eher positive Gefühle für die leiblichen Mütter als für die Väter. So brachten 85% von 42 schweizerischen Adoptierten ihrer Mutter Wohlwollen und Verständnis entgegen - jedoch nur 64% gegenüber dem Vater. 12% machten der Mutter, 34% dem Vater Vorwürfe (Keller-Thoma 1987). Laut Knoll und Rehn (1984/85) hielten fünf Adoptierte die leibliche Mutter für sehr sympathisch, acht für eher sympathisch, neun für eher unsympathisch und vier für sehr unsympathisch; neun wählten eine neutrale Position. Zwei Adoptierte hielten den biologischen Vater für sehr sympathisch, fünf für eher sympathisch, sieben für eher unsympathisch und zehn für sehr unsympathisch; weitere zehn wählten die neutrale Position. Eine kleine Minderheit empfand aber auch der Mutter gegenüber Zorn, Unverständnis und Rachegefühle. In diesen Fällen erlebten die Adoptierten die Freigabeentscheidung wahrscheinlich besonders stark als narzisstische Kränkung und Zurückweisung (Roberts/Robie 1981; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Schneider/Rimmer 1984). So beurteilten nach Knoll und Rehn (1984/85) 12 von 46 Adoptierten deren Freigabeentscheidung als Zeichen fehlenden Interesses (an ihnen) und nur 12 als verantwortungsbewusst.
Aufgrund der mangelnden Informationen und des fehlenden persönlichen Kontaktes sind die leiblichen Eltern oft geheimnisumwittert, ranken sich positive und negative Phantasien um sie. Stein und Hoopes (1985) ermittelten, dass 70% von 50 amerikanischen Adoptierten im Alter von 15 bis 18 Jahren über die biologischen Eltern phantasierten. Laut Keller-Thoma (1987) beschäftigten sich 19% von 42 schweizerischen Adoptierten häufig in Vorstellungen und Phantasien mit der leiblichen Mutter und 12% mit dem Vater. In den Gedankengebilden können die Eltern zum Beispiel positiv als Adlige, als reiche, bezaubernde und junge Personen oder negativ als Prostituierte, Verbrecher oder psychisch Kranke dargestellt werden. Bei unbefriedigenden Familienverhältnissen erscheinen sie in der Vorstellung oft auch als Retter. So können Adoptivkinder gute und schlechte Eigenschaften jeweils verschiedenen Elternpaaren zuschreiben, die einen idealisieren und die anderen verdammen (Jungmann 1980a; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Bagley 1986; Jänsch/Nutzinger 1986). Vereinzelt treten Probleme auf, wenn sie sich dann mit derartig idealisierten leiblichen Eltern identifizieren und von den Adoptiveltern distanzieren (Huth 1980).
6. Kognitive und schulische Entwicklung der Adoptivkinder
Die meisten Untersuchungen über die Intelligenzentwicklung und schulischen Leistungen von Adoptivkindern kamen laut Jungmann (1980a) zu dem Ergebnis, dass sich diese kaum von anderen Kindern unterscheiden. Selbst bei einem problematischen biologischen Hintergrund könne die intellektuelle Entwicklung zumeist in durchschnittliche Bahnen gelenkt werden. Knoll und Rehn (1984/85) stellten bei ihrer Untersuchung über 65 deutsche Adoptivfamilien fest, dass fast ein Drittel der Kinder einmal eine Klasse wiederholt hatte und nur wenige ein Gymnasium besuchten. Generell waren 11 Adoptiveltern mit den schulischen Anstrengungen ihrer Kinder sehr zufrieden, 18 zufrieden, sieben unzufrieden und vier sehr unzufrieden, während 25 eine neutrale Position wählten. Die adoptierten Jugendlichen selbst berichteten jedoch keinesfalls häufiger als Gleichaltrige aus der Kontrollgruppe von Schulschwierigkeiten. Allerdings wurde im Gegensatz zu diesen eher von Problemen im Leistungsbereich als in den zwischenmenschlichen Beziehungen gesprochen. Jungmann (1987) berichtete, dass die Eltern der von ihm untersuchten 92 Berliner Adoptivkinder im Alter von neun bis 13 Jahren seltener Störungen im Leistungsverhalten nannten als die Eltern der Kontrollgruppe, aber etwas häufiger Klassenwiederholung und Konzentrationsstörungen.
Bohman (1980) ermittelte bei der Untersuchung über 168 schwedische Adoptivkinder im Alter von 10 bis 11 Jahren, dass 6% der Jungen und 5% der Mädchen eine Sonderschule besuchten, was dem landesüblichen Durchschnitt entsprach. Von ihren Noten her waren Adoptivkinder ansonsten in Schwedisch gleich gut wie ihre Klassenkameraden; in Mathematik lagen sie ein wenig unter dem Niveau ihrer Mitschüler. Eine Nachuntersuchung (Bohman/Sigvardsson 1980) zum Zeitpunkt, als die Kinder das 15. Lebensjahr erreicht hatten, ergab, dass Jungen signifikant niedrigere Durchschnittsnoten als ihre Klassenkameraden in Mathematik und Englisch hatten; in Schwedisch, Sozialkunde ("civics") und Werken ("handicraft") gab es keine Unterschiede. Adoptierte Mädchen hatten nur in Englisch signifikant schlechtere Noten. Jedoch waren die Unterschiede zur Kontrollgruppe bei beiden Untersuchungen sehr klein.
Nach der repräsentativen Studie von Seglow, Pringle und Wedge (1972) über britische Adoptivkinder im Alter von etwa sieben Jahren wurden deren Sprachfertigkeiten von den Lehrern in 37% der Fälle als überdurchschnittlich bezeichnet. Ihre Leistungen in Lesen und Rechnen sowie ihre kreativen Fähigkeiten wurden als durchschnittlich beurteilt. Nach dem "Southgate Test" lagen die Lesefertigkeiten der Adoptivkinder jedoch über dem Durchschnitt, wobei Jungen besser als Mädchen abschnitten. Die Lehrer waren auch der Meinung, dass die Adoptivkinder besser über das Weltgeschehen um sie herum informiert wären als ihre Klassenkameraden. Kein Kind war für die Sonderschule vorgesehen. Eine Nachuntersuchung (Lambert/Streather 1980) über dieselbe Gruppe von Adoptivkindern, die nun im 11. Lebensjahr waren, ergab, dass sie in Lesen weiterhin über dem Durchschnitt lagen und in Mathematik durchschnittliche Leistungen erbrachten. Generell verschlechterten sich die Schulleistungen adoptierter Jungen in den vier Jahren nach der ersten Studie.
7. Sozialverhalten der Adoptivkinder
Laut Jungmanns (1980a) Literaturstudie wurden bei den meisten Untersuchungen über die Entwicklung des sozialen Verhaltens von Adoptivkindern keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu leiblichen Kindern ermittelt, was sowohl für die Auswertung von Persönlichkeitsfragebögen und projektiven Tests als auch für Befragungen gelte. Nur bei adoptierten Jungen seien vereinzelt Tendenzen in Richtung auf Feindseligkeit gegenüber Mitschülern, niedriger Status in der Gruppe, häufigere interpersonale Konflikte, Rückzug von anderen, größere Ängstlichkeit, Empfindlichkeit gegen Kritik und stärkere Abhängigkeit von der Anerkennung durch andere festgestellt worden. Bei seiner eigenen Untersuchung über 92 Berliner Adoptivkinder im Altern von neun bis 13 Jahren ermittelte Jungmann (1987), dass die Adoptiveltern weniger als halb so oft wie die Eltern der Kontrollgruppe von Verhaltensstörungen ihrer Kinder gegenüber Erwachsenen und anderen Kindern berichteten (13% in der Vorschul- beziehungsweise 8% in der Schulzeit versus 18 bis 20%). Nur Aggressivität wurde häufiger als Problem genannt. Mehr Auffälligkeiten im Sozialverhalten wurden bei höherem Alter der Eltern (insbesondere der Mütter), bei höherer Schichtzugehörigkeit der Eltern, bei erlebter Ehescheidung und bei besonders hohen Leistungserwartungen genannt; ein Einfluss der erfassten Angaben über die Herkunftsfamilie, der Dauer von Heimaufenthalten, des Platzierungsalters und des Zeitpunkts der Aufklärung über die Adoption war nicht zu ermitteln. Knoll und Rehn (1984/85) ermittelten bei ihrer Untersuchung über deutsche Adoptierte, dass sie keine nennenswerten Probleme in ihrem Verhältnis zu Mitschülern hatten, und bezeichneten ihre soziale Integration als geglückt. Signifikante Unterschiede zur Kontrollgruppe wurden nicht entdeckt. Keller-Thoma (1987) erfuhr bei ihrer Befragung von schweizerischen Adoptierten, dass 88% als Kind gute Freunde hatten und 7% Außenseiter waren.
Bohmans (1980) Untersuchung über 168 schwedische Adoptivkinder im Alter von etwa zehn Jahren ergab, dass es laut dem Urteil ihrer Lehrer keine signifikanten Unterschiede zwischen ihnen und ihren Mitschülern hinsichtlich ihrer Aktivität (gilt nur für adoptierte Mädchen), ihrer Ordentlichkeit, ihrer Neigung zu Konflikten mit Klassenkameraden (gilt nur für Mädchen) und Lehrern, ihres Status im Klassenverband, ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Bereitschaft gab, initiativ tätig zu werden. Signifikante Ergebnisse wurden nur für Adoptivjungen ermittelt, die als unruhiger und als eher zu Konflikten mit anderen Schülern bereit bezeichnet wurden. Bei der Nachuntersuchung (Bohman/Sigvardsson 1980) - die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt - sahen Lehrer jedoch keinerlei Unterschiede mehr zwischen deren Verhalten und dem ihrer Mitschüler.
Auch britische Forschungsarbeiten (Seglow/Pringle/Wedge 1972; Lambert/Streather 1980) ergaben, dass Lehrer nur minimale Unterschiede zwischen dem Sozialverhalten von Adoptivkindern und dem ihrer Mitschüler fanden und ebenfalls Adoptivjungen etwas schlechter beurteilten als adoptierte Mädchen. Die soziale Anpassung dieser Kinder wurde etwas positiver gesehen, als sie sieben Jahre alt waren, als bei der Nachuntersuchung, bei der sie das 11. Lebensjahr erreicht hatten. Eine amerikanische Studie (Festinger 1986) über 130 adoptierte und 130 nichtadoptierte Kinder kam zu dem Ergebnis, dass Adoptivkinder von ihren Müttern in ihrem Sozialverhalten als weniger kompetent beurteilt wurden. In Kadushins (1970) Untersuchung über ältere Adoptivkinder wurde deren generelle Beziehungsfähigkeit in 21 Fällen als gut, in 51 als befriedigend, in 17 als zweifelhaft und in zwei als schlecht eingestuft. Eindeutige Aussagen über das Sozialverhalten von Adoptivkindern lassen sich anhand dieser Forschungsergebnisse also nicht machen.
8. Persönlichkeitsentwicklung und Haltung der Adoptivkinder zur Adoption
Über die Persönlichkeitsentwicklung von Adoptivkindern liegen widersprüchliche wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Beispielsweise berichteten Seglow, Pringle und Wedge (1972), dass sich die bei ihrer repräsentativen Vergleichsuntersuchung erfassten 145 britischen Adoptivkinder im Alter von sieben Jahren laut Eltern- und Lehrerurteil so gut wie der nationale Durchschnitt oder sogar besser entwickeln würden und zu 82% sozial angepasst seien. Auch die von Hoopes (1982) untersuchten 260 amerikanischen Adoptivkinder im Alter von fünf Jahren wurden von ihren Eltern sehr positiv beurteilt. Allerdings stellten die Mitarbeiter von Hoopes bei Hausbesuchen fest, dass sie bei der Durchführung vorgegebener Aufgaben etwas ängstlicher, unwilliger, unkonzentrierter und gehemmter sowie weniger selbstsicher und durchsetzungskräftig als Kinder aus der Kontrollgruppe waren. Marquis und Detweiler (1985) ermittelten bei einer Vergleichsuntersuchung, dass die erfassten 46 amerikanischen Adoptierten im Alter von 13 bis 21 Jahren mehr Selbstvertrauen und innere Kontrolle zeigten, sich eher als Lenker ihres Schicksals sahen, sich mehr auf ihr eigenes Urteil verließen und andere Menschen positiver beurteilten.
Jedoch gibt es auch viele Fachleute, die von großen Minderwertigkeitsgefühlen, geringer Selbstachtung und mangelndem Selbstbewusstsein bei Adoptivkindern berichteten (Roberts/Robie 1981; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Ebertz 1987), auf etwas niedrigere schulische und berufliche Ziele verwiesen (Stein/Hoopes 1985) oder eine leicht verzögerte Entwicklung hinsichtlich normativer Lebensereignisse feststellten (Knoll/Rehn 1984/85). Manche Fachleute berichten von Identitätsstörungen und der Ausbildung einer negativen Identität bei Adoptivkindern, insbesondere während der Pubertät beziehungsweise Adoleszenz. Viele hätten das Gefühl, nirgendwo wirklich hinzugehören, würden sich andersartig und unvollkommen erleben (Mackie 1982; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Brodzinsky et al. 1984; Lindsay/McGarry 1984; Ebertz 1987).
Als mögliche Gründe für diese Identitätsprobleme gelten zum Beispiel die fehlende biologische Bande und genealogische Verankerung, die mangelnde lebensgeschichtliche Kontinuität, der Informationsmangel über die Zeit vor der Adoption, die weniger stark ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühle, Ängste wegen des Erbguts und die Schwierigkeit, zwei Genealogien in einer Identität zu integrieren. Andere Gründe mögen das Stigma der unehelichen Geburt, Störungen in den frühkindlichen Objektbeziehungen und Komplikationen bei der Lösung des Ödipuskonflikts sein. Zudem würden manche Adoptierte glauben, dass niemand sie als Kind haben wollte, dass sie unerwünscht waren und abgelehnt wurden (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Jungmann 1980a; Mackie 1982; Ebertz 1987).
Auch die doppelte Elternschaft mag Identitätskonflikte verursachen (Brodzinsky et al. 1984). So schreibt Aselmeier-Ihrig (1984: 239): "Für Adoptivkinder liegt in der Existenz zweier Elternpaare ein Risiko für das Gelingen der Identitätsbildung. Gerade das undeutliche Vorhandensein eines Elternpaares, das in der Phantasie des Kindes gewünschte, abgelehnte, vage oder fest umrissene Züge annehmen mag, kann die Entwicklung des Ich-Gefühls über den Weg der Identifizierung mit dem elterlichen Vorbild erschweren."
Beispielweise haben Adoptivkinder die Möglichkeit, sich entweder mit den realen Adoptiveltern oder mit den in ihrer Phantasie ausgestalteten leiblichen Eltern zu identifizieren, mögen sie eine negative Identität aufgrund der Identifikation mit den "schlechten" biologischen Eltern entwickeln, kann es in ihrem Inneren zur Teilung zwischen einer Welt der Realität und der Phantasie oder zu deren Vermischung kommen (Huth 1980).
Ebertz (1987), die zehn deutsche Adoptierte im Alter von 18 bis 30 Jahren befragte, konzeptualisierte deren Identitätsprobleme in Anlehnung an Festingers "Theorie der kognitiven Dissonanz" als Dissonanzerfahrungen, das heißt als einander widersprechende Elemente oder Aspekte von Vorstellungen über sich selbst. Dissonanzen, die letztlich auf einen Konflikt zwischen Adoptivstatus und familialem Normalitätsmuster zurückgeführt werden können, werden zumeist durch soziale Ausgrenzung, Diskriminierung, Zuschreibung oder Verleumdung seitens von Nachbarn, Bekannten, Freunden und Verwandten erzeugt. Sie sind - je nach der Häufigkeit und Stärke negativer Umweltreaktionen - von unterschiedlicher Intensität. Adoptivkinder erleben diese Dissonanzen als psychisch unangenehm und setzen verschiedene Strategien zu deren Reduktion ein. Ebertz (1987: 143 f.) schreibt: "Adoptierte mit eher ‚schwach‘ einzuschätzenden Dissonanzen versuchen, diese vor allem durch Hinzufügen neuer kognitiver Elemente im Sinne einer Normalisierung und Angleichung an Kernbestandteile des familialen Normalitätsmusters zu reduzieren. Adoptierte mit ‚stark‘ bis ‚sehr stark‘ eingestuften Dissonanzen folgen ebenfalls der oben genannten Strategie. Da sie jedoch aufgrund der hohen psychischen Belastung bestrebt sind, die bestehenden Dissonanzen zu beseitigen, lassen sich bei ihnen auch aufwendigere Reduktionsformen, nämlich durch die Veränderung eines oder mehrerer kognitiver Elemente der Umwelt oder sogar des eigenen Verhaltens beziehungsweise Status beobachten."
So werden zum Beispiel Personen, die einen Adoptierten diskriminieren oder verleumden, zur Rede gestellt oder gemieden. Manche Adoptierte wechseln auch den Wohnsitz und verschweigen in der neuen Umgebung ihren Adoptivstatus, während einige im Extremfall ihre leiblichen Eltern suchen, zu ihnen ziehen und somit den "normalen" Status eines leiblichen Kindes annehmen. Nach Ebertz (ebenda) gelingt es aber nicht allen, die bestehenden Dissonanzen zu reduzieren und ihre Identität zu stabilisieren, sodass die Adoption zu einem psychisches Unbehagen erzeugendes Dauerproblem wird.
Bei einigen anderen Untersuchungen wurden jedoch keine Identitätskonflikte bei Adoptierten ermittelt (Aumend/Barrett 1984; Triseliotis 1984; Pierce 1986). Knoll und Rehn (1984/85: 115) stellten bei ihrer Untersuchung von 65 deutschen Adoptivfamilien über das Selbstbild der Adoptierten Folgendes fest: "Das Gesamtergebnis beim Vergleich des beschriebenen Selbstkonzepts fügt sich in die Reihe der bisher genannten Ergebnisse ein und überrascht nicht: die adoptierten Jugendlichen hatten in Bezug zur Kontrollgruppe der nichtadoptierten Jugendlichen fast auf allen Faktoren identische Werte."
Sie schnitten sogar teilweise noch besser ab. Stein und Hoopes (1985) ermittelten bei ihrer Vergleichsuntersuchung mit 50 amerikanischen Adoptierten im Alter von 15 bis 18 Jahren, bei der sie verschiedene Testverfahren einsetzten, ebenfalls keine negativeren Werte für Adoptivkinder. Diese erzielten sogar ein besseres Ergebnis auf der "Tan Ego Identity Scale". Stein und Hoopes versuchen, die negativen Befunde anderer Fachleute damit zu erklären, dass diese zumeist von Psychotherapeuten und Psychiatern an klinischen Stichproben gewonnen wurden oder auf der Befragung Freiwilliger beruhten, unter denen unter Umständen unzufriedene oder psychisch gestörte Adoptierte stärker vertreten sind. Allgemein akzeptiert dürfte aber sein, dass die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung von Adoptivkindern positiver verläuft, wenn sie möglichst jung adoptiert und frühzeitig über ihren Status aufgeklärt wurden, wenn die Adoptiveltern eine akzeptierende Haltung zu ihrer Vorgeschichte einnehmen, wenn über die Adoption offen diskutiert werden kann und wenn die Eltern-Kind-Beziehung gut ist (Sorosky/Baran/Pannor 1982; Knoll/Rehn 1984/85; Stein/Hoopes 1985; Ebertz 1987).
Selbstverständlich ist das Faktum der Adoption von großer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder. Heute werden die meisten Adoptivkinder bereits im Kleinkindalter über ihren Sonderstatus aufgeklärt - wobei diese Situation für viele Adoptiveltern angsterzeugend ist. Generell scheinen wohl nur wenige auf die Aufklärung über ihren Status mit Angst, Verwirrung oder Schock zu reagieren (Seglow/Pringle/Wedge 1972; Aumend/Barrett 1984; Knoll/Rehn 1984/85). Jedoch muss man ihr Alter zu diesem Zeitpunkt beachten - erst Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren verstehen, was Adoption wirklich meint (Farber 1977; Lindsay/McGarry 1984; Brodzinsky/Schechter/Brodzinsky 1986). Der Umgang mit dem Adoptivstatus ist dann einerseits von den Reaktionen, Vorurteilen, Stereotypen und Zuschreibungen der Umwelt abhängig, die auch im Zusammenhang mit einer gewissen Neugier und Faszination seitens der Gesellschaft stehen (Huth 1980; Triseliotis 1984; Ebertz 1987). 15 von 53 adoptierten Jugendlichen hatten laut der Untersuchung von Knoll und Rehn (1984/85) schon Situationen erlebt, in denen sie sich gewünscht hatten, kein Adoptivkind zu sein. Auch sprachen zwei von 13 Adoptierten im Alter von 14 bis 22 Jahren, die an einer von Jänsch und Nutzinger (1986) organisierten Wochenendveranstaltung teilnahmen, von negativen Umweltreaktionen. Andererseits ist der Umgang mit dem Adoptivstatus abhängig von der eigenen Definition (Triseliotis 1984; Ebertz 1987). Ebertz (1987: 147) stellte bei der Befragung von zehn Adoptierten im Alter von 18 bis 30 Jahren fest, dass sie zur Ablehnung von Unterschieden zwischen Adoptiv- und biologischen Familien tendierten: "Es konnte gezeigt werden, dass sich die befragten Adoptierten am gesellschaftlich dominanten Normalitätsmuster von Familie orientieren. Sie sind bemüht, sich im Vergleich mit anderen in eine Familie Hineingeborenen als normal darzustellen."
Die Haltung der meisten Adoptierten zur Adoption scheint generell positiv zu sein. So zeigten 90% von 42 schweizerischen Adoptierten eine positive Einstellung; 93% würden grundsätzlich selbst ein Kind adoptieren. Zudem war für 62% der Befragten die Adoption keine und für 31% nur zeitweise eine Belastung; 48% waren sogar stolz auf ihr Adoptiertsein (Keller-Thoma 1987). Auch 32 von 52 deutschen Adoptierten belastete das Bewusstsein, ein Adoptivkind zu sein, überhaupt nicht, weitere sieben nur wenig und zehn etwas. 45 wären bereit, später selbst ein Kind zu adoptieren (Knoll/Rehn 1984/85). Laut einer amerikanischen Vergleichsuntersuchung (Stein/Hoopes 1985) mit 50 Adoptierten im Alter von 15 bis 18 Jahren erlebten die meisten keine negativen Auswirkungen des Adoptivstatus auf den Familienbereich (98%), den Freundeskreis (94%), die soziale Sphäre (98%) und die Selbstachtung (88%); einige berichteten sogar, dass die Adoption ihre Selbstwertgefühle vergrößern würde. Mit Ausnahme von zwei Adoptierten fühlten sie sich nicht anders als andere Jugendliche.
9. Psychische Probleme und Verhaltensstörungen der Adoptivkinder
Relativ viele wissenschaftliche Untersuchungen gingen der Frage nach, ob Adoptivkinder häufiger unter psychischen Problemen und Verhaltensstörungen leiden als der Durchschnitt der Bevölkerung. Beispielsweise ermittelten Knoll und Rehn (1984/85), dass mehr als ein Drittel der von ihnen befragten 65 deutschen Elternpaare im Zeitraum vor der Untersuchung keine auffälligen Verhaltensweisen ihrer Adoptivkinder (Jugendliche) feststellten. 17 berichteten jedoch von Schulschwierigkeiten, 13 von dem Bestreben ihrer Kinder, oft im Mittelpunkt stehen zu wollen, 13 von mangelnder Ausdauer und 12 von Konzentrationsstörungen. Jungmann (1987) stellte fest, dass 81% der Adoptiveltern gegenüber 66% der Eltern der Vergleichsgruppe keine emotionalen Belastungen oder Auffälligkeiten in der Stimmungslage bei den von ihm untersuchten 92 Berliner Adoptivkindern (neun bis 13 Jahre) nannten. Sie berichteten nur vereinzelt von motorischer Unruhe, Aggressivität sowie von Schlaf-, Eß- und Konzentrationsstörungen. Eine andere deutsche Untersuchung über 56 Adoptivkinder im Alter von drei bis zehn Jahren (Röthlein 1984) ergab, dass von den Eltern bei 22% Störungen im Sozialverhalten (zum Beispiel Scheu, anklammerndes Verhalten, Aggressivität), bei 15% Leistungsstörungen (zum Beispiel mangelnde Konzentration oder Ausdauer) und bei 5% psychosomatische Beschwerden bemerkt wurden. Jedoch wäre das abweichende Verhalten nicht besonders stark ausgeprägt und würde eher selten auftreten.
Seglow, Pringle und Wedge (1972) ermittelten bei ihrer repräsentativen Untersuchung über britische Adoptivkinder im Grundschulalter, dass (nach den "Bristol Social Adjustment Guides") 17% gegenüber durchschnittlich 13% von ihren Lehrern als "unangepasst" beurteilt wurden. Dabei schnitten männliche Adoptivkinder sehr viel schlechter (25% gegenüber durchschnittlich 17%) und weibliche besser (6% gegenüber durchschnittlich 10%) als ihre Mitschüler ab. Die genannten Wissenschaftler stellten auch fest, dass männliche Adoptivkinder aus Mittelschichtsfamilien eher als unangepasst bezeichnet wurden als solche aus Arbeiterfamilien - in der gesamten nationalen Stichprobe herrschte jedoch der entgegengesetzte Trend vor. Generell wurden Kinder, die in einem höheren Lebensalter adoptiert wurden, schlechter beurteilt.
Bohman (1980) stellte bei seiner Untersuchung über 168 schwedische Adoptivkinder im Alter von zehn bis 11 Jahren fest, dass vor allem Jungen im Lehrerurteil sehr viel schlechter als Gleichaltrige aus der Kontrollgruppe abschnitten. So wiesen 22% der Adoptivjungen Anpassungsprobleme und 35% mäßige Symptome auf im Vergleich zu 12% beziehungsweise 18% der Kontrollgruppe. Laut Lehrerurteil litten 11% der weiblichen Adoptivkinder gegenüber durchschnittlich 5% unter Anpassungsproblemen - dieses Ergebnis war jedoch nicht signifikant. Vor allem wurden gestörte Beziehungen zu Gleichaltrigen, Unruhe und Aggressivität beobachtet. Interessant ist, dass Adoptiveltern bei dieser Untersuchung bedeutend weniger Symptome als Lehrer angaben und dass in nur 30% der Fälle bei männlichen und in 12% der Fälle bei weiblichen Adoptivkindern Übereinstimmung zwischen Eltern und Lehrern bezüglich der Symptome herrschte. Bohman folgerte, dass diese die Kinder verschieden wahrnahmen, da sie sie in unterschiedlichen Situationen erlebten, und dass viele Adoptiveltern die Probleme ihrer Kinder zu bagatellisieren schienen. Er erklärte die Überrepräsentation von Verhaltensstörungen bei (männlichen) Adoptivkindern mit der Unsicherheit und Ambivalenz der Adoptiveltern, ihren psychischen Problemen, ihren zu hohen und die Kinder überfordernden Erwartungen sowie mit ihrer Einstellung zur Adoption als einem Mittel zur Lösung des Problems der Kinderlosigkeit. Bei einer Nachuntersuchung mit derselben Stichprobe - zu diesem Zeitpunkt waren die Adoptierten 15 Jahre alt - kamen Bohman und Sigvardsson (1980) jedoch zu einem ganz anderen Ergebnis: Nur 4,5% der männlichen und 1,4% der weiblichen Adoptivkinder wurden als unangepasst beurteilt - im Vergleich zu 5,8% beziehungsweise 2,9% der Kontrollgruppe. Nur drei von ehemals 27 Problemkindern waren noch verhaltensauffällig.
Lindholm und Touliatos (1980) ließen das Verhalten von 3.032 amerikanischen Kindern, unter denen sich 41 Adoptivkinder befanden, von deren Lehrern anhand der "Quay's Behavior Problem Checklist" beurteilen. Sie stellten fest, dass bei Adoptivkindern (insbesondere bei Jungen) nur "conduct problems" signifikant häufiger waren. Brodzinsky und Mitarbeiter (1984) verglichen 130 adoptierte Kinder im Alter von sechs bis 11 Jahren mit 130 nichtadoptierten, wozu sie standardisierte Fragebögen von deren Müttern und Lehrern ausfüllen ließen. Männliche Adoptierte wurden im Vergleich zur Kontrollgruppe als etwas unangepasster, verschlossener und aggressiver sowie als eher hyperaktiv und "delinquent" beurteilt, weibliche als depressiver, zurückgezogener, aggressiver und unangepasster sowie häufiger als hyperaktiv. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen zeigten Mädchen eine größere Spannbreite von Verhaltensstörungen und Anpassungsschwierigkeiten als männliche Adoptierte. Trotz der schlechteren Beurteilung ihres Verhaltens hielten sich jedoch alle Abweichungen im normalen Rahmen.
Überblickt man diese Untersuchungen, denen nichtklinische Stichproben von Adoptierten zugrunde lagen, so lässt sich nicht eindeutig sagen, ob Adoptivkinder mehr als Gleichaltrige unter psychischen Problemen und Verhaltensstörungen leiden oder ob die Abweichungen vom Durchschnitt nur minimal und unbedeutend sind. Ähnliches gilt für Untersuchungen mit klinischen Stichproben. Huth (1978) stellte eine Übersicht über 12 Studien aus den Jahren 1953 bis 1966 zusammen, die sich auf 13.903 Kinder bezogen, die in verschiedenen Ländern an Erziehungsberatungsstellen, Polikliniken und anderen Einrichtungen psychologisch oder psychiatrisch betreut wurden. Der Anteil der Adoptierten an diesen Stichproben lag zwischen 1,5% und 13,3% beziehungsweise im Durchschnitt um 7%. Damit war er etwa doppelt so hoch, wie anhand des prozentualen Anteils von Adoptivkindern an der Bevölkerung zu erwarten war. Zu einem ähnlichen Resultat kam auch Jungmann (1980a), der ebenfalls 12 Studien auswertete. Diese Forschungsergebnisse lassen sich aber auch dadurch erklären, dass Adoptivkinder in der Regel in Mittelschichtsfamilien aufwachsen und diese überproportional unter den Klienten von Erziehungsberatungsstellen, Polikliniken und ähnlichen Einrichtungen vertreten sind, dass Adoptiveltern eventuell unsicherer und ängstlicher als andere Eltern sind und deshalb eher zum Besuch derartiger Institutionen tendieren oder dass die Tatsache der Adoption unter Umständen Eltern eher zur Konsultation eines Therapeuten veranlasst (Seglow/Pringle/Wedge 1972; Huth 1978; Jungmann 1980a, 1987).
Jungmann (1980b) führte eine Untersuchung an der Abteilung für Psychiatrie und Neurologie des Kindes- und Jugendalters des Universitätsklinikums Charlottenburg durch, wobei er die Unterlagen über 2.210 zwischen 1976 und 1978 vorgestellte Kinder und Jugendliche auswertete. Er ermittelte, dass Adoptivkinder nicht überrepräsentiert waren und dass sie etwas häufiger wegen Störungen im Sozialverhalten vorgestellt wurden. Auch wurde häufiger als sonst keine psychiatrische Diagnose gestellt, was unter anderem an Folgendem lag: "Bei 10 Patienten teilten die Untersucher den Eindruck mit, dass die Eltern die Störungen oder Auffälligkeiten ihres Kindes agravierten"(Jungmann 1980b: 227). Zudem wurde bei neun von insgesamt 28 Fällen ein Bestreben der Adoptiveltern vermerkt, die Kinder aus ihrer Familie auszustoßen.
Brinich (nach Curtis 1986) stellte bei einer im Jahr 1982 veröffentlichten Untersuchung über 5.135 psychiatrische Patienten (nur Erwachsene) in Kalifornien fest, dass Adoptierte unterrepräsentiert waren und dass es hinsichtlich der Krankheitsbilder keine signifikanten Unterschiede gab. Bohman und von Knorring (1979), die 2.118 schwedische Adoptierte (nur Erwachsene) anhand von Krankenversicherungsunterlagen studierten und mit einer gleichartigen Kontrollgruppe verglichen, ermittelten jedoch, dass 19,1% der Adoptierten gegenüber 12,8% der Vergleichsgruppe mindestens zwei Wochen mit einer psychiatrischen Diagnose krankgeschrieben waren, wobei Suchtkrankheiten und Persönlichkeitsstörungen überrepräsentiert waren. Andere Untersuchungen sprachen von einem Vorherrschen von Charakter-, Verhaltens- und sozialen Störungen - neurotische Probleme, Depressionen und Phobien traten hingegen unterdurchschnittlich oft auf (Huth 1978; Jungmann 1980a; Mackie 1982).
Somit führen auch Untersuchungen mit klinischen Stichproben zu keinen eindeutigen Ergebnissen. In den Forschungsberichten, nach denen Adoptierte im überdurchschnittlichen Maße unter psychischen und Verhaltensstörungen leiden, wurden verschiedene Ursachen für dieses Ergebnis genannt - wie beispielweise gestörte frühkindliche Beziehungen, späte Adoption, traumatische oder späte Aufklärung über den Adoptivstatus, Tabuisierung der Adoption, psychische Erkrankung der Adoptiveltern (insbesondere der Mütter), konfliktreiche Ehebeziehungen beziehungsweise Ehescheidung, Überforderung, Überbehütung, starke Kontrolle, Erziehungsunsicherheit, kein Setzen von Grenzen oder Zurückweisung (Huth 1978; Jungmann 1980b, 1987; Sorosky/Baran/Pannor 1982; Brodzinsky et al. 1984; Röthlein 1984).
10. Ausblick
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entwicklung von Adoptivkindern in der Regel nicht wesentlich schlechter verläuft als die anderer Kinder. Bei Vergleichsuntersuchungen wurden Abweichungen vom Durchschnitt sowohl in den negativen als auch in den positiven Bereich hinein festgestellt. Für eine generell eher als normal zu bewertende Entwicklung spricht, dass laut einer Auswertung von 21 Untersuchungen über 3.636 Adoptivkinder (Kadushin 1970; Jungmann 1980a) etwa 85% der Adoptiveltern die Adoption als einen Erfolg bezeichneten beziehungsweise mit der Entwicklung ihrer Kinder zufrieden waren. Dieses Ergebnis wurde durch neuere Untersuchungen bestätigt (siehe zum Beispiel Knoll/Rehn 1984/85; Jungmann 1987; Perrez et al. 1989). Aber auch hier stellt sich die Frage, inwieweit diese Forschungsergebnisse verlässlich sind, da alle Stichproben nicht repräsentativ waren. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass Eltern mit adoptierten Kindern, die stark verhaltensauffällig sind oder in einem Kinderheim untergebracht wurden, aus Scham an diesen Befragungen nicht teilgenommen haben.
Abschließend ist festzuhalten, dass weitere wissenschaftliche Untersuchungen über Adoptivfamilien und -kinder notwendig sind. Dabei sollte versucht werden, möglichst große und repräsentative Stichproben auszuwählen und diese mit Kontrollgruppen aus Familien mit leiblichen Kindern zu vergleichen. Besonders sinnvoll wären Längsschnittuntersuchungen, damit die Entwicklung der ausgewählten Adoptivfamilien und -kinder über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt werden kann.
Auslandsadoptionen: Deutsche, niederländische und andere Forschungsergebnisse
René A.C. Hoksbergen
Heute darf man annehmen, dass die Auslandsadoption von Wissenschaftlern als ein wichtiges Thema entdeckt worden ist. Zu Beginn des Phänomens, vor etwa drei Jahrzehnten, hatten Fachorganisationen, Sozialarbeiter und fast alle der an Auslandsadoption Beteiligten kaum eine Vorstellung von den Problemen in Adoptivfamilien. Gibt es einen Grund für diese mangelnden Kenntnisse? Und ist es auch wirklich wahr, dass die Sozialarbeiter, die Adoptionsvermittler und vor allem die Adoptiveltern keinen Blick für die spezifischen Bedürfnisse ausländischer Adoptivkinder hatten?
An für sich gibt es Adoptionen schon lange. Dabei handelte es sich allerdings hauptsächlich um Inlandsadoptionen. Es ist natürlich die Frage, ob sich die psychosoziale Situation von Inlandsadoptierten wesentlich von derjenigen fremdländischer Adoptivkinder unterscheidet. In beiden Gruppen wurde das Kind nach kürzerer oder längerer Zeit von seiner Mutter und weiteren leiblichen Verwandten endgültig getrennt. So können wir annehmen, dass die Folgen der Trennung und der eventuell negativen Umweltbedingungen während der ersten Lebensmonate/-jahre vor der Freigabe zur Adoption sehr ähnlich sind. Anhand einiger Beispiele möchte ich im Folgenden verdeutlichen, dass sich die Situation der Inlands- und Auslandsadoptierten meines Erachtens in den wichtigsten Punkten wenig unterscheidet.
Allgemeine und besondere Probleme bei Auslandsadoptionen
Schon im Jahre 1936 hat Albrecht die erste Untersuchung über Adoptionen mit dem Titel "Anlage und Umwelt bei fehlgelaufenen Adoptionen" veröffentlicht. Sehr bekannt sind die Studien von Spitz (1946). Er führte das heute viel benutzte Konzept "Hospitalismus" ein. Mit diesem Begriff werden "die ernsthaften schädlichen Folgen emotioneller Art der mangelnden Versorgung der Mutter für das in einem Kinderheim aufgenommene junge Kind" bezeichnet. Da so viele Adoptivkinder, insbesondere wenn es sich um fremdländische Kinder handelt, einige Zeit in einem Kinderheim verbleiben, ist der Begriff "Hospitalismus" für uns sehr relevant. Außerdem wissen wir heute aus Untersuchungen, besonders auch aus der medizinischen und psychotherapeutischen Praxis, wie die erste Zeit im Leben dieser Kinder in emotioneller Hinsicht belastend und sogar schädigend sein kann.
Die besonders im Bereich der Adoption bekannte deutsche Forscherin Napp-Peters (1978: 266) weißt darauf hin, dass sich ein wesentlicher Teil der Jugendhilfeliteratur mit der frühzeitigen Trennung von Mutter und Kind sowie den Folgen der Ersatzerziehung verwahrloster Kinder beschäftigt. Insbesondere wenn sich die Kinder in der Phase vom 6. bis 18. Lebensmonat befinden, kann die Mutterentbehrung zu einer schweren geistig-seelischen Mangelkrankheit führen. Auch ist aus der Entwicklungspsychologie bekannt, dass sich gerade in diesem Alter die ersten schwerwiegenden Folgen der Unterstimulierung und Vernachlässigung zeigen (White 1985: 6). Dies ist in Hinblick auf das Thema dieses Kapitels von besonderer Bedeutung: Die meisten fremdländischen Kinder werden nämlich gerade in diesem Alter bei der Adoptivfamilie untergebracht.
Dass die Auslandsadoptionen aus mehreren Gründen - die psychologische und medizinische Situation der Kinder, die politischen Empfindlichkeiten der entsendenden Länder, die Gefahren des Kinderhandels - vielleicht mit noch mehr Vorsicht betrachtet werden müssen als die Inlandsadoptionen, ist erst später richtig deutlich geworden. Die Vermittlungsorganisationen haben in dieser Hinsicht nur wenig Hilfe geleistet, wahrscheinlich weil die Vorstandsmitglieder viel zu beschäftigt waren mit den komplizierten Kontakten zu den Herkunftsländern. Darüber hinaus waren diese Personen sehr idealistisch und kümmerten sich viel um die allgemeine Not der Kinder in der Dritten Welt.
Selbstverständlich wusste man, dass manche Kinder Anpassungsschwierigkeiten hatten. Aber in den siebziger Jahren herrschte die Meinung vor, dass diese Probleme bald vorbei sein würden. Zudem würden die Kinder einige Jahre lang in positiven Familienverhältnissen leben, bevor sie die Pubertät erreichen.
Die obersten Landesjugendbehörden und die Landesjugendämter, verantwortlich für die Regelung der Adoptionsvermittlung, hatten aber schon 1962 "Richtlinien für die Adoptionsvermittlung" vorgelegt (Napp-Peters 1978: 54). Einige Abschnitte dieser Richtlinien behandeln die Besonderheiten, die bei Auslandsadoptionen zu beachten sind. Besonders wichtig ist die Empfehlung, dass "die Vermittlung bei allen Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Jugendhilfe durch fürsorgerische Fachkräfte erfolgen solle". Damit wird bereits darauf verwiesen, dass bei der Adoption von Kindern besondere Probleme psychologischer und rechtlicher Art auftreten können.
Vor 1970 lag der Schwerpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen über Adoption auf der relativen Bedeutung von Erbanlage und Umwelt. Die Fragen nach dem Zusammenhang von Platzierungsalter, Vorplatzierungsschäden, Geschlecht und dem langfristigen Ergebnis von Adoptionen bestimmten erst später das Forschungsinteresse. Weil Auslandsadoptionen erst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten stattfanden, ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Untersuchungen und die Möglichkeiten für eine valide und zuverlässige Evaluation des Adoptionserfolgs beschränkt sind. Jedoch ist inzwischen deutlich geworden, wie wichtig derartige Untersuchungen sind. Lassen Sie mich ein wichtiges Beispiel aus der Geschichte der Auslandsadoption in den Niederlanden und Belgien geben:
In den Niederlanden hat zwischen 1981 und 1985 - in Belgien einige Jahre später - eine wichtige Änderung im Denken über Auslandsadoptionen stattgefunden. Mehr oder weniger plötzlich hatten Adoptiveltern, die mit ihrem aus Asien oder Südamerika kommenden Adoptivkind große Schwierigkeiten hatten, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. In Zeitungen (Storm 1985), Fachzeitschriften (Walenkamp 1984), Büchern (Hoksbergen 1983) und Diplomarbeiten (Vlierd/Waardenburg 1983) sowie insbesondere vor dem Fernsehen machten Adoptiveltern deutlich, dass die Auslandsadoption in ihren Familien fast immer mit großen pädagogischen und psychologischen Problemen verbunden war. Sie zeigten sich im Allgemeinen auch sehr enttäuscht über das Phänomen der Auslandsadoption.
Meistens hatten die Eltern aus idealistischen Gründen ein fremdländisches Kind adoptiert. Sie hatten oft selbst ein oder mehrere leibliche Kinder und wollten nun einem Waisenkind, also einem Kind in Not, aus der Dritten Welt helfen. Bald brauchten sie aber intensive und längere Hilfe bei der Erziehung dieses Kindes. Dann erlebten sie ihre zweite große Enttäuschung: Die Fachkräfte waren nur selten imstande, die Probleme in den Adoptivfamilien zu verringern oder gar völlig zu beseitigen.
So wurde in diesen Jahren deutlich, dass viel mehr Adoptiveltern als erwartet mit großen psychologischen Schwierigkeiten zu tun hatten und dass diese Familien
(1) zu lange gezögert hatten, professionelle Hilfe anzufordern. Da viele Adoptiveltern Angst haben, an der Adoption zu scheitern, versuchen sie zu spät (oft erst, wenn es eine Krise in der Familie gibt), Hilfe zu bekommen.
(2) häufig keine sinnvolle oder zweckmäßige Unterstützung erfuhren und sich deshalb an mehreren Hilfsorganisationen wenden mussten.
(3) oft genau so behandelt wurden wie andere Hilfesuchende, deren Probleme aber meistens einen völlig anderen Hintergrund und ganz andere Ursachen hatten.
Wie dies öfters in Holland der Fall ist, organisierten sich diese Adoptiveltern 1985 zuerst in einer kleinen Organisation und 1987 in einem Verband mit dem Namen "LOGA: Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie" (Landesweiter Elternverein zur Familienproblematik Adoption). Auch in Belgien wurde 1989 ein solcher Verein gegründet. Diese Organisationen betonen, dass die normalen Hilfeleistungen nicht zweckmäßig seien, wenn es sich um Auslandsadoptionen handelt. So sei die psychische Situation der fremdländischen Kinder viel zu kompliziert. Oft kämen einerseits Eltern mit hohen Erwartungen, Idealen und starker Motivation hinsichtlich der Erziehung ihres Adoptivkindes und andererseits ein Kind mit schweren Vorplatzierungsschäden und dadurch bedingten intensiven Verhaltungsstörungen zusammen. Ferner fordert LOGA psychiatrisch orientierte Untersuchungen benötigen. So möchte man beispielsweise wissen, in wie vielen Adoptivfamilien und aus welchen Gründen die Probleme so groß sind, dass das Kind einige Zeit nicht in der Familie bleiben kann und institutionalisiert werden muss (Kinderheim, Psychiatrische Klinik usw.). Schließlich werden eine intensive Analyse der auftretenden psychischen Probleme und die Entwicklung Erfolg versprechender Interventionsformen gefordert.
In den nächsten Absätzen werde ich die wichtigsten Merkmale der Auslandsadoption beschreiben. Anschließend werde ich eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten Untersuchungen über Auslandsadoptionen geben.
Entwicklungen bei Auslandsadoptionen in europäischen Ländern
Erst im Jahre 1956 wurde das erste Adoptionsgesetz in den Niederlanden verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt dachte niemand daran, dass das Gesetz nach zwei Jahrzehnten fast nur für fremdländische Kinder von Bedeutung sein würde. Bei der Einführung dieses Gesetzes wurde vor allem das Ziel verfolgt, den damaligen Pflegeeltern durch die Adoptionsmöglichkeit mehr Sicherheit hinsichtlich der Dauerhaftigkeit ihrer Beziehung zum Kind zu geben. Bald wurde aber klar, dass auch eine Auslandsadoption Adoptiveltern viel Sicherheit geben kann. So ist die Auslandsadoption seit etwa 1974 in Holland, Norwegen und Dänemark, etwas früher in Schweden und etwas später in Deutschland, Belgien, Frankreich und der Schweiz immer wichtiger geworden. In Großbritannien gibt es hingegen kaum Auslandsadoptionen, in Italien fast nur in der Form von Privatadoptionen.
Inlandsadoptionen finden kaum noch statt. Seit 1982 gibt es in den Niederlanden nur zwei bis vier Inlandsadoptionen auf eine Million Einwohner pro Jahr. In Norwegen hat sich diese Zahl seit 1970 auch sehr verringert, beträgt aber noch ungefähr 25 Adoptionen auf eine Million Einwohner, während es in Schweden nach Angaben des Adoptionszentrums etwa 30 Adoptionen pro Jahr sind. Die Situation in Deutschland ist weniger deutlich. Büch (1991) nennt für 1988 eine Zahl von 7.500 abgeschlossenen Adoptionen (einschließlich Stiefkindadoptionen). Textor (1991) gibt eine Übersicht über Adoptionen in Deutschland, aus der sich ergibt, dass 1984 4.500, 1986 4.000 und 1990 3.000; Volladoptionen stattfanden. Jährlich werden in Deutschland etwa 800 Kinder aus der Dritten Welt adoptiert (Bach 1991). So viel ist sicher: Die Zahl der Inlandsadoptionen liegt in Deutschland (Einwohnerzahl der alten Bundesländer: 61 Millionen) sehr viel höher (pro Million Einwohner im Jahr 1987: 50) als in den Skandinavischen Ländern und den Niederlanden. Trotzdem sagt Büch (1991) in seinem Artikel "Warum so wenige deutsche Säuglinge zur Adoption freigegeben werden", dass die Zahl der gesunden deutschen Säuglinge, die für eine Adoption in Frage kommen, sehr klein sei. Es wäre richtiger gewesen, wenn Büch gefolgert hätte, dass diese Zahl seit 1981 zurückgeht, aber noch immer viel größer ist als in einigen anderen europäischen Ländern (wie Holland und Schweden).
Ehemals für die Auslandsadoption wichtige Länder wie Indonesien oder Bangladesh geben keine Kinder mehr zur Auslandsadoption frei. Auch aus Korea kommen heute viel weniger Kinder nach Europa als früher. Dies hat mehrere Gründe. So spielen die Haltung einiger Politiker, die Aussagen kirchlicher Würdenträger und auch einige negative Vorfälle eine Rolle, die in der Presse (übereilt) mit Kinderhandel und Missbrauch der Adoption beschrieben wurden. Beispielsweise war Korea jahrelang das wichtigste Land für Auslandsadoptionen, besonders für die USA. Jetzt versucht dieser Staat hingegen, Auslandsadoptionen einzustellen. Dazu sind aber noch große Veränderungen in Politik und Kultur notwendig, beispielsweise hinsichtlich der Haltung gegenüber unverheirateten Müttern und der Sicherung ihrer Existenz. Sonst ist zu erwarten, dass dieselben Kinder, die früher in das Ausland vermittelt worden wären, jetzt in ein Kinderheim platziert würden.
Ähnliche Entwicklungen haben schon früher in europäischen Ländern wie Griechenland stattgefunden, aus denen keine Kinder mehr an Ausländer vermittelt werden. Ein Land wie Rumänien ist jedoch, wie wir jetzt alle wissen, weit zurückgeblieben. In den Jahren 1990 und 1991 wurden Tausende von rumänischen Kindern vor allem von amerikanischen, italienischen, deutschen, französischen und kanadischen Eltern adoptiert. Ehepaare aus Ländern wie Schweden und Holland, in denen Privatadoptionen von viel geringerer Bedeutung sind, zögerten hingegen. Dort hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass die rumänischen Behörden zuerst Auslandsadoptionen besser organisieren sollten, auch durch neue Gesetze. In diesen Ländern will man nicht die Gefahr laufen, Kinder zu adoptieren, die recht gut in Rumänien hätten bleiben können, weil sie dort noch Eltern oder andere Verwandten haben. Seit 1992 sind nun auch in Rumänien Privatadoptionen verboten. Deutsche Ehepaare können nur noch über den Internationalen Sozialdienst (ISD) in Frankfurt rumänische Kinder adoptieren.
Drei Generationen von Adoptiveltern
Wenn ich jetzt versuche, einige wichtige Veränderungen in der europäischen Adoptionspraxis anzudeuten, dann kann ich dies meines Erachtens am besten tun, wenn ich einen Unterschied zwischen drei Generationen von Adoptiveltern mache: die traditionell-geschlossene, die idealistisch-offene und die ökonomisch-realistische Generation. Der Gedanke, dass es im Laufe der Zeit Generationen mit verschiedenen Grundhaltungen gibt, ist nicht neu. Karl Mannheim kann mit seinem Essay von 1928, "Das Problem der Generationen", als der Begründer dieser Sichtweise gesehen werden. Sehr bekannt ist auch Schelskys (1957) Buch "Die skeptische Generation". Mit dem Begriff der Generation bezeichne ich hier Gruppen von Menschen, die sich gewissermaßen nebeneinander entwickeln, also ein gemeinsames Kinder- und Jugendalter haben, und in den Jahren der größten Empfänglichkeit (vom 10. bis 25. Lebensjahr) dieselben prägenden Einwirkungen erfahren. Mit diesen Einwirkungen sind beispielsweise Kriege, große Naturkatastrophen, politische Revolutionen sowie wichtige Änderungen in der Sozialstruktur und Kultur gemeint. Mein Kollege Becker hat das Konzept von den verschiedenen Generationen für die Periode 1910 bis 1990 weiter ausgearbeitet (Becker/Hermkens 1989). Er differenziert zwischen vier Generationen: die Vorkriegsgeneration (geboren 1910-1930), die Stille Generation (geboren 1930-1940), die Protestgeneration (geboren 1940-1955) und die Verlorene Generation (geboren nach 1955). Wahrscheinlich können wir Beckers Stille Generation mit Schelskys Skeptischer Generation vergleichen. Nach dem Vorbild von Becker habe ich die Hypothese formuliert, dass zwischen mehreren Generationen von Adoptiveltern differenziert werden kann.
Die traditionell-verschlossene Generation: Die Adoptiveltern, die ungefähr zwischen 1920 und 1935 geboren wurden und somit ihre formative Periode während der ökonomischen Krise und der Kriegszeit hatten, bilden eine Generation. Es ist die Generation, die Becker in zwei Generationen unterschieden hat: die Vorkriegs- und die Stille Generation. In ihren Auffassungen, Werten und Normen sind diese beiden Generationen jedoch vergleichbar, nur nicht in ihren materiellen Umständen. Adoptiveltern dieser Generation haben ihr erstes Kind ungefähr zwischen 1950 und 1970 adoptiert. Es handelte sich meistens um ein Kind, das in Europa geboren wurde. Diese Ehegatten hatten oft jahrelang vergeblich versucht, selbst ein Kind zu bekommen. Die Adoption war somit an erster Stelle eine Hilfeleistung für kinderlose Ehepaare. Rund 90% dieser Ehepaare hatten gar keine Kinder - ein Prozentsatz, der auch in der Untersuchung von Napp-Peters (1978: 286) für deutsche Adoptivelternpaare genannt wird.
Diese Generation war konventionell in ihren Auffassungen hinsichtlich des Ehebundes, des Familienlebens, der Macht der Behörden, der Sexualität und der Art und Weise, wie mit dem Kind über die Adoption gesprochen werden muss (das Problem des "telling"). Manche Eltern hatten überhaupt Angst, den Adoptivstatus des Kindes zur Sprache zu bringen oder etwas über die biologischen Eltern zu erzählen - sie befürchteten, ihr Kind später zu verlieren. Diese Eltern vertraten oft die Einstellung, die Kirk (1981) "Rejection-of-Difference" genannt hat. Sie wollten nicht akzeptieren, dass die Adoptivelternschaft einige besondere Merkmale hat und sich von der biologischen Elternschaft unterscheidet. Auch förderten Sozialarbeiter nicht den Kontakt zu anderen Adoptiveltern. Wir wissen erst jetzt, wie hilfreich diese Kontakte für Adoptivfamilien sind. Das Familiensystem hatte noch einen stark intern-orientierten Charakter und die Adoption hatte viele Kennzeichen eines Tabu-Phänomens. Die adoptierten Kinder waren zum Zeitpunkt der Vermittlung sehr jung und sahen oft den Adoptiveltern ähnlich ("matching"). Letztere erfuhren zumeist nur wenig über die Herkunft des Kindes.
Die idealistisch-offene Generation: Als Ende der sechziger Jahre die Kulturelle Revolution stattfand, wandelten sich viele Auffassungen, Werte und Normen. Ideen über Sexualität, Schwangerschaftsabbruch, die Stellung von Frauen in der Gesellschaft, die Einelterfamilie oder die Macht und Weisheit der Behörden wurden infragegestellt und durch neue Vorstellungen ersetzt. Diese Revolution hat in der Adoptionspraxis viel geändert. Die wichtigste dieser Änderungen ist die Entwicklung einer viel größeren Offenheit gegenüber Aspekten intimer Art. Themen wie Sexualität, Homosexualität, Probleme mit der Fruchtbarkeit, Eheprobleme, die Folgen der Adoptionsfreigabe für die leiblichen Mütter oder die besonderen Merkmale des Adoptivstatus werden viel offener besprochen. Der Einfluss des Fernsehens muss hier natürlich auch genannt werden.
Eine der wichtigen Folgen für die Adoptionspraxis war, dass das Phänomen der Adoption seinen Tabu-Charakter verlor. Die Einstellung "Acknowledgment-of-difference", wie Kirk (1981) sie bezeichnet hat, wurde viel mehr akzeptiert. Die Adoptiveltern erkannten häufiger an, dass sich ihre Adoptivelternschaft in mehreren Punkten von der biologischen Elternschaft unterscheidet. Viel mehr Menschen betrachteten jetzt die Adoption auch als eine positive Lösung bei unfreiwilliger Kinderlosigkeit. Neu war, dass die Adoption eines Kindes mehr und mehr als eine moderne Form der Familiengründung gesehen wurde. Aus diesem Grund ist es verständlich, warum ab 1972 immer mehr Ehepaare, die schon ein oder mehrere leibliche Kinder hatten, dennoch ein Kind adoptieren wollten. Verständlich ist auch, dass viel mehr Ehepaare adoptieren wollten.
Weil Inlandsadoptionen immer seltener möglich waren, wurde der Blick zunehmend auf das Ausland gerichtet. Es war bekannt, dass in der Dritten Welt Millionen von Kindern in Kinderheimen aufwuchsen. In diesen Ländern gab es nur selten die Möglichkeit der Adoption. Die Kinder unverheirateter Mütter wurden immer noch in ein Heim platziert. Die idealistisch-offenene Generation - vergleichbar mit Beckers "Protestgeneration" - betrachtete es als eine Pflicht, etwas für diese Kinder zu tun und, wenn es nicht anders möglich war, sie finanziell zu unterstützen oder sogar zu adoptieren. Diese Adoptivelterngeneration zeigte damit auch ihre Protesthaltung. Sie wollte so gerne einem Kind in Not helfen und protestierte heftig, wenn die gesetzlichen Bedingungen dies nicht zuließen. Daher bezeichneten sich die ersten Mitglieder der zurzeit größten Adoptivelternorganisation "Wereldkinderen" (Kinder der Welt) sich als eine Lobbyistengruppe.
Die Auslandsadoption könnte vielleicht sogar als ein modischer Trend gesehen werden. Dies bedeutet, dass Ehepaare aus der (oberen) Mittelschicht, oft schon mit eigenen Kindern, relativ unüberlegt adoptierten. Verhältnismäßig oberflächlich begannen sie etwas, was sich später oft zu einem "Adoptionsabenteuer" entwickelte - ein Abenteuer mit vielen unerwarteten negativen Seiten, wie ich nachher zeigen werde.
Die ökonomisch-realistische Generation: Seit 1985 hat das Interesse zu adoptieren in Holland und vielleicht auch in Schweden und anderen Ländern abgenommen. Mit dieser Bemerkung kommen wir zur dritten Generation, die ich die ökonomisch-realistische Generation genannt habe. Die Wirtschaftslage hat sich in Europa negativ entwickelt. Für junge Menschen ist es viel schwieriger geworden, einen festen Arbeitsplatz zu bekommen. Zudem sind die Kosten einer Auslandsadoption sehr viel höher geworden. Dies wird teilweise dadurch verursacht, dass die meisten Länder jetzt verlangen, dass die Adoptiveltern beim Vollzug der gesetzlichen Regelungen anwesend sind und dann das Kind selbst in seine neue Heimat bringen. Das heißt, dass die Kosten der Eltern auf DM 20.000 und mehr ansteigen können. Für ein Ehepaar mit einem unsicheren Arbeitsplatz ist dieser Betrag wahrscheinlich oft ein unüberwindbares Hindernis.
Die Bewerber wissen heute auch viel besser Bescheid über die komplizierten Probleme, die fremdländische Kinder vor der Adoption, nach der Platzierung oder später in der Adoleszenz entwickeln können - Probleme, die so groß sein können, dass viele Eltern nicht imstande sind, sie zu bewältigen. Mehrere autobiographische Bücher von Adoptiveltern (Egmond 1987; Grasvelt 1989), die große emotionale Probleme mit ihrem Adoptivkind hatten, sind publiziert worden. Oft wurde auch von ihren Erfahrungen im Fernsehen berichtet. Hinzu kommt noch, dass kinderlose Ehepaare durch die moderne Reproduktionstechnologie jetzt mehr Alternativen haben. Die In-Vitro-Fertilisation (Retortenbaby) ist entwickelt worden und in vielen Ländern ist das Spenden von Samen und/oder Eizellen gestattet. Daher beobachten wir ungefähr seit 1985 folgende wichtige Veränderungen:
- Die Anzahl der Ehepaare mit einem oder mehreren leiblichen Kindern nimmt ab.
- Das Interesse, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren, nimmt stark ab (siehe Tabelle 1).
- Wenn man adoptieren will, dann möchte man am liebsten ein möglichst junges Kind. Für Kinder, die älter als zwei Jahre sind, können oft keine Adoptiveltern mehr gefunden werden. In den Jahren zuvor kam es hingegen überhaupt nicht vor, dass manche Kinder nicht untergebracht werden konnten.
Wahrscheinlich sind auch die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen über Auslandsadoptionen für diese Entwicklung wichtig gewesen.
Forschungsstand
In mehreren Ländern wurden in den letzten Jahren Untersuchungen über die Merkmale der Adoptiveltern, die medizinische Situation der fremdländischen Adoptivkinder, die Anpassungsschwierigkeiten, die psychosoziale Integration im Jugendalter und den Adoptionserfolg durchgeführt. Ich möchte nun die Ergebnisse der wichtigsten Untersuchungen vorstellen und dabei gleichzeitig versuchen, anhand der Resultate einige Ratschläge für die Adoptionspraxis zu formulieren.
Adoptiveltern fremdländischer Kinder
Eltern fremdländischer Adoptivkinder unterscheiden sich von anderen Elterngruppen in mehrerer Hinsicht (Grow/Shapiro 1975; Hoksbergen 1979; Schreiner 1984; Kühl 1985; Altstein/Simon 1991). Das Alter der Adoptiveltern bei Ankunft des ersten ausländischen Adoptivkindes beträgt durchschnittlich 30 bis 35 Jahre. Die Ehepartner sind verhältnismäßig lange, für etwa sechs bis neun Jahre, verheiratet. Viele Ehepaare haben zuerst andere Wege versucht, um (leibliche) Kinder zu bekommen. Daher gibt es auch oft Ehepartner, die sich erst im Alter von ungefähr 40 Jahren für eine Auslandsadoption bewerben.
Schulz-Mühlensiefen (1979) hält Männer über 45 und Frauen über 40 Jahre als zu alt für eine Adoption. Die Eltern, so meint sie, sind mit 55 bis 60 Jahren nicht mehr in der Lage, auftretende Pubertätsprobleme der Kinder zu bewältigen. Aus Untersuchungen über den Zusammenhang zwischem dem Alter der Eltern und der Integration der Kinder (Kühl 1985; Geerars et al. 1991) lässt sich folgern, dass es möglicherweise ein optimales Alter der Eltern für Adoptivkinder gibt, die bereits etwas älter bei der Ankunft in ihrem neuen Heimatland sind. Dieses ist für beide Eltern etwa 35 Jahre. So sind Ehepaare in diesem Alter noch jung genug, sich den geänderten Umständen anzupassen. Sie haben auch meistens viel mehr Lebenserfahrung als zehn Jahre jüngere Ehepaare, die normalerweise in diesem Alter ihr erstes Kind bekommen. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Wenn die Adoptivkinder in die Adoleszenzperiode eintreten, sind die Eltern noch unter ihrem 50. Lebensjahr und damit meistens noch vital genug, ihren Kindern in dieser oft problematischen Periode zu helfen.
Aus allen Untersuchungen geht hervor, dass der sozioökonomische Status der Eltern hoch bis sehr hoch ist (Weinwurm 1976; Hoksbergen 1979; Gill/Jackson 1983; Kühl 1985). Diese Situation hat Vor- und Nachteile. Einerseits kann man sagen, dass die Sozialisationsbedingungen der (oberen) Mittelschicht dem Adoptivkind besonders günstige Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die sozialen und materiellen Bedingungen (Wohnung und Wohnumgebung, Ausbildungsmöglichkeiten usw.) sind sehr positiv. Andererseits muss befürchtet werden, dass die Adoptiveltern häufig eine erhöhte Anspruchshaltung gegenüber der sozialen, intellektuellen, und emotionalen Entwicklung ihrer Kinder zeigen (Schreiner 1984: 121). Besonders wenn die Eltern leibliche Kinder haben, ist diese Gefahr groß - vor allem wenn die Erfahrungen mit ihren eigenen Kindern in intellektueller und emotionaler Hinsicht positiv gewesen und nun vom Adoptivkind dasselbe erwartet und unbewusst gefordert wird. So geht aus niederländischen Untersuchungen (Hoksbergen et al. 1988; Geerars et al. 1991) hervor, dass es in Adoptivfamilien mit leiblichen Kindern mehr ernsthafte emotionale Probleme gibt. Anhand dieser Ergebnisse könnte man folgern, dass bei der Vorbereitung einer Adoption die Konsequenzen der Familienstruktur berücksichtigt werden müssen. Ehepaare mit leiblichen Kindern haben oft eine "stabilisierte Erziehungsstruktur" entwickelt. Diese hat sich bei den eigenen Kindern als zweckmäßig erwiesen und wird daher nach der Aufnahme eines Adoptivkindes zu wenig in Frage gestellt. Besonders wenn dieses schon älter als sechs Monate ist und vernachlässigt worden war, müssen die Eltern sich ihm anpassen, flexibel sein und eventuelle Enttäuschungen durch das Verhalten des Kindes ertragen können. Besonders wichtig ist, dass die Eltern bei großen Problemen mit ihrem Kind nicht zögern, Hilfe zu suchen.
Über die Adoptionsmotive muss ich nur noch wenig sagen, da ich schon bei der Darstellung der drei Generationen von Adoptiveltern die Hauptmotive erwähnt habe. Interessant ist, das Kühl (1985: 48) drei Kategorien von Adoptionsmotiven unterscheidet, die meiner Differenzierung sehr ähnlich sind:
(1) Innerfamiliär orientierte Motive mit egoistischem Kinderwunsch: "Wir wollten ein weiteres Kind, ein Geschwister für unser Kind" (40% der befragten Eltern).
(2) Inner- und außerfamiliäre Orientierung des Kinderwunsches nach einer Situationsanalyse: "Wir möchten gern ein Kind und wollen dabei einem elternlosen Kind aus der Dritten Welt helfen" (5%).
(3) Außerfamiliäre Orientierung mit altruistischem Kinderwunsch: "Wir wollen einem von Krieg und Elend bedrohten Kind zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen" (54%).
An und für sich sollte man vorsichtig sein bei der Interpretation dieser Motive, weil es sich hier um ein kompliziertes menschliches Phänomen handelt. Meistens sind mehrere Motive beteiligt, die im Verlauf der Zeit oft noch wechseln oder in ihrer Bedeutung variieren.
Die medizinische Situation der Kinder bei ihrer Ankunft ist oft Besorgnis erregend. In der Studie von Weinwurm (1976: 24-28) stellte sich heraus, dass die untersuchten 71 Kinder aus Korea und Vietnam, die alle via Terre des Hommes platziert worden waren, eine große Bandbreite an Krankheiten aufwiesen. Als gesund wurden von ihr nur 10% der vietnamesischen Kinder und 6% der koreanischen Kinder bezeichnet. Bei unserer Untersuchung über 350 Ehepaare (Hoksbergen 1979) hat sich herausgestellt, dass etwa die Hälfte der Eltern die Gesundheit ihres Kindes als mittelmäßig oder schlecht beurteilte. Bei einer belgischen Studie über 456 fremdländische Adoptivkinder stellte sich heraus, dass bei der Ankunft fast ein Drittel Gesundheitsprobleme hatte (Moens 1988). Auch aus der Untersuchung von Kühl (1985: 45) über 145 Jugendliche geht hervor, dass ein knappes Drittel bei der Ankunft ernsthaft erkrankt war.
Im Allgemeinen muss man sagen, dass es für alle Eltern eines fremdländischen Adoptivkindes notwendig ist, sofort bei Ankunft ihres Kindes einen Kinderarzt aufzusuchen. Auch sollten alle sinnvollen Laboruntersuchungen durchgeführt werden.
Aus allen Untersuchungen kann aber gefolgert werden, dass die ermittelten und oft auch ernsthaften Gesundheitsprobleme bei den meisten Kindern erfolgreich behandelt werden können und keine weiteren Folgen haben. Kühl (1985: 45) folgert: "Ein ungünstiger Gesundheits- und Ernährungsstatus sowie körperliche Entwicklungsverzögerungen des Kindes bei seiner Aufnahme in die Adoptivfamilie haben die psychische Gesundheit der befragten Jugendlichen langfristig nicht beeinträchtigt". Allerdings ergänzt Kühl, dass diese Befunde "wegen der Subjektivität der retrospektiven Elterneinschätzungen mit Zurückhaltung zu interpretieren" sind. Dies hat sich bei anderen Untersuchungen, wie wir bald sehen werden, als vernünftig erwiesen.
Anpassungsprobleme
Bevor wir Häufigkeit und Ursachen von Anpassungsproblemen fremdländischer Adoptivkinder besprechen, soll noch auf unsere Untersuchung von 116 Kindern aus Thailand verwiesen werden. Sie zeigt einen Zusammenhang zwischen Gesundheitsproblemen und Anpassungsschwierigkeiten. Deutlich wird, dass je schlechter der Gesundheitszustand der Kinder bei ihrer Ankunft ist, umso mehr Erziehungsprobleme zu erwarten sind (Hoksbergen et al. 1987: 68). Ein schlechter Gesundheitszustand bedeutet oft, dass das Kind vernachlässigt wurde und noch nie Liebe erfahren hat.
Welche Anpassungsprobleme treten nun auf? Zuerst sind es natürlich die ganz normalen Probleme von Kindern, die mit ganz neuen Lebensumständen konfrontiert werden - wie Schlafstörungen (Weinwurm 1976). Allein zu schlafen ist in den ersten Monaten oft unmöglich, und die Kinder wehren sich oft gegen den Schlaf (Schreiner 1984). Dies ist verständlich, denn alles Neue und die unsichere Situation des Kleinkindes produzieren Angst. Oft haben die Adoptivkinder auch Probleme mit dem Essen - viele der für uns normalen Nahrungsmittel sind für sie völlig neu (Äpfel, Kartoffeln usw.). Auch muss sich das Kind erst daran gewöhnen, dass es so unwahrscheinlich viel zu essen gibt. Es möchte immer alles aufessen, weil es morgen vielleicht nichts mehr gibt. Die meisten dieser Probleme sind aber nach einigen Jahren gelöst.
Die wichtigsten Anpassungsprobleme aber haben mit den menschlichen Beziehungen zu tun. Die meisten älteren Adoptivkinder (ungefähr ab dem siebten Lebensmonat) verhalten sich zunächst auffällig. Typische Reaktionen sind anklammerndes oder sehr schüchternes Verhalten, Angst vor Körperkontakt, Zurückweisung von einem oder beiden Elternteilen, Zerstörungswut, unverständliche Aggressivität und Rückfall in eine frühere Lebensphase (Regression) (Weinwurm 1976; Hoksbergen 1979; Cederblad 1982; Weyer 1985). Besonders wenn das Kind schon bei Ankunft in der Attachment-Phase ist, also im Alter von sechs bis acht Monaten, kann es unerwartet lange dauern, ehe es sich den neuen Eltern anpaßt.
Es zeigte sich, wie wichtig das Ankunftsalter ist. So entwickelten Adoptivkinder umso häufiger Anpassungsprobleme, je älter sie zum Zeitpunkt ihrer Platzierung waren. Selbstverständlich gibt es auch einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Ankunftsalter und den kognitiven Leistungen des Adoptivkindes. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Ankunftsalter negativ mit den kognitiven Leistungen (unter anderem größere Wahrscheinlichkeit des Sitzenbleibens), aber positiv mit der Arbeitseinstellung korreliert. Dieses letztgenannte Ergebnis wird normalerweise nicht bei einheimischen Kindern gefunden: Wenn die Leistungen in der Schule zurückbleiben, wird meistens auch die Arbeitseinstellung schlechter. Die Kinder sind dann immer weniger motiviert, sich noch in der Schule anzustrengen, da sie der Meinung sind, dass sie sowieso keinen Erfolg haben werden. Das trifft jedoch nicht auf die untersuchten Adoptivkinder zu. Vielleicht ist das andere Ergebnis bei unserer Studie dadurch zu erklären, dass es sich um Adoptivkinder handelte: Diese haben vielleicht eher das Gefühl, dass sie sich in ihrem neuen Lebenskontext beweisen müssen.
Weil bei der Untersuchung von Adoptivkindern aus Thailand auch der Adoptionserfolg erfasst werden sollte, haben wir mit Hilfe von mehreren Variablen und von vier unabhängigen Beurteilern die Qualität der Adoptionen bewertet. Bei 19 von 116 Adoptionen (14 Jungen und 5 Mädchen; die Mädchen waren bei der Ankunft im Durchschnitt etwas jünger) musste den Kindern besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge gewidmet werden. Hier zeigt sich ganz deutlich, wie wichtig wieder das Ankunftsalter war.
Die psychische Integration
Wie wir bereits gesehen haben, ist das Ankunftsalter sehr wichtig für die psychische Integration des fremdländischen Adoptivkindes. Hier muss ich aber sofort hinzufügen, dass die Lebensumstände im Herkunftsland noch viel wichtiger sind (Kühl 1985; Hoksbergen et al. 1987; Verhulst 1990). Besonders entscheidend für die psychische Entwicklung ist offenbar die Dauer von Heim- und Krankenhausaufenthalten. Je länger und diskontinuierlicher (mehrere Heimaufenthalte, häufiger Wechsel der Betreuer) diese Zeit im Herkunftsland war, desto ungünstiger verläuft die Entwicklung ihres Selbstverständnisses und ihres Selbstwertempfindens (Kühl 1985; Verhulst 1990, 1992).
Besonders wenn das Kind in die Adoleszenz kommt, haben viele Eltern mit großen Erziehungsproblemen zu kämpfen. Aus der Untersuchung von Verhulst (1990) über mehr als 2.000 fremdländischen Adoptivkindern im Alter von 10 bis 15 Jahren wissen wir, dass diese Kinder im Durchschnitt mehr Verhaltensstörungen (gemessen mit der "Child Behaviour Checklist", CBCL), antisoziales Verhalten (Aggressivität, Stehlen, Lügen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Brandstiftung), schlechte Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern (kaum gefühlsmäßige Bindungen, kein soziales Interesse, Abkapselung) und emotionale Probleme (Depressivität, Gefühlsschwankungen) aufweisen. Die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen waren nicht groß, obwohl die Jungen etwas häufiger antisoziale Verhaltensweisen zeigten und die Mädchen mehr Probleme mit Gleichaltrigen hatten.
Dennoch ergab die Untersuchung von Verhulst (1992: 931), dass die Mehrheit der Adoptivkinder, "even those with backgrounds known to be managing, seemed to function quite well according to their parents reports". Diese Folgerung entspricht dem Ergebnis von Weinwurm (1976: 338), die bei ihrer Untersuchung zu dem Schluss kommt: "Hinsichtlich der Aufarbeitung der Irreversibilitätsproblematik konnte nachgewiesen werden, dass keine Hinweise dafür aufgezeigt werden konnten, dass Deprivationsschäden irreversibel sind. Auf dem theoretischen Hintergrund des Modells der individuellen Aneignung konnte vielmehr nachgewiesen werden, dass durch adäquate Verhaltensweisen die problematischen Verhaltensweisen aufgehoben werden". Hier muss ich aber anmerken, dass die Praxis uns gelehrt hat, dass es für die durchschnittlichen Adoptiveltern gar nicht leicht ist, diese "adäquaten Verhaltensweisen" zu entwickeln.
Adoptionserfolg
Für die Mehrzahl der Adoptierten sind die andersartige ethnische und biologische Herkunft wichtige Merkmale. Wenn die Adoptiveltern dazu eine offene Einstellung haben, sind diese Charakteristika für die Adoptierten leichter zu ertragen (Kirk 1981; Kühl 1985; Hoksbergen et al. 1987; Textor 1988). Offenheit bedeutet auch, dass Eltern ihren fremdländischen Adoptivkindern helfen, wenn diese Fragen hinsichtlich ihrer Herkunft stellen.
In der Pubertät suchen alle Jugendlichen nach ihrer eigenen Identität. Sie sind damit beschäftigt, erwachsen zu werden. Selbstverständlich ist diese Aufgabe für adoptierte Jugendlichen viel komplizierter: Sie wachsen bei Eltern auf, die sie lieben und von denen sie geliebt werden. Daneben gibt es aber ein weiteres Elternpaar in einem anderen Land. Adoptiveltern sollten sich bewusst sein, dass die Beschäftigung mit der Herkunft keinesweg auf Unzufriedenheit mit den bestehenden Familienbeziehung oder mit Erziehungsdefiziten zu tun hat. Fremdländische Adoptivkinder entwickeln vielmehr eine Identität, die auf das Herkunftsland und auf das neue Heimatland bezogene Anteile enthält. Die Letzteren (das Gefühl, ein Deutscher zu sein) überwiegen (Gardell 1979; Feigelman/Silverman 1983; Geerars et al. 1991). Obwohl die Mehrzahl (80 bis 90%) der Adoptiveltern mit ihren Kindern über deren Herkunft reden, gibt es noch immer viele Eltern, die das nicht oder vielleicht zu spät tun. Diese Einstellung hat wahrscheinlich negative Folgen für die Eltern-Kind-Beziehung, da das Kind wichtige Aspekte des emotionalen Lebens und seiner Identität nicht oder kaum mit seinen Eltern teilen kann.
Die Frage ist, wann wir von einem Adoptionserfolg reden wollen, wie wir ihn definieren können. Ist zum Beispiel die Zahl der scheiternden Adoptionsverhältnisse bestimmend? Aber was heißt "Scheitern"? Wenn die Adoptierten die Adoptiveltern verlassen und nie wieder sehen? In einer langjährigen niederländischen Untersuchung (Vlierd/Waardenburg 1983; Hoksbergen et al. 1988; Geerars et al. 1991) hat man "Scheitern" etwas weiter definiert. Die Forscher sprechen von "Fehlvermittlungen": Damit sind alle Vermittlungen gemeint, wo das Adoptivkind kurze oder längere Zeit in einem Heim, einer Pflegestelle oder bei irgendeiner Hilfsorganisation verbleiben muss. Das Kind hat also während dieser Zeit, zwangsweise und durch die Not der Umstände bedingt, nicht bei den Adoptiveltern gewohnt. Auch haben die Familie und das Kind Hilfe psychologischer Art gebraucht. Höchstwahrscheinlich werden diese Eltern auf die Frage "Sind Sie mit der Adoption zufrieden?" die Antwort "unzufrieden" geben. Eine selbstverständliche Reaktion, weil Adoptiveltern fast immer einen großen Einsatz zeigen und nicht das Kind aus einem Heim irgendwo in der Dritten Welt geholt haben, um es in ihrer Heimat wieder in ein Heim zu stecken.
In der zuvor genannten niederländischen Studie sind alle Beteiligten - die 30 Adoptiveltern nebst einer Kontrollgruppe, die Hilfeleistenden (Gespräche über 145 Kinder in 66 Institutionen), die 40 fremdplatzierten Adoptivkinder nebst einer Kontrollgruppe - intensiv untersucht worden. Auch sind in die landesweite quantitative Analyse alle fremdländischen Kinder einbezogen worden, die bis zum 1.1.1986 in Holland platziert wurden (fast 16.000 Kinder). Wir werden nun einige der wichtigsten Ergebnissen kurz besprechen.
Im Jahre 1982 hat eine kleine Untersuchung ergeben (Vlierd/Waardenburg 1983), dass es sich bei ungefähr 2% aller aus Korea stammenden Kinder um Fehlvermittlungen handelte. Auch Textor (1990) und Verhulst (1989) nennen später für scheiternde Adoptionsverhältnisse eine Zahl von 2%. Wir wollten diese Angabe kontrollieren und zugleich mehr über die Faktoren erfahren, die zu Fehlvermittlungen führten. Zunächst haben wir alle 670 niederländischen Hilfsorganisationen angeschrieben. Die Rücklaufquote war mit 93% sehr gut. Es ist natürlich nicht richtig, bei der Berechnung des Prozentsatzes der Fehlvermittlungen alle angekommenen Kinder einzubeziehen - dann werden nämlich auch diejenigen Adoptivkinder einkalkuliert, die gerade erst in eine Familie platziert worden sind. Daher haben wir auf zweierlei Weise die Zahl der Heimeinweisungen berechnet. Zum einen haben wir die durchschnittliche Dauer des Aufenthaltes der Kinder in den Niederlanden beziehungsweise die durchschnittliche Zeit einkalkuliert, die die betroffenen Kinder in der Adoptivfamilie verbracht haben, ehe sie in ein Heim eingewiesen wurden (7,9 Jahre). Zum anderen haben wir für die in den Jahren 1974 bis 1978 platzierten Kinder den Prozentsatz der Fehlvermittlungen festgestellt, da wir für diese Gruppe über eine genaue Berechnung der Anzahl der Kinder, die Heimerziehung benötigten, verfügten. Die ermittelten Prozentsätze sind höher als die zuvor genannten: Die beiden Berechnungsweisen ergeben ungefähr den gleichen Prozentsatz von 5% bis 6%, durchschnittlich 5,7%.
Gemessen am Prozentsatz der niederländischen Kinder in Heimerziehung ist der Prozentsatz fremdländischer Adoptivkinder vier- bis fünfmal höher. Höchstwahrscheinlich ist dieser Unterschied korrekt, da wir nämlich in einer anderen Untersuchung (Hoksbergen 1983) festgestellt haben, dass Adoptiveltern vier- bis fünfmal öfter als andere Eltern irgendeine Art von Hilfe brauchen. Ich muss aber betonen, dass dieser Vergleich einerseits nicht dem großen Unterschied zwischen den zwei Gruppen von Kindern gerecht wird, da die Vorgeschichte der fremdländischen Adoptivkinder ja sehr oft problematisch gewesen und nicht mit derjenigen der anderen Kinder zu vergleichen ist. Andererseits ist unklar, ob die beiden Gruppen von Eltern vergleichbar sind. Anzumerken ist noch, dass auch bei dieser Untersuchung das Ankunftsalter eine große Rolle spielt.
Nachdem wir unsere quantitative Untersuchung abgeschlossen hatten, haben wir Heimerzieher und Eltern gefragt, was ihrer Meinung nach die wichtigsten Ursachen der Probleme sind. Die Heimerzieher betonten, dass an Adoptiveltern hohe Anforderungen gestellt werden müssen, weil viele Adoptivkinder bei ihrer Platzierung in mehr oder weniger hohem Maße depriviert seien. So sollten sie nicht durch mehrere Kinder überfordert werden - Adoptiveltern, deren Kind für einige Zeit in ein Heim eingewiesen wurde, hatten durchschnittlich mehr Kinder als Adoptivfamilien, die diese Hilfsangebote nicht brauchten. Da schon mehrere Untersuchungen (Hoksbergen et al. 1988; Geraars et al. 1991) dieses Ergebnis zeigten, können wir sagen, dass eine Familie mit zwei Adoptivkindern die ideale Familiengröße hat.
Zugleich wird deutlich, dass alle Adoptionsbewerber eine gute Vorbereitung benötigen. Daher haben wir in Holland jetzt einen Adoptivelternkurs eingeführt, der sogar für alle Ehepaare, die sich um ihr erstes Adoptivkind beim Justizministerium beworben haben, obligatorisch ist. Wie wichtig es ist, rechtzeitig die "Erziehungsprobleme" mit anderen Leuten - insbesondere andere Adoptiveltern können oft erste Hilfe leisten - zu besprechen, zeigt Forschungsergebnis, dass die Anfangsprobleme oft den Grund bilden für die späteren größeren Erziehungsprobleme.
Die Probleme, die in manchen Adoptivfamilien entstehen, werden teilweise auch von den großen und manchmal falschen Erwartungen verursacht, die das Ehepaar oft hat. Sie erwarten viel Freude und Glück und fast nur positive Veränderungen nach Ankunft des Kindes. Wenn das Kind dann sofort und für lange Zeit schwierige Verhaltensweisen zeigt, kann die Enttäuschung sehr groß sein. Dies gilt umso mehr, wenn das Ehepaar die Erwartung hat, dass ein bestimmtes Verhalten des Kindes zeitlich begrenzt ist und bald - nach einigen Wochen oder Monaten - wieder verschwindet. Wenn Eltern Liebe und Aufmerksamkeit geben wollen, das Kind aber fast nur Angst und Unsicherheit zeigt und auch gar nicht versteht, was diese warme Elternliebe bedeutet, wird recht viel von den Eltern gefordert. Deshalb sollten Adoptiveltern über drei Vorzüge verfügen: Geduld, Zurückhaltung und die Bereitschaft, ihre Ideen über die Erziehung von Kindern zu ändern. Und diese letzte Anforderung gilt besonders für die Eltern, die schon Kinder haben. Gerade diese Eltern können Erziehungsgedanken entwickelt haben, die nicht mit den neuen Anforderungen harmonieren, die ihr Adoptivkind stellt.
Ferner ermittelten wir noch folgende Hauptunterschiede zwischen Eltern mit Adoptivkindern, die im Heim verbleiben, und einer vergleichbaren Gruppe von 30 Eltern: Die erstgenannten Eltern erhielten weniger soziale Unterstützung, mussten weniger lange auf die Vermittlung eines Kindes warten (weniger als ein Jahr) und berichteten häufig, dass die erste Begegnung mit dem Kind schlecht verlief. Auch handelte es sich um größere Familien, in denen es oft nur einen geringen Altersunterschied zwischen den Kindern gab. Außerdem waren die Kinder in ihrem Herkunftsland häufiger vernachlässigt worden.
Eigenschaften adoptierter Jugendlicher mit Heimerfahrung
Im letzten Teil dieser Untersuchung wurden 40 Jugendliche und Heranwachsende (15 bis 21 Jahre alt), die einige Zeit in einem Heim waren, verglichen mit 40 gleichaltrigen Adoptierten, die diese Erfahrung nicht gemacht hatten. Beide Gruppen waren zurzeit unserer Untersuchung in vier Variablen gleich: Ankunftsalter (durchschnittlich 3,9 Jahre), Herkunftsland, Geschlecht (19 Jungen, 21 Mädchen) und Alter. Fast alle Personen wurden einige Stunden lang interviewt; sie mussten auch einige standardisierte psychologische Fragenbögen ausfüllen.
Die Untersuchung ergab, dass je älter das jeweilige Kind bei der Ankunft war, desto älter es auch war, als es in ein Heim kam. Die meisten Kinder waren 12 Jahre alt und älter, als sie in ein Kinderheim eingewiesen wurden. Bei den Kindern, die große Probleme aufwiesen (und in ein Heim gebracht wurden), fingen diese Probleme sehr schnell nach ihrer Ankunft in der Familie an.
Von welcher Art von Problemen haben wir bis jetzt gesprochen? Und sind diese Probleme anders als zum Beispiel bei einer niederländischen Vergleichsgruppe? Da diese Fragen für uns so fundamental sind, werde ich diesbezügliche Ergebnisse von mehreren Untersuchungen vorstellen (Hoksbergen et al. 1987; Verhulst/Versluis-den Bieman 1989; Geerars et al. 1991). Die Ergebnisse unserer Untersuchung über 115 Adoptivkinder aus Thailand, die im Durchschnitt neun Jahre alt waren, ergaben: Erstens sehen wir hier den großen Unterschied zwischen den beiden dargestellten Altersgruppen. Zweitens sehen wir aber auch, welches die wichtigsten Probleme nach Meinung der Eltern sind: Konzentrationsmangel und Unehrlichkeit. Dennoch waren die weitaus meisten Eltern sehr zufrieden mit der Adoption. Dasselbe Ergebnis ermittelte Pruzan (1977) in einer Untersuchung über 168 Kindern mit einem Durchschnittsalter von 9,3 Jahren.
Bei unserer anderen Untersuchung über 40 Adoptierte im Alter von 15 bis 21 Jahren wurde ein bekannter Fragebogen verwendet: die Child Behaviour Checklist (Achenbach 1983). Die Adoptierten wurden gebeten, 120 Fragen über Verhaltensprobleme zu beantworten. Die Heimerziehungs- und die Kontrollgruppe (gematcht hinsichtlich dreier Variablen: Geschlecht, Ankunftsalter und Herkunftsland des Kindes) sind auf zweierlei Art miteinander verglichen worden. Zudem wurden ihre Eltern gebeten, die Liste auszufüllen.
Auch hier treten "Konzentrationsmangel", "Streben nach Aufmerksamkeit" und "Wiederspenstigkeit" in beiden Gruppen der Adoptierten als größere Probleme auf. Aus ihrem problematischen Hintergrund heraus ist dies auch zu verstehen. Der Mangel an Konzentration und das sehr starke Bedürfnis nach Aufmerksamkeit sind Merkmale, die zum Deprivationssyndrom gehören. Ihre Wiederspenstigkeit muss vielleicht auch aus der Tatsache heraus verstanden werden, dass es Eltern sind, die das Kind beurteilt haben. Weiter ist wichtig, dass hinsichtlich der drei Variablen "Verschlossenheit", "schlechte Schulleistungen" und "keine Schuldgefühle" die Heimerziehungsgruppe weit mehr Probleme zeigt. Vielleicht hängen diese drei Faktoren mit der Tatsache zusammen, dass die Eltern ein starkes Bedürfnis nach Hilfe erlebten.
Items der "Child Behaviour Checklist", bei denen die Heimerziehungsgruppe dreimal so viel oder noch mehr Punkte erzielte als die Kontrollgruppe (Items - xmal höher als Kontrollgruppe)
- Asthma 3.3
- Ich fühle mich einsam 3.2
- Ich fühle mich verwirrt 3.8
- Selbstmordversuche 3.3
- Essprobleme 3.9
- Ich schlage mich viel 10.0
- Ich werde viel schikaniert 7.8
- Ich lüge oder betrüge 3.2
- Ich sehe keine Probleme 8.9
- Ich greife andere Leute körperlich an 5.0
- Ich weigere mich zu reden 3.0
- Ich laufe weg 4.2
- Ich sehe Dinge, die sonst keiner sieht 5.6
- Ich stifte Brände 3.9
- Ich stehle von anderen 12.2
- Ich tue Dinge, die andere Leute als sonderbar betrachten 3.8
- Selbstmordgedanken 4.6
- Ich bedrohe andere Leute 6.7
- Ich schwänze die Schule 3.1
Die beiden Gruppen von je 40 Adoptierten haben auch die "Child Behaviour Checklist" (CBCL) ausgefüllt. Hier ging es um die Ermittlung der Hauptunterschiede zwischen den beiden Gruppen. Daher werden in Tabelle 6 nur die Items genannt, bei denen die Heimerziehungsgruppe dreimal so viel oder noch mehr Punkte erzielte als die Kontrollgruppe. Im Rahmen der Interviews mit den Adoptierten wurde auch versucht, einige allgemeine Risikofaktoren zu erfassen. Während beiden Gruppen der sehr hohe sozioökonomische Status der Eltern gemeinsam war, wurde für die Heimerziehungsgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe ermittelt, dass
- es häufiger zu Ehescheidungen kam.
- die Familien zum Zeitpunkt der Platzierung größer waren.
- die Adoptiveltern häufiger leibliche Kinder hatten.
- das Adoptivkind älter als die übrigen Kinder war oder ältere und jüngere Geschwister hatte.
- das Adoptivkind zum Zeitpunkt der Platzierung in einem schlechten Gesundheitszustand war.
- die Anpassungsprobleme komplexer und intensiver waren (hinsichtlich emotionaler Beziehungen, Bindungsverhalten usw.) und mehr praktische Probleme (mit Essen, Schlafen, Sprechen) einschlossen.
- die zum Zeitpunkt der Untersuchung ermittelten Probleme viel früher begannen (bei einem Drittel der Adoptierten im ersten Jahr nach ihrer Platzierung).
- die Adoptierten unter mehr Problemen pro Person litten.
- die meisten Adoptierten (65%) die Ursachen der Probleme zu je 50% bei ihren Eltern und sich selbst sahen; bei der Kontrollgruppe waren es nur 31%.
Mehrere der genannten Faktoren wurden auch in anderen Untersuchungen wie in derjenigen von Kühl (1985) gefunden. Dieser folgert, dass deshalb an Adoptiveltern eine Reihe zusätzlicher Anforderungen gestellt werden müssten. Dazu gehören eine erhöhte Risikobereitschaft aufgrund unzuverlässiger medizinischer Informationen, erzieherische Flexibilität und psychische Belastbarkeit hinsichtlich möglicher Eingewöhnungsschwierigkeiten des Kindes.
Winter-Stettin (1984) ermittelte bei ihrer Untersuchung über die bei Terre des Hommes vorkommenden Replacements: Replacementkinder wurden überproportional häufig als Zwischenkinder platziert worden und hatten eine besonders problematische Vorgeschichte. In circa 50% der Fälle wurden bei der Vermittlung Elternwünsche hinsichtlich Alter und/oder Geschlecht, Herkunftsland, Gesundheitszustand und Anzahl der Kinder nicht erfüllt. Und auch Winter-Stettin nennt besondere Anforderungen an die Stabilität von Ehe und Familie. Sie zitiert Huth (1977), der sagt, dass es auch bei der Adoption älterer Kinder die Familienverfassung insgesamt ist, die über den Verlauf der Adoption entscheidet.
Schlussbemerkung
Der schweizerische Kinderpsychiater Herzka (1977) hat schon vor vielen Jahren geschrieben, dass es Erfahrungen aus kinderpsychiatrischen Sprechstunden nahe legen, von einem Adoptionssyndrom zu sprechen. Er meint damit eine spezifische psychopathologische Risikosituation für Kinder, die nicht in der eigenen Familie aufwachsen. Seiner Meinung nach ist das Syndrom pathogenetisch durch eine Trias charakterisiert: Hohe Erwartungshaltung der Adoptiveltern, Identitätsproblematik beim Kind und Status nach Risikoschwangerschaft oder Risikogeburt. Die Symptome beim Kind sind neurotische und psychosomatische Beschwerden, gestörte soziale Integration, besonderes Geltungsbedürfnis oder stark gehemmtes Verhalten, Aggressivität oder Wehrlosigkeit. Dies hat zu heftigen Auseinandersetzungen geführt, ob man wirklich von einem Adoptionssyndrom sprechen kann.
Ich habe hier nicht den Platz, um diese Fragestellung weiter auszuarbeiten. Sie soll nur verdeutlichen, wie kompliziert das Adoptionsphänomen ist. Die Gefahren für ein Ehepaar (und Kind), das unvorbereitet, mit hohen Erwartungen und ohne Informationen über eine mögliche adoptionsspezifische Nachbetreuung das Adoptionsabenteuer beginnt, sind groß. Das bedeutet auch, dass an die Vermittler fremdländischen Adoptivkinder besondere Anforderungen gestellt werden müssen. Diese Organisationen sollten mit Psychologen, Pädagogen oder Sozialarbeitern zusammenarbeiten. Über das Kind sollten möglichst viele Daten gesammelt werden. Auch sollte mit anerkannten Organisationen im Herkunftsland kooperiert werden und nicht mit einzelnen Personen wie Ärzten, Rechtsanwälten und Priestern. Privatadoptionen sind nur zu verantworten, wenn diese in einen kontrollierten Adoptionsvorgang eingebettet sind und intensiver Kontakt zu Adoptionsorganisationen und anderen Adoptiveltern besteht. Wenn die Eltern ihre Kinder dauerhaft lieben, wirkliches Interesse für deren Identitätsentwicklung und Individualität zeigen und Probleme in Harmonie angehen können, wird die Adoption eines fremdländischen Kindes durchaus dem Kindeswohl entsprechen.
Da nach den zuvor besprochenen wissenschaftlichen Untersuchungen die Mehrzahl der Auslandsadoptionen zufrieden stellend verläuft, ist anzunehmen, dass Adoptiveltern fremdländischer Kinder im Großen und Ganzen den Anforderungen entsprechen. Trotzdem könnten größere Verbesserungen in der Adoptionsvermittlungspraxis und bei der Nachbetreuung von Adoptivfamilien den Adoptionserfolg noch erheblich steigern.
Medizinische Aspekte bei der Adoption fremdländischer Kinder
Tom Schulpen, Niels Sorgedrager
Bei diesem Kapitel handelt es sich um eine gekürzte und überarbeitete Fassung eines Beitrags erschienen in: Hoksbergen/Walenkamp (1991)
Während der letzten Jahre wurden immer mehr Erkenntnisse über den Gesundheitszustand fremdländischer Adoptivkinder bei ihrer Ankunft in Europa und danach gesammelt. Seit der ersten Publikation zu diesem Thema aus dem Jahr 1979 (Schulpen et al. 1979) haben verschiedene Untersuchungen überraschende Befunde erbracht: Es erwies sich, dass 60% der Kinder eine Krankheit oder Störung aufwiesen, die aber im Allgemeinen gut zu behandeln sind (Van der Heide-Wessel/De Groot 1979).
In manchen Herkunftsländern von Adoptivkindern kommen nur selten tropische Krankheiten vor (Korea), während in anderen Ländern Krankheiten auftreten, die der europäische Arzt in der Regel nur aus Büchern kennt.
Dazu kommt, dass bestimmte Krankheitsbilder eine feste geographische Verbreitung haben. Beispielsweise gibt es den Schistosoma-Parasit in zwei Formen, von denen sich die afrikanische Art in der Blase und dem urinalen Trakt, aber auch in den Därmen, einnistet, während die südamerikanische Variante sich auf die Därme beschränkt. So wird bei einem surinamischen Kind eine Blasenentzündung nie von diesem Parasiten verursacht werden können, wohl aber bei einem Kind aus Äthiopien.
Es gibt auch verschiedene Praktiken der traditionellen Heilkunde, die manchmal zu den "bizarrsten" Abweichungen führen können.
So ist aus der Forschung bekannt, dass indonesische Adoptivkinder, bei denen sich nach ihrer Ankunft in Holland Lähmungen entwickelten, eine sehr seltene Gehirnmissbildung in Form einer Höhle oder porencephalen Zyste hatten (Barth et al. 1987). Die wahrscheinlichste Erklärung für das verhältnismäßig häufige Vorkommen dieser Abweichung ist der Gebrauch von örtlich bekannten Mitteln bei einem Abtreibungsversuch. Eine derartige Höhlenbildung kann durch eine einfache echographische Untersuchung des Gehirns durch die noch offene Fontanelle des Babys ausfindig gemacht werden. Oder: In Äthiopien wird bei einigen Stämmen das Zäpfchen (uvula) abgeschnitten, wenn ein Kind regelmäßig obere Luftweginfektionen hat. Der Arzt entfernt das Zäpfchen mit einer großen Schere, was häufig zu einem großen Blutverlust führt.
1. Alter des Adoptivkindes und Eintritt der Pubertät
Obwohl die Kinder ein offizielles Geburtsdatum bekommen haben, erweist sich dieses bei älteren Kindern oft nur als eine bloße Schätzung. Manchmal stellt sich heraus, dass ein Unterschied von ein bis zwei Jahren zwischen dem wirklichen Alter und dem angegebenen Geburtsdatum besteht. Meistens hat man die Kinder zu jung geschätzt, weil sie oft unterernährt waren und geistig ungenügend stimuliert worden sind. Die Ermittlung des wirklichen Alters ist nicht leicht, weil das Alter des Skeletts, das durch ein Röntgenbild der Handwurzelknochen festgestellt wird, aufgrund von Unterernährung zu niedrig geschätzt werden kann. Die Feststellung des Alters des Gebisses kann hier weiteren Aufschluss geben, vorausgesetzt, dass die Untersuchung von erfahrenen Ärzten durchgeführt wird. Schließlich können psychologische Tests bei der endgültigen Festlegung des Alters helfen.
Ein spezielles Problem bildet der frühe Eintritt der Pubertät, den wir regelmäßig bei fremdländischen Adoptivkindern wahrnehmen. Manchmal hat dies mit einer falschen Altersbestimmung zu tun, manchmal aber erweist sich auch, dass diese Kinder früher in die Pubertät kommen als andere Kinder; man spricht in diesem Fall von Pubertas Praecox. Diese frühe Pubertät kann bei Mädchen um das achte und bei Jungen um das zehnte Lebensjahr herum auftreten und einen großen Einfluss auf die letztlich zu erreichende Körperlänge haben. Weil viele fremdländische Kinder sowieso kleiner sind, kann ein zu früher Wachstumsstop in der Pubertät ernste Konsequenzen haben. Jedoch können diese Kinder mit Hormonen behandelt werden, um die Pubertät aufzuschieben und das Wachstum zu fördern. Dies hat wohl praktische und ethische Implikationen, aber eine Körperlänge von weniger als 150 cm bei Mädchen oder von weniger als 160 cm bei Jungen kann durchaus negative Folgen für das Selbstbild der Heranwachsenden haben.
2. Die perinatale Entwicklung der Adoptivkinder
In einer Bevölkerung, in der es Unterernährung, viele Krankheiten und eine mangelhafte Geburtshilfe gibt, sind die Kindersterblichkeit oder die Gefahr einer Schädigung des neugeborenen Kindes groß. Leider ist über die perinatale Phase und den Geburtsverlauf bei fremdländischen Adoptivkindern in der Regel wenig bekannt. Wohl versuchen Auslandsvermittlungsstellen, möglichst viele Informationen einzuholen, und raten den Eltern, so viel wie möglich über diese Zeitspanne zu erfragen, falls sie das Kind selbst in seinem Heimatland abholen.
Es ist davon auszugehen, dass Fürsorge und Zuwendung nicht optimal gewesen sind, bevor das Kind nach Europa kommt. Körperliche und affektive Vernachlässigung und manchmal auch Misshandlung werden festgestellt; außerdem weisen manche Kinder Verletzungen auf. Bei der ärztlichen Untersuchung muss man insbesondere auf alte Knochenbrüche, Narben durch Brandwunden oder Misshandlung und Gehirnverletzungen achten. Wenn das Kind in der Zeit vor der Adoption zu wenig Zuwendung und Liebe erfahren hat und geistig ungenügend stimuliert worden ist, kann ein beträchtlicher geistiger Rückstand die Folge sein. Es zeigt sich aber, dass sich die meisten dieser Kinder schnell regenerieren und die Entwicklungsrückstände aufholen.
3. Ernährung
Ein akutes Problem, das sich meistens sofort nach der Ankunft zeigt, ist das Auftreten von Durchfall. Dieser kann durch Bakterien (Salmonella, Campylobacter oder Shigella) oder Viren (meist Rotavirus) verursacht sein. Auch können bestimmte Darmparasiten (Giardia lamblia, Amöben) Durchfall hervorrufen. Es ist bei einem solchen Befund wichtig, richtig zu diagnostizieren und umgehend mit der Behandlung zu beginnen. Für den normalen Durchfall betrifft dies die orale Rehydrationsflüssigkeit, die von verschiedenen Firmen geliefert wird. Es ist davon abzuraten, Kindern, die jünger als zwei Jahre alt sind, stopfende Medikamente zu verabreichen - dies kann sogar gefährlich sein. Eine leicht verdauliche, ansteigende Diät nach der Durchfallperiode ist wichtig, wobei möglichst wenig Milch und Milchprodukte gegeben werden sollten.
Die Schädigung der Darmwand, die der Durchfall verursacht, hat bestimmte Enzymaktivitäten gestört, wie die der Laktase, die den Milchzucker (Laktose) abbaut. Eine laktosearme Nahrung kann somit die Beschwerden vermindern; Almiron B enthält nur 1% Laktose, während Almiron M2 und Frisolac 7% Laktose enthalten.
Die meisten fremdländischen Adoptivkinder haben für eine kurze oder längere Zeit Mangel an energiereicher Nahrung erfahren - oft mangelte es sowohl an eiweißreichen Nahrungsmitteln als auch an Vitaminen und Mineralien wie Eisen. Hierdurch sind sie anfälliger für Infektionen. Länge- und Gewichtsrückstand, eine gestörte Knochenentwicklung sowie Schwäche des Bindegewebes und der Muskeln (Hypotonie) können auftreten. Im Allgemeinen erholen sich die Kinder besonders schnell; es verschwindet die Hypotonie innerhalb einiger Monate. Meistens kommt es zu einer Phase der Fressgier, wobei insbesondere etwas größere Kinder so viel wie möglich hinunterschlingen. Das Essbedürfnis ist lange Zeit nicht befriedigt worden, und das Kind kann sich nun endlich am Essen gütlich tun. Der Rückstand kann so in der Regel leicht aufgeholt werden. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Essbedürfnis im Verlauf der Zeit wieder geringer wird. Dennoch ist darauf zu achten, dass die Kinder nicht kohlehydratreiche und süße Nahrungsmitteln im Übermaß zu sich nehmen.
Manche Kinder, die in die Trotzphase gekommen sind, weisen ein anderes Verhaltensmuster auf: Sie weisen das Essen entschieden zurück, akzeptieren nur noch die Flasche oder wollen nur bestimmte Nahrungsmittel essen. Die Gefahr ist groß, dass die Eltern dem Aufessen der vorgesetzten Nahrung zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil sie fürchten, dass das sowieso schon dünne Kind noch unterernährter werden und sich dadurch Krankheiten zuziehen könnte. Oft ist es besser, dieses Problem mit Hilfe eines Psychologen oder Pädagogen im Frühstadium anzugehen. Mit einem Belohnungssystem und einer entspannten Vorgehensweise ist es oft möglich, einer Eskalation zuvorkommen.
Ein wichtiger Punkt ist der Einfluss von Unterernährung auf das spätere Funktionieren des Gehirns. Hierzu liegen viele Untersuchungsbefunde vor. Übereinstimmende Ergebnisse gibt es aber nicht, weil man Einflüsse der Umgebung, die ungenügende Stimulierung und die Folgen einer Hospitalisierung nicht vom direkten Einfluss der Unterernährung trennen kann. Dennoch weisen die Untersuchungen in die Richtung einer Verminderung bestimmter Gehirnfunktionen bei Kindern, die lange Zeit unterernährt gewesen sind.
Hoorweg (1976) beschreibt in seiner Doktorarbeit, dass bei einer Gruppe von etwa 15-jährigen ugandischen Kindern, die während einer längeren Zeit stark unterernährt waren, das Argumentieren und das Raumgefühl gestört waren, während das Gedächtnis einen leichten Rückstand gegenüber normal entwickelten ugandischen Kindern aufwies. Bemerkenswert war, dass die Sprachfähigkeit nahezu ungestört blieb, ebenso wie die motorische Entwicklung.
Fremdländische Adoptivkindern müssen meistens zusätzlich Vitamin D erhalten, da sie wegen ihrer dunklen Haut in unserem gemäßigten Klima davon zu wenig produzieren. Vitamin D wird nämlich unter dem Einfluss des Sonnenlichts in der Haut gebildet, kommt aber ansonsten, außer in Fischprodukten und als Zusatz in Margarine, kaum in unserem Nahrungspaket vor.
4. Angeborene Behinderungen
Im Allgemeinen werden angeborene Behinderungen bereits von Ärzten beurteilt, bevor das Kind in eine Adoptivfamilie kommt. Zumeist wird ein Gutachten eines Kinderarztes aus dem Heimatland angefordert. Wenn nötig, wird um ergänzende Untersuchungen gebeten. Wenn sich herausstellt, dass eine Behinderung besteht, die mit einer Operation oder Behandlung in Deutschland beseitigt werden kann, dann wird dies den Eltern mitgeteilt. Diese können dann entscheiden, ob sie ein Kind mit einer derartigen Behinderung haben wollen. Es handelt sich meistens um Herzfehler, Hasenscharte, Behinderungen der Arme oder Beine, Sehbehinderungen, Gehörstörungen oder leichte Lähmungen.
Bei ernsthaften körperlichen und insbesondere geistigen Störungen ist zu erwägen, ob ein solches Kind in einer Familie aufwachsen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wird meistens beschlossen, das Kind im Kinderheim des Heimatlandes zu lassen und finanziell zu unterstützen. Dies gilt vor allem für geistig schwer behinderte Kinder, für Kinder mit einer schweren körperlichen Behinderung und für Kinder mit einer kurzen Lebenserwartung - zum Beispiel aufgrund von AIDS.
Es zeigt sich aber, dass nur 30% der seropositiven Babys letztendlich die AIDS-Krankheit bekommen. So kann man die Entwicklung von seropositiven Kindern im Verlauf der nächsten anderthalb Jahre verfolgen und sie danach in eine Adoptivfamilie vermitteln, falls die Antistoffe, die durch die Mutter in das Kind gekommen sind, verschwunden sind. Kinder, die das AIDS-Virus haben, weisen in der Regel innerhalb von einigen Monaten bis zu einem Jahr Krankheitserscheinungen auf und sterben meistens nach zwei oder drei Jahren.
Obwohl es einige Eltern gibt, die auch ein Kind mit AIDS adoptieren würden, ist es die Aufgabe des ärztlichen Beraters, so ehrlich und objektiv wie möglich über die Konsequenzen der Annahme eines chronisch kranken Kindes zu informieren (Dorssen et al. 1990).
5. Erbkrankheiten
Erbkrankheiten manifestieren sich bisweilen erst im fortgeschrittenen Alter, können aber auch auf die nächste Generation übertragen werden, ohne dass der Träger Symptome aufweist. Deswegen ist eine derartige Erkrankung nur schwer ausfindig zu machen, insbesondere wenn man über die geographische Verbreitung bestimmter Abweichungen nicht Bescheid weiß. So kommt beispielsweise die Sichelzellenanämie hauptsächlich bei der negroiden Bevölkerung vor, während Thalassämie vor allem im Mittelmeergebiet und in Asien auftritt. Diesen Erbkrankheiten ist gemeinsam, dass die roten Blutzellen aufgrund der erblichen Abweichung schneller abgebaut beziehungsweise weniger gut produziert werden, wodurch es zu Blutarmut kommt.
Bei der Sichelzellenanämie entstehen Gerinnsel in den kleinen Blutgefäßen durch das Zusammenklumpen sichelförmiger roter Blutkörperchen. Diese können zu heftigen Schmerzanfällen führen, hauptsächlich in den Händen und Füßen.
Bei der Thalassämie ist der Blutabbau derart gestört, dass alle sechs Wochen eine Bluttransfusion notwendig ist. Darüber hinaus müssen während der Nacht spezielle Medikamente durch einen kleinen subkutanen Schlauch verabreicht werden, um den sich im Körper befindenden Eisenüberschuss abzubauen.
Diese beiden Krankheitsbilder entstehen, wenn der Vater und die Mutter beide Träger der Erbkrankheit sind. Im Durchschnitt bekommt dann eins von vier Kindern diese Krankheit. Die Trägerschaft selber verursacht bei der Sichelzellenanämie keine Beschwerden, während sie bei der Thalassämie zu einer leichten Blutarmut führen kann. Meist wird die Thalassämie dadurch erkannt, dass beim Kind die Blutarmut nicht verschwindet und es ungenügend auf die verabreichten Eisenpräparate reagiert. Leider zeigt sich, dass die meisten Ärzte über diese Form von Blutarmut nicht Bescheid wissen und deshalb zu lange Eisen verabreichen, wobei die Gefahr einer Anhäufung von Eisen im Blut besteht.
Auch sollte bei Auslandsadoptionen jedes Baby im Alter von unter einem Jahr auf Erkrankungen der Schilddrüse oder des Stoffwechsels (Phenylketonurie) untersucht werden.
6. Infektionskrankheiten
Am häufigsten kommen bei fremdländischen Adoptivkindern Infektionskrankheiten vor. Gut die Hälfte der Kinder hat bei ihrer Ankunft eine oder mehrere Infektionen oder hat im Heimatland eine Infektionskrankheit durchgemacht. Durch die unhygienischen Verhältnisse sind es insbesondere parasitäre und bakterielle Erkrankungen, wobei Darm- und Hautinfektionen vorherrschen. Darminfektionen werden durch Bakterien, Viren oder Parasiten verursacht, die neben Durchfall auch andere Probleme verursachen.
So bewirkt beispielsweise der Grubenwurm, der sich in der Darmwand mit Blut ernährt, Blutarmut, während der Spulwurm, der sich wie ein Knäuel Spaghetti im Darm befindet, Verstopfungen oder sogar Unterernährung hervorrufen kann. Amöben können schwere Abweichungen in der Darmwand und Leber bewirken.
Deshalb ist es wichtig, dass der Stuhl der Adoptivkinder auf tropische Parasiten kontrolliert wird. Ohnehin sollten diese Kinder möglichst von Kinderärzten mit Tropenerfahrung untersucht werden.
Bei Hautinfektionen handelt es sich vor allem Krätze (Skabies) und Schimmelinfektionen.
Krätze ist manchmal schwer erkennbar, weil die typischen kleinen Gänge, die die Krätzemilbe unter die Haut gräbt, meist aufgrund des Kratzens des Kindes nicht zu sehen sind. Skabies verursacht nämlich intensives Jucken. Man kann Schimmelinfektionen, die depigmentierte Stellen auf der Haut verursachen, am besten mit Selsun behandeln.
Tuberkulose kommt in Entwicklungsländern häufig vor. Deswegen werden die meisten Kinder kurz nach der Geburt geimpft. Diese so genannte BCG-Impfung geschieht mit einem abgeschwächten Tuberkelbakterium. Es verursacht ein kleines Geschwür an der Stelle der Impfung, meist auf der linken Schulter. Hierdurch werden Antistoffe gegen Tuberkulose gebildet, was zur Folge hat, dass die Mantoux-Reaktion - ein Test, um den Kontakt mit Tuberkulose nachzuweisen - positiv wird. Die Narbe auf der Schulter ist beim fremdländischen Adoptivkind der Beweis, dass eine BCG-Impfung erfolgte.
Geschlechtskrankheiten wie Syphilis (Lues) kommen zwar nicht so häufig vor, werden aber dann und wann diagnostiziert. Sie verursachen bei Babys nur selten Krankheitserscheinungen, können aber nach einiger Zeit ernste Abweichungen bewirken, hauptsächlich im Knochenbau und im Gehirn. Es ist deshalb sehr wichtig, alle fremdländischen Adoptivkinder auch auf Syphilis zu untersuchen, zumal dieses Krankheitsbild in den Tropen viel häufiger vorkommt als in Europa. Manchmal findet man nur Antistoffe gegen Lues, ohne dass die Bakterien auf das Kind übergegangen sind. Die Behandlung ist einfach und besteht aus einer Reihe von Penizillininjektionen.
Gelbsucht (Hepatitis) ist eine häufig vorkommende Krankheit. Hier handelt es sich um eine Infektionskrankheit, bei der das Virus über die Exkremente übertragen und durch das Trinken oder Essen von infizierten Nahrungsmitteln aufgenommen wird. Durch die unhygienischen Zustände und das heiße Tropenklima ist dieses Virus in der Dritten Welt weit verbreitet. Reisen Adoptionsbewerber in tropische Länder, so sollte ihnen empfohlen werden, sich mit Gammaglobulin impfen zu lassen, wodurch sie einige Monate lang gegen diese Krankheit geschützt sind. Es hat sich gezeigt, dass Adoptiveltern, die nie in den Tropen gewesen sind, aber ein von dort stammendes Kind in die Familie aufgenommen haben, auch mit dem Hepatitis-A-Virus infiziert worden sind. So sollte erwogen werden, ob in einem solchen Fall nicht die ganze Familie mit Gammaglobulin gegen Hepatitis-A geschützt werden sollte.
Hepatitis-B ist die zweite Form der Gelbsucht. Sie wird nur durch Blut oder sexuelle Kontakte übertragen. Ein Träger des Virus ist nicht krank, hat aber das Virus in seinem Blut, das dadurch ansteckend ist. Etwa 5 bis 10% der Bevölkerung Asiens sind Träger, für Afrika und Süd-Amerika ist dieser Prozentsatz etwas niedriger. Es zeigt sich, dass das Hepatitis-B-Virus während der Schwangerschaft auf ein Kind übergehen kann. Gibt man kurz nach der Geburt Gammaglobulin gegen Hepatitis-B und wird das Kind danach dreimal geimpft, dann verhindert man dadurch eine Trägerschaft. Dies ist bei fremdländischen Adoptivkindern in der Regel nicht möglich, weil bereits innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt mit dieser Behandlung begonnen werden muss. Sollte das Kind Träger dieser Krankheit sein, dann muss man bei der Abnahme von Blut oder bei Verletzungen vorsichtig sein, ansonsten gibt es aber wenig Gefahren. Nur wenn das Kind häufig andere Menschen beißt oder ein intensiver Blut-Blut-Kontakt stattgefunden hat, sollte man erwägen, die jeweilige Person impfen zu lassen. Jedoch wird im Allgemeinen die ganze Familie eines Kindes mit Hepatitis-B-Trägerschaft geimpft.
Es ist wichtig, dass ein fremdländisches Adoptivkind innerhalb von 14 Tagen von einem Kinderarzt untersucht wird, unter anderem, um die erwähnten Infektionskrankheiten möglichst schnell ausfindig zu machen. Auch wenn das Kind äußerlich gesund aussieht und keine Beschwerden hat, kann es dennoch eine Gefahr für seine Umgebung sein. Dies muss möglichst schnell ausgeschlossen werden.
7. Impfungen
Oft ist unbekannt, welche Impfungen die Kinder vor der Abreise aus ihrem Heimatland erhalten haben. Bei BCG-Impfungen macht dies wenig Probleme, obwohl manche Kinder erst sehr kurz vor der Abfahrt geimpft worden sind und sich bei ihnen nach einigen Wochen eine kleine Geschwür auf der linken Schulter entwickelt. Manchmal geht dies mit einer Drüsenschwellung in der Achselhöhle einher. Im Allgemeinen verschwinden diese Abweichungen spontan. Manchmal aber ist es nötig, INH-Puder (Antituberkulosemedikament) auf das Geschwür zu streuen oder INH-Puder zu verabreichen, um einen allzu heftig reagierenden Lympfknoten zu heilen.
Bei den übrigen Impfungen muss man sich auf die Angaben verlassen, die das Kind mitbekommen hat. Dabei ist zu überprüfen, ob die in Deutschland üblichen Impfungen erfolgt sind.
8. Grundlegende ärztliche Forschungsergebnisse
In den Jahren 1984 und 1985 wurden in den Niederlanden Untersuchungen über den Gesundheitszustand fremdländischer Adoptivkinder direkt nach ihrer Ankunft durchgeführt. Von den Kindern, die während dieser zwei Jahre ankamen, wurde fast die Hälfte nach einem festen Schema untersucht. Die Resultate wurden in einer Doktorarbeit dargestellt.
Während dieser zwei Jahre wurden insgesamt 2.236 Kinder adoptiert; 1.003 Untersuchungsprotokolle wurden ausgewertet (44,2%). 85% der Protokolle kamen von Kinderärzten (meist Kinderärzte mit Tropenerfahrung) und 15% von Hausärzten. Es zeigte sich, dass 86% der Kinder innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Einreise untersucht worden waren. Von den Kinder hatten zum Zeitpunkt der Ankunft
(a) 32% Hautkrankheiten, vor allem Skabies oder Krätze (11%),
(b) 15% Probleme im HNO-Bereich,
(c) 4% Sehstörungen,
(d) 5% einen Herzfehlerverdacht, wobei sich herausstellte, dass es sich beim größten Teil um ein unproblematisches Herzrauschen handelte,
(e) 13% Probleme mit dem Bauch, zumeist eine vergrößerte Milz oder Leber, manche hatten aber auch nur einen Nabelbruch,
(f) 6% Lungenprobleme, meist eine Entzündung,
(g) 4,5% Abweichungen an den Genitalien, wobei insbesondere Hodenhochstand oder eine zu enge Vorhaut vorkamen,
(h) 1% Harnwegsinfektionen,
(i) 4 % Haltungsschäden wie X-Beine, Fußabweichungen, Hüftprobleme oder ein schiefer Rücken, und
(j) 12% wiesen einen Entwicklungsrückstand auf.
Von den Mädchen hatten 30% und von den Jungen 22% bei der Ankunft einen Rückstand in der Körperlänge. Das Körpergewicht von 32% der Mädchen und 28% der Jungen lag unter der P3-Norm; P3 bedeutet, dass nur 3% der Bevölkerung ein so geringes Körpergewicht hat. Es stellte sich heraus, dass mehr als 60% der Kinder ein oder mehr körperliche Probleme aufwiesen, die aber meistens von wenig ernster Natur und leicht zu korrigieren waren. Jedoch mussten 2% der Kinder sofort in ein Krankenhaus eingewiesen und 11% an Fachärzte wie Dermatologen, HNO-Ärzte, Orthopäden, Augenärzte oder Kardiologen überwiesen werden. Auch hatten 5% der Kinder angeborene Behinderungen, meist leichter Art. Insgesamt 17 Kinder wiesen einen Komplex von Abweichungen (Syndrom) oder eine Stoffwechselstörung auf. Es zeigte sich, dass 1% der Kinder ein falsches Alter hatte.
Das Untersuchungsschema umfasste auch eine Laboruntersuchung, bei der Blut, Urin und Stuhl analysiert wurden. Ferner wurde ein Röntgenbild vom Herzen und der Lunge gemacht. Es stellte sich heraus, dass
(a) 25% der Kinder Infektionen im Blut aufwiesen,
(b) 17% unter Blutarmut litten,
(c) 18% gestörte Leberfunktionen hatten,
(d) 37% einen zu niedrigen Eiweißgehalt im Blut hatten,
(e) 2% Träger des Hepatitis-B-Virus waren und
(f) 0,3% Syphillis hatten.
Bei der Untersuchung des Stuhls wurden bei 17% der Kinder tropische Parasiten festgestellt, während gut 15% eine durch Salmonella oder Campylobacter verursachte Darmentzündung hatten. Die Untersuchung auf tropische Parasiten erfolgte in einem Tropenlabor und war somit viel gründlicher als Untersuchungen in örtlichen Labors.
Ein Röntgenbild vom Herzen und der Lunge zeigte in 12,5% der Fälle eine Abweichung, meist eine Lungenentzündung, manchmal aber auch Tuberkulose oder Herzfehler. Bei den meisten Kindern über ein Jahr wurde ein Handwurzelbild gemacht, um das Skelettalter festzustellen, und dieses stimmte in 30% der Fälle nicht mit dem angegebenen Alter des Kindes überein. Fast immer wurde dies durch Unterernährung verursacht.
Es fiel auf, dass sich die Untersuchungsbefunde von Hausärzten und diejenigen von Kinderärzten deutlich unterschieden:
Obwohl im Begleitbrief gebeten worden war, dem Untersuchungsschema zu folgen, ergab sich dennoch in der Praxis, dass von Hausärzten weniger Blutuntersuchungen durchgeführt wurden und manche sogar eine ganz oberflächliche Untersuchung vornahmen. Auch zeigte sich, dass bei den Hausärzten 61% der Kinder keine körperlichen Abweichungen aufwiesen, während dies bei Kinderärzten nur 35% waren. Es erwies sich, dass insbesondere Hautabweichungen, Vergrößerung der Leber und Herzfehler bei Hausärzten seltener vorkamen oder weniger häufig festgestellt wurden. Die Unterschiede bei den körperlichen Untersuchungen dürften zum Teil durch die Tatsache zu erklären sein, dass vor allem junge Kinder zum Kinderarzt geschickt wurden, während ältere Kinder häufiger beim Hausarzt vorgestellt wurden.
Die empfohlenen Laboruntersuchungen wurden von fast 90% der Kinderärzte durchgeführt, während weniger als 50% der Hausärzte diese veranlassten. Wahrscheinlich ist das komplizierte Blutabnahme- und Blutdeterminierungsverfahren in einem örtlichen Labor hierfür die Ursache, Auf jeden Fall müsste die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Hausärzten verbessert werden.
Zwei Jahre später wurde allen Eltern der untersuchten Adoptivkinder ein weiterer Fragebogen mit Fragen über das Wachstum und die Entwicklung der Kinder sowie über ergänzende ärztliche Daten geschickt. Fast 95% der Eltern beteiligten sich an dieser Umfrage. Es stellte sich heraus, dass sich während der ersten zwei Jahre viele Probleme bei den Adoptivkindern manifestierten:
Bei 4% entwickelten sich nachträglich Ekzeme und bei 1,5% Krätze. Bei fast 8% kam es zu Problemen im HNO-Bereich. Es ergab sich, dass 1% taub war, 7% Lungenentzündungen bekamen und fast 4% Magen-Darm-Beschwerden. Abweichungen im Muskel-Nerven-System wurden bei gut 3% der Kinder diagnostiziert. Fast 1% wies Knochenabweichungen auf und bei einem weiteren Prozent der Kinder wurde nachträglich eine gestörte Entwicklung festgestellt. Fast 2% der Kinder bekamen Gicht in den ersten zwei Jahren nach Ankunft.
Aus diesen Forschungsergebnissen ergibt sich, dass verschiedene Abweichungen erst nach einem Aufenthalt von ein bis zwei Jahren gefunden werden. Alle genannten Krankheitsbilder und Störungen kamen in der Gruppe der fremdländischen Adoptivkinder häufiger vor als im Durchschnitt der Bevölkerung. Es ist deswegen wichtig, die Entwicklung der Kinder zu verfolgen und auf eventuell nicht erkannte Abweichungen oder Entwicklungsstörungen zu achten.
Auch das Wachstum der Kinder wurde eingehend verfolgt. Bei ihrer Ankunft befand sich ein Drittel der Adoptivkinder unterhalb der niedrigsten Norm des internationalen Wachstumsstandards. Jedoch holten die meisten den Rückstand auf, sodass nach zwei Jahren schließlich nur noch 40 Kinder unterhalb der niedrigsten Norm blieben. Dies waren vor allem Kinder mit einem sehr geringen Geburtsgewicht, Unterernährung oder chronischen Krankheiten. Der größte Längen- und Gewichtsrückstand wurde in der Altersklasse von sieben bis 12 Monaten gefunden. Das Körpergewicht von 50% dieser Kinder war zu niedrig und 30% waren zu klein.
9. Schlussbemerkung
Der Gesundheitszustand fremdländischer Adoptivkinder lässt bei ihrer Ankunft in Europa oft zu wünschen übrig. Die Lebensumstände in der Dritten Welt mit schlechter Hygiene und einem tropischen Klima erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder eine lange Reihe von Krankheiten und Abweichungen aufweisen. Man darf annehmen, dass etwa 60% der Kinder eine oder mehrere Krankheiten oder Störungen mitbringen, was durch die dargestellte Untersuchung bestätigt wurde. Aufgrund dieser Forschungsergebnisse wurde in den Niederlanden ein neues Schema für die erste ärztliche Untersuchung entwickelt, das von allen Auslandsvermittlungsstellen verwendet und Eltern mitgegeben wird. Immer häufiger werden diese Untersuchungen von einem Kinderarzt mit Tropenerfahrung durchgeführt.
Teil 3
Fallbeispiele
Brief an meine Tochter
Eva Engelke
Liebe Jane!
Eigentlich fing ja alles schon viel früher an. Ich lebte mit meinem Freund zusammen. Meine Eltern lehnten diesen Mann ab, sein chaotisches Leben, seine langen Haare. Sie waren gegen meine Verbindung zu ihm.
Wir wohnten in einer Wohngemeinschaft. Dies entsprach so gar nicht den Vorstellungen meiner Eltern. Sie wussten auch eigentlich nicht sehr viel von ihm, von uns und davon, wie wir lebten. Die Eltern lehnten meinen Freund ab, und auch mich. Aber ihn zu verlassen, war zu schwer für mich.
Es hat Zeiten gegeben, da verstanden wir uns sehr gut. Doch von einem Tag auf den anderen hatten wir uns plötzlich nichts mehr zu sagen. Aber so richtig haben wir uns damals eigentlich nicht getrennt. Wir haben uns auch nie voneinander verabschiedet. Deshalb waren der Schmerz und die Trauer auch so groß, etwas zu verlieren, loszulassen, was man eigentlich liebt.
In diese Trauer und den Schmerz, in diese Ohnmacht hinein, nichts tun zu können, kam ein Brief: Brigitte, ein Mensch, eine liebe Freundin, mit der ich kurz zuvor noch gelacht hatte und glücklich gewesen war, war tot. Sie hatte einen Unfall gehabt und war gestorben. So einfach aus dem Leben herausgerissen. Es war schrecklich. Wieder spürte ich diese Ohnmacht in mir. Ich konnte es nicht fassen. Alle, die ich liebte, konnte ich nicht bei mir behalten. Vieles sah ich im Nebel. Wie konnte ich da noch leben? Ich wusste nicht mehr ein noch aus.
Mein ganzes Leben zog an mir vorbei, wie in einem Traum: Mein Vater war konsequent, streng. Nach Gefühlen fragte er nicht viel. Meine Mutter war fürsorglich, hilfsbereit, behutsam, schwach. Ich wusste aber nie, auf welcher Seite sie stand. Ich habe noch vier Geschwister, ich bin die zweitälteste. Bis zu meinem 12. Lebensjahr wohnten wir in Hamburg. Dann sind wir in das Rheinland gezogen. Meine vier Geschwister besuchten das Gymnasium. Ich habe neun Volksschulklassen besucht und mehrmals die Schule gewechselt. So richtige Freundinnen fand ich infolge der häufigen Schulwechsel nicht. Zu Hause musste ich auch die kleineren Geschwister beaufsichtigen, während meine Mutter zur Arbeit war. Ich habe zu Hause auch viel geholfen.
Nachdem ich die Schule hinter mir hatte, fing ich eine Hauswirtschaftslehre an. Ich teilte ein Zimmer mit drei anderen Lehrlingen. Zu dieser Zeit hatte ich auch einige Freundschaften, die aber nie von langer Dauer waren. Später habe ich noch in einem Mädchenwohnheim gelebt und gearbeitet. Ich war dort mit Kindern zusammen, und mochte sie alle.
Dann lernte ich meinen Freund kennen. Es war einfach wunderschön, dieses Zusammensein. Aber dann war es aus. Und danach? Ich musste ganz einfach raus - raus aus dieser Stadt. Überhaupt: einfach so los. Ich hatte keinen genauen Plan. Ich wusste nur, ich wollte mit meinen 21 Jahren einen neuen Anfang machen. Eine Zeit lang war ich in München. Ich hatte es mir dort aber anders vorgestellt. Die große Freiheit und so. Doch es war nur eine große, fremde Stadt. Allmählich aber habe ich das Leben um mich herum gesehen. Das Grün der Bäume und der Wiesen, die Menschen, die Sonne, das Wasser. Etwas Lebendiges kam wieder zurück. Ich fasste wieder Mut. Und ganz plötzlich, so wie ich meine Fahrt begonnen hatte, habe ich sie auch wieder beendet. Ich kehrte nach X. zurück.
Einige Zeit später traf ich meinen Ex-Freund wieder, mit dem ich einige Jahre zusammen gewesen war. Er lud mich in sein Haus ein, einfach so, als ob in der Zwischenzeit nichts geschehen wäre. Wir hörten Musik. Dieses Zusammensein sollte ich nicht so schnell vergessen, obwohl wir nur einen Tag lang zusammen waren.
Plötzlich merkte ich, wie ich mich veränderte, mein Körper, einfach alles. Meine Regel blieb aus. Aber außer mir merkte das niemand. Keiner zeigte Interesse und fragte mal, wie es mir so ging. Ich hörte auch nichts mehr von den Menschen, mit denen ich in der Wohngemeinschaft zusammengelebt hatte und die mir etwas bedeuteten. Und so warst du unterwegs!
Im Februar 1974 ging ich dann zum Arzt. Er sagte mir, dass ich ein Baby bekommen werde. Ich sei im zweiten Monat schwanger. Das war die Bestätigung dafür, was ich schon irgendwie geahnt hatte. Ich war stolz. Ich konnte es noch gar nicht so richtig fassen. Aber auch irgendwie war ich wieder traurig. Ich hatte so gar keinen Menschen, dem ich das alles hätte erzählen können oder der sich mit mir auf das Baby gefreut hätte. Wie sollte ich damit so allein fertig werden?
Zu der Zeit, als ich mich mit dem Gedanken vertraut machen musste, dass ich schwanger war, traf ich meinen jetzigen Partner, mit dem ich noch heute zusammenlebe. Ich hatte ein kleines Zimmer. Eine Arbeit hatte ich nicht. Mit den Eltern hatte ich schon lange keinen Kontakt mehr. Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte ich mich von einem lieben Menschen getrennt, wurde schwanger und lernte gerade wieder einen neuen Partner kennen. Konnte ich das diesem neuen Freund gleich zumuten und ihn damit belasten? Ein Kind, nicht von ihm? Eigentlich ging dies alles doch viel zu schnell!
Ich brauchte Rat. Ich rief meine Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass ich ein Baby bekomme. Ich wollte mit ihr sprechen, einfach so. Vielleicht wusste sie einen Rat. Ich spürte aber, dass meine Mutter überfordert war, denn zu Hause lebten meine große Schwester mit ihrem nichtehelichen Sohn und noch die drei kleineren Geschwister. Für mich war darin kein Platz. Ich brach unser Gespräch ab!
Auch während der ganzen Schwangerschaft habe ich nichts von meinen Eltern oder Geschwistern gehört. Dennoch hoffte ich, meine Mutter würde mit mir sprechen oder mir wenigstens zuhören. Denn heute weiß ich, ich hätte Menschen gebraucht, die mir zuhören, die mir hätten Kraft geben können. Aber nichts und niemand halfen mir.
Ich fühlte mich verlassen und allein. In dieser Situation ging ich zum Jugendamt. Dort wollte ich mich beraten lassen. Ich wollte wissen, welche Möglichkeiten es für mich als Frau und künftige Mutter von einem nichtehelichen Kind gab - allein, ohne Vater des Kindes. Mich interessierte, ob ich irgendwelche Unterstützung bekommen konnte.
Im Jugendamt saß eine ältere Frau, so richtig mütterlich, und hörte mir zu. Dann redete sie. Sie sprach sehr viel, sagte etwas von Adoption. Es wäre das Beste. Die Adoptiveltern hätten alles, was ich nicht hatte: Geld, Garten, Zeit. Und sie würden sich über so ein kleines Baby sehr freuen. Ich könne ja später weitere Kinder bekommen und würde diese Angelegenheit schnell vergessen. Im Mai oder Juni sollte ich in eine Klinik, wo auch noch andere Frauen seien, denen es ähnlich gehe. Ich könne dort auf der Station und in der Küche arbeiten. Über Hilfen oder sonstige Möglichkeiten, mein Kind zu behalten, sprach die Frau vom Jugendamt nicht. Das waren die einzigen Worte, die sie mir mit auf den Weg gab. Heute habe ich den Eindruck, dass diese Frau mich einfach überredet hat. Sie wollte mich mit ihren schönen Worten einfangen.
Etwas später brach ich mir den Arm, sodass der Aufenthalt in der Klinik verschoben werden musste. Aber ich freute mich auch, so allein wie ich war: In der Klinik würde ich bestimmt andere Menschen kennen lernen. Ich fuhr mit gemischten Gefühlen dort hin. Ich arbeitete auf der Station und in der Küche. Wenn ich frei hatte, unternahm ich lange Spaziergänge. Es war ein richtig heißer Sommer, und am liebsten habe ich nach meinen langen Spaziergängen ein Cappuchino-Eis gegessen. Gespräche wurden aber auch hier nicht geführt. Wir sollten uns nur zur Verfügung stellen, sobald die Geburt beginnt, zur Ausbildung der Schwesternschülerinnen. Irgendwie war ich auch hier verlassen und allein.
Nachts hatte ich merkwürdige Träume. Mein Kind würde mir weggenommen. Immer wieder dieser seltsame Traum: Ich sah eine Gestalt am Fenster, die mein Kind haben wollte. Ich war allein im Zimmer und konnte so mit keinem darüber reden. Immer, wenn ich einschlafen wollte, sah ich diese seltsame Traumgestalt. Aber ich dachte auch, dass ich es schon irgendwie schaffen würde.
Dann wurdest du geboren, an einem Dienstag, den 13. August 1974, um 6 Uhr und 11 Minuten. Du, meine Tochter Jane. Als alles vorbei war, lagst du im Babybett neben meinem Bett. Ich konnte dich sehen, deine Augen. Deine kleinen Hände konnte ich anfassen. Ich spürte Glück, Zufriedenheit, Stille in mir. Es war einfach ein Wunder, so einen kleinen Menschen hervorgebracht zu haben.
Am nächsten Tag wollte ich dich wieder sehen. Im Säuglingszimmer sagte man mir, das ginge nicht, und brachte mich auf irgendeine Art und Weise wieder in mein Bett. Ich war kraftlos, ohnmächtig, resigniert, leer. Ich durfte dich nicht sehen. Man hatte mir mein Kind weggenommen, ganz einfach so.
Gab es keine Möglichkeit, dich zu sehen? Ich liebte doch dieses kleine Wesen. Schöne Monate hatte ich doch mit ihm verbracht, in denen ich viel mit meinem Kind gesprochen und es auch gestreichelt hatte. Irgendwie wäre es sicherlich gegangen. Aber niemand war da, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Dann holte mich mein Freund ab, den ich kennen gelernt hatte, als ich schon schwanger war. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung gefunden.
Noch einige Zeit danach fühlte ich mich nicht gut. Ich hatte Fieber, Schmerzen und lag nur zu Hause herum. Ich war hilflos, kraftlos. Etwas in mir war kaputt, gestorben. Vom Jugendamt wurde ich noch ein paar Mal angeschrieben, was ich jedoch in meinem Fieberzustand nicht so recht wahrnehmen konnte. Ich fragte meinen Freund, was ich denn nun tun soll. Auch er konnte mir nicht weiterhelfen, wusste keinen Rat.
Vom Jugendamt hörte ich etwas von 12 Wochen. Diese Zeit hätte ich zum Entscheiden, was mit dem Kind geschehen sollte. Hatte man mir nicht schon alles genommen? Nebenbei erfuhr ich, dass du in einem Säuglingsheim wärst. Wie sollte ich da hinkommen? Jeder Schritt tat mir weh. Was heißt das überhaupt: Adoption? Damit hatte ich mich überhaupt noch nie befasst. Und was sind schon 12 Wochen? Die sind doch im Nu vorbei.
Am 21. September 1974 bekam ich vom Jugendamt einen Brief. Darin stand, dass du jetzt bei den Adoptiveltern wärst. Diesen Brief versteckte ich. Ich konnte es nicht ertragen. Er verschwand irgendwo im Schrank. Ich spürte Trauer in mir. Hilflos dieser ganzen Situation gegenüber ging ich zu dem Amt. Wie in Trance habe ich unterschrieben. Es war der 14. November 1974. Drei Tage vor meinem Geburtstag. Ein Wahnsinn! Und dann?
Ich weinte oft, hatte Depressionen. Es war furchtbar. Ich fand eine Arbeitsstelle als Küchenhilfe. Zusätzlich nahm ich noch einen Job an, nur um alles zu vergessen. So hörte ich es doch auch vom Jugendamt her: Vergessen sei das Beste. Ich würde alles, deine Geburt und wie mir geschah, vergessen. Einfach so.
Als ich dann einige Zeit später mit meinem Freund bei meinen Eltern war, wurde das Thema "Adoption" nicht angesprochen. Inzwischen hatte ich wieder Kontakt zu den Eltern und Geschwistern, so, als ob nichts geschehen wäre.
Drei Jahre später wurde meine zweite Tochter geboren, am 21. Januar 1977. Nach weiteren drei Jahren kam das dritte Mädchen zur Welt, am 21. August 1980. Die Zahl 21 kam mir so bekannt vor. Habe ich nun drei oder zwei Kinder?
Den Geburtstag von dir habe ich nie vergessen. Irgendwie versuchte ich, den Tag schön zu machen, mit Kerzenlicht, Kaffeetrinken nur für mich allein. Ich fand noch immer keinen Menschen, mit dem ich einmal über die Weggabe von dir hätte sprechen können, und darüber, dass ich drei Kinder habe und nicht zwei.
Mein Freund und ich haben dann später geheiratet. Die beiden letzten Mädchen sind von ihm. Sie wurden größer. Es waren sieben oder acht Jahre vergangen, seit du geboren warst. Da entdeckte ich zufällig den Brief vom 21. September 1974 wieder. Dieses Datum war mir doch so bekannt!
Am Tag darauf stand ich in einem Bücherladen und fragte nach einem Buch über das Thema "Adoption". Ich kaufte mir das Buch "Ich habe mein Kind fortgegeben" von Christine Swientek. Darin erkannte ich mich wieder. Ich war nicht mehr allein. Vielen ging es so wie mir. Nach so vielen Jahren kamen die Erinnerungen an dich wieder. Und diese Erinnerungen wurden deutlicher. Ich spürte, dass ich beim Jugendamt noch etwas zu erledigen hatte und dass so vieles gar nicht besprochen worden war. Ich musste zum Jugendamt, um nachzufragen, wie es dir geht. Ich wollte dieses Mal kämpfen, um etwas von dir zu erfahren. Auch spürte ich, dass es sehr wichtig für mich war.
Es war 1982, als ich mit dem Jugendamt wieder Kontakt aufnahm. Da warst du acht Jahre alt, Jane. Die Wege zum Jugendamt kosteten mich sehr viel Kraft. Immer wieder kam das Bild in mir hoch, dass ich vom Jugendamt einfach nur gebraucht worden war, um für Adoptiveltern ein Kind zu beschaffen. Im Jugendamt saß noch immer dieselbe Frau, die mit mir damals über die Adoption gesprochen hatte. Inzwischen etwas älter geworden, konnte sie aber immer noch so herrlich reden. Es war genauso wie damals. Aber ich war etwas stärker geworden. Ich fragte nach Fotos und nach dir, meine Tochter. Ich wollte wissen, wie es dir geht, wie du aussiehst.
Auch kaufte ich mir noch mehr Bücher über das Thema "Adoption". Und dann habe ich von der Gruppe "Rabenmütter" durch eine Radiosendung erfahren. Zufällig hörte ich von diesen Frauen, die wie ich mit der Adoption nicht fertig wurden. Ich gab nicht eher Ruhe, bis man mir eine Kontaktadresse vermittelte.
In der Gruppe trafen sich Frauen, die ihre Kinder zur Adoption weggegeben haben. Sie hatten genau dieselben Probleme wie ich. Auch diese Frauen wurden allein gelassen mit allem. Das erste Mal konnte ich dort über dich, meine Tochter, sprechen. Ich hörte den anderen Frauen zu, was diese mit dem Jugendamt, mit Freunden und mit der Familie erlebt hatten, wenn das Thema "Adoption" angesprochen wurde. Auch diese Frauen konnten ihre Kinder nie vergessen. Sie waren aber schon so weit, dass sie darüber sprechen konnten.
Durch diese Gruppe lernte ich eine Freundin kennen. Sie hat einen inzwischen 15-jährigen Sohn, den sie zur Adoption freigegeben hatte. Durch sie erfuhr ich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, selbst in Kleinigkeiten. Schon unsere Mütter waren in ihrer Mädchenzeit in derselben Stadt als Krankenschwestern tätig gewesen.
Seit ich diese Gruppe kenne, bin ich viel sicherer geworden. Freunden und Bekannten kann ich jetzt auch erzählen, dass ich noch ein Kind habe, es aber nicht bei mir lebt. Meine Tochter sei da, sie nehme an meinem Leben teil, auch wenn sie nicht bei mir wohne, erzähle ich ihnen. "Ich habe drei Kinder", dies zu sagen, hatte ich all die Jahre zuvor nie gewagt.
Jahrelang hatte ich immer wieder unter Migräne gelitten. Ich hatte mir schon Gedanken darüber gemacht, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, diese Kopfschmerzen zu beseitigen, ohne irgendwelche Medikamente einzunehmen. Und geweint hatte ich auch schon lange nicht mehr, ich hatte es nicht zugelassen. Seit ich über die ganze Adoptionssache sprechen konnte, wurden die Migräneanfälle seltener. Das war der Anfang, aus diesem ganzen "Adoptionsspiel" herauszukommen.
Ich begann, immer mehr Gemeinsamkeiten mit meiner Freundin zu entdecken. Es war einfach schön. So konnten wir es viel leichter ertragen, wenn wir über unsere großen Kinder sprachen und uns Gedanken über sie machten. Ich merkte auch, wo ich den eigentlichen seelischen Schmerz hatte: Mich hatte nie jemand danach gefragt, wie es mir während der ganzen Schwangerschaft ergangen war, nicht einmal meine eigene Mutter. Und das tat auch nach so vielen Jahren noch verdammt weh.
Allmählich begann ich, an mir zu arbeiten. Ich ließ mir Artikel von Zeitungen schicken, die das Thema "Adoption" beschrieben. Ich gab in der Zeitschrift "Eltern" eine Annonce auf, um noch weitere Frauen zu finden, deren Kinder ebenfalls bei Adoptiveltern lebten. Ich habe mich ganz schön gewundert, wie viele Zuschriften ich bekam. Durch diese Annonce habe ich drei Frauen intensiv kennen gelernt. Wir schreiben uns seither. Es hilft sehr viel, anderen bei ähnlichen Problemen zu unterstützen und sie gemeinsam durchzustehen. Denn es ist ein langer Weg, mit viel Trauer und Schmerz verbunden. Man lernt auch, dem Anderen zuzuhören. Man ist nicht allein, und das ist das Schönste dabei.
Im Jahr 1984 hatte ich einen Unfall, der mich total aus meinen Plänen riss. Ich musste in ein Krankenhaus, wo ich operiert wurde. Dies geschah genau zehn Jahre nach deiner Adoption, Jane. Nach diesem Unfall folgten noch zwei weitere. Der eine 11 Jahre, der andere 13 Jahre nach deiner Weggabe. In dieser Zeit begann ich auch zu überlegen, wie ich weiter an mir arbeiten kann, um dieses ganze Geschehen doch noch zu verarbeiten. Nach mehreren Anläufen begann ich eine Gesprächstherapie. Endlich fand ich eine Therapeutin, bei der ich die ganze Adoptionssache klären konnte. Ich entdeckte, dass ich mich eigentlich gar nicht von dir verabschiedet hatte. Du wurdest mir so einfach weggenommen. Diese Trauer und diesen Schmerz hatte ich gar nicht verarbeitet. Irgendwo hatte ich dies alles versteckt und holte es so langsam durch meine Gespräche mit der Therapeutin wieder hervor. Ich lernte auch, wieder zu weinen. Ich ließ es bei mir wieder zu, und das war sehr wichtig. Auch schrieb ich meine ganzen Gedanken auf, die dich betrafen, Jane. So hatte ich, habe ich, doch irgendwie eine unsichtbare Verbindung zu dir.
Unzählige Briefe schrieb ich an das Jugendamt. Viele Gespräche habe ich geführt. Ich bat um ein Bild von dir. Nach den immer wiederkehrenden Kämpfen zwischen mir und dem Jugendamt, den vielen aussichtslos scheinenden Gesprächen, fand ich eines Tages zufällig einen Glückspfennig und dachte, dass ich noch einmal zum Jugendamt hingehen sollte. Die Sachbearbeiterin hatte mich schon irgendwie erwartet. Sie sagte, dass sie einen Brief bekommen hätte und - ein Babybild, ein Bild von dir, Jane! Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich hielt dieses Foto fest in der Hand, so, als ob es mir gleich wieder weggenommen würde. Ich trug dieses Bild den ganzen Tag bei mir. Am Abend sprach ich noch mit einer Frau, die wie eine Mutter für mich ist, über das Bild von dir und über dich, Jane. Dieser Frau hatte ich nie zuvor von dir erzählt. Sie wusste gar nichts von der Adoption. Dort konnte ich auch nach langer Zeit wieder einmal so richtig weinen. Es tat so gut. Es kam vieles hervor. All die Jahre hatte sich so vieles an Trauer und Schmerz angesammelt, was jetzt einfach herauskam. In mir wurde es leichter. Ich hatte nicht mehr diesen Kloß im Hals.
Die Nacht über lag dein Bild unter meinem Kopfkissen. Dieses Bild musste ich nun immer wieder anschauen. Christine Swientek, Anita aus der Gruppe "Rabenmütter" und Margit, die ich durch eine Zeitungsannonce kennen gelernt hatte, rief ich gleich an und teilte ihnen mit, dass ich ein Bild von dir bekommen hatte. Sie freuten sich alle mit mir. Es war ein wunderschöner Tag, an den ich oft denke, wenn ich mir dein Bild ansehe, Jane.
Einige Zeit später habe ich ein Gespräch mit der Sachbearbeiterin vom Jugendamt und der Therapeutin geführt. Da kam zum Vorschein, dass ich das Recht gehabt hatte, dich nach der Geburt zu sehen und zu behalten und zu besuchen. Du hättest noch acht Wochen in einem Säuglingsheim gelegen. Wie hätte ich da hinkommen können, in meiner schlechten körperlichen und seelischen Verfassung? Man hatte mir doch schon alles weggenommen. Die Schwestern im Krankenhaus hatten damals vom Jugendamt die Aufforderung bekommen, keine Gespräche mit mir über mein Kind und über die Möglichkeit zu führen, es doch zu behalten. Hätte ich damals jemanden gehabt, der mir geholfen hätte, sei es auch nur durch ein Gespräch, wärst du heute hier bei mir. Über meine Rechte als Frau und Mutter hatte man mit mir nicht gesprochen. Ich war ganz einfach beiseite geschoben worden, was ja in dem "Adoptionsspiel" sehr leicht und billig ist. Hauptsache das Kind war da... Dies alles klingt wie ein Echo in meinen Ohren.
Im November 1986 hatte meine Freundin ihr viertes Kind bekommen. Da dachte ich, dass es ganz gut wäre, auch mit meinen Kindern über ihre große Schwester zu sprechen. Es war für mich eine gute Möglichkeit, ein solches Gespräch anzufangen. Am nächsten Morgen, wir saßen am Frühstückstisch, begann ich zu erzählen, dass ich drei Kinder hätte, drei Mädchen, so wie ich es mir immer gewünscht hatte. Ich zeigte ihnen das Babybild von dir und begann zu erzählen.
Die Frage, wo denn ihre große Schwester sei, kann ich ihnen auch heute noch nicht beantworten. Ich weiß aber und habe eigentlich ein gutes Gefühl dabei, dass du, meine Tochter, irgendwann einmal Interesse an mir haben und dich dann melden wirst. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber wir haben die Hoffnung, dass du uns, deine Geschwister, deinen Vater und auch mich kennen lernen möchtest.
Dein Bild habe ich in einen Bilderrahmen getan. Es steht hier auf meinem Schreibtisch, so sind alle drei Mädchen auf Bildern zusammen. Ich gehe damit auch sorgsam um. So kann ich wenigstens mit dir sprechen, dir in die Augen sehen. Es ist so wichtig für mich. Noch heute ist der Wunsch nach einem Bild da, wie du heute aussehen magst. Immer wieder tauchen Fragen auf: Siehst du deinen Geschwistern ähnlich? Wie siehst du heute aus, als junges, fast 16-jähriges Mädchen? Manchmal habe ich das Gefühl, als wenn ich dich, Jane, ganz genau kenne. Aber nur manchmal.
Immer wieder setze ich mich auch heute, nach so vielen Jahren, mit deiner Weggabe auseinander. Immer wieder spüre ich Schmerz und Trauer. Aber ich kann damit viel besser umgehen, auch meinen Körper und mich viel besser verstehen. Ich stelle weiter Fragen an das Jugendamt, möchte ganz einfach wissen, wie es dir geht. Ich habe dich geboren, diesen wunderschönen Menschen. Und irgendwie bin ich da auch mit drin. Vielleicht treffen wir uns irgendwo. Irgendwann. Irgendwie. Als "Jane und Ich", "du und Deine", "Kleine und Große", "in Freundschaft".
Ich habe heute das Gefühl, mit meinen Problemen nicht alleine dazustehen. Ich habe wunderbare Menschen kennen gelernt, von denen ich so manchen Rat und Hilfe bekommen habe. Und ich kann an andere Frauen, die noch nicht so weit sind, Hilfe und Rat weitergeben. Mir ist wichtig, dass ich über die Adoption spreche. Ich bin auch immer wieder froh, wenn ein neues Buch zu dem Thema "Adoption" erscheint, denn es gibt mir Kraft und Mut.
Seit gut einem Jahr arbeite ich bei einer Familie im Haushalt. Diese Familie hat ein Kind, einen kleinen Jungen, adoptiert. Daniel ist fünf Jahre alt, zehn Jahre jünger als du, Jane. Die Arbeit dort ist wie eine seelische Heilung für mich. Ich kann an dem Leben des kleinen David mit teilhaben - ein kleiner Ersatz für all das, was ich bei dir, Jane, vermisst habe. Ich mag diesen kleinen Jungen sehr, und wir beziehen ihn in unsere Gespräche mit ein, so als würde er ein Stück dazugehören. Es ist sehr schön, so etwas erleben zu dürfen.
Du, mein Kind. Obwohl du nicht bei mir bist, lebst du doch irgendwie bei mir. Manchmal bist du weiter weg, manchmal bist du ganz nah. Das ist ein schönes Gefühl. Wenn ich auf meiner Flöte spiele, Musik mache, bist du mir nahe. Manchmal fühle ich auch Traurigkeit, ich habe seelische Schmerzen. Ich leide und trauere um dich, weil ich dich nicht anfassen und berühren kann. Wie siehst du aus? Wie kleidest du dich? Was hast du für Interessen? Stellst du Fragen zur Adoption? Stellst du Fragen nach deiner leiblichen Mutter, nach deinen Geschwistern, deinem Vater? Wie kommst du so zurecht? Auch ich mache mir Gedanken. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob es dir genauso geht wie mir. Ich möchte dich gern kennen lernen und mit dir über das ganze Geschehen reden. Ob wir uns beide verstehen würden? Würden wir unsere Gemeinsamkeiten erkennen und entdecken? Ich liebe dich, Jane, wo immer du auch bist. Liebe ist unendlich weit. Die Verbindung zu dir kann keiner zerstören.
Aus dem Leben einer Adoptivtochter
Katrin Stoike
Auf die Frage, seit wann ich denn wisse, dass ich adoptiert bin, antworte ich: "Seit ich denken kann", oder mit "schon immer."
Ich kam im Alter von drei Monaten als erstes Kind in meine Adoptivfamilie. Und schon als kleines Mädchen wusste ich, dass es zwei Arten von Familien gibt: Bei der einen kommen die Kinder aus dem Bauch der Mutter, bei der anderen werden die Kinder im Krankenhaus ausgesucht und mitgenommen, da sich deren Mütter nicht um ihre Kinder kümmern können. Zu letzteren gehörten auch mein Bruder und ich.
Warum sich die Mütter nicht um ihre Kinder kümmern konnten, verstand ich zwar nicht so recht, aber ich spürte auch, dass es nicht gut ist, zu viel nachzufragen. Im Vordergrund stand ja auch zunächst das "Ausgesucht-" und somit "Willkommen-Sein" in der Familie.
In meiner Kindheit waren wir auch öfters auf Adoptivelterntreffen, was für meinen Bruder und mich aber immer eher ein Kurzurlaub war. Wir empfanden das Ganze als ein lustiges Spielwochenende mit vielen anderen Kindern - auch wenn die Erwachsenen manchmal sehr ernst und betroffen aussahen.
Ansonsten beschäftigte mich das Thema "Adoption" als Kind und Jugendliche nicht so besonders. Die Tatsache, dass ich adoptiert war, vertraute ich meinen Freundinnen zwar an, doch bis auf zwei Ausnahmen waren ihre Reaktionen eher "neutral" und sind mir deshalb wohl nicht im Gedächtnis geblieben.
Das erste Erlebnis war noch in der Grundschulzeit: Eine Klassenkameradin stellte mir häufig Fragen wie "Seit wann weißt du, dass du gar nicht das richtige Kind deiner Eltern bist?" oder: "Weiß dein Bruder auch schon, dass Ihr nur angenommen seid?" Ich erinnere mich, dass mich diese Fragen verletzten, und dass ich auch nicht wusste, was das sollte. Was weiter war, ist mir nicht in Erinnerung geblieben.
Die zweite ungewöhnliche Reaktion war die einer Klassenkameradin in der Mittelstufe, welche mich immer wieder um mein "Adoptiert-Sein" beneidete. Sie betonte, dass ich somit sicher sein könne, dass meine Eltern sich und mich liebten und nicht nur meinetwegen geheiratet hätten (wenn die Begriffe Mutter/Vater/Eltern nicht näher erläutert sind, meine ich meine Adoptiveltern). Fremd war mir bei beiden Klassenkameradinnen, dass sie immer wieder auf ein Thema zu sprechen kamen, das mir längst nicht so wichtig war und über das ich einfach nicht ständig reden wollte.
Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema "Adoption" begann für mich erst 1984, als meine Familie an einer Studie des Diakonischen Werkes Bayern über den "Adoptionserfolg" teilnahm (Knoll/Rehn 1984/85). Nach Auswertung der Studie erhielten wir Adoptivkinder die Möglichkeit, an einem Wochenende teilzunehmen, an welchem wir uns über unseren Status als Adoptierte, die Ergebnisse der Studie und andere Themen austauschen konnten. Bei diesem Treffen ging es thematisch vor allem um erlebte Diskriminierung sowie um den Wunsch, mehr beziehungsweise überhaupt etwas über die leiblichen Eltern zu erfahren.
Durch diese Diskussionen angeregt, wurde auch bei mir die Hoffnung größer, mehr über meine Herkunft herausfinden zu können. Schließlich überwog diese Hoffnung die Angst vor dem Ungewissen. Angst hatte ich zum einen davor, dass meine leibliche Mutter sich ein Leben aufgebaut haben könnte, in dem sie die Erinnerung an meine Existenz so vollständig verleugnet, dass sie mich quasi zum zweiten Mal "verstößt". Zudem hatte ich irgendwann einmal aufgeschnappt, dass in meiner Kindheit Bluttests zur Vaterschaftsfeststellung gemacht worden waren. In meiner Phantasie wurde meine leibliche Mutter dadurch zu einer Frau, die so viele Männerbeziehungen hatte, dass sie sich nicht genau an meinen Erzeuger erinnern konnte. Daraus zog ich den "logischen" Schluss, dass sie auch kein Interesse an mir habe. Auf die nahe liegende Möglichkeit, dass nämlich mein Erzeuger die Vaterschaft bestritt (was zudem der Realität entsprach), kam ich zunächst nicht. Auch mochte ich meine Eltern nicht weiter nach meiner leiblichen Mutter fragen, denn bei aller Offenheit hatte ich doch das Gefühl, dass es ihnen weh täte, wenn ich zu viel nach meiner Herkunft frage. Und sie zu verletzen oder gar undankbar zu scheinen, war die Sache nicht wert.
Trotz all dieser Bedenken nahm ich Kontakt zu der Psychologin auf, die ich auf dem Adoptivkindertreffen im März 1985 kennen gelernt hatte. Mit ihrer Unterstützung begab ich mich auf die Suche nach meiner leiblichen Mutter.
Ich wurde des Öfteren gefragt, warum ich denn "nur" meine leibliche Mutter und nicht auch meinen Erzeuger gesucht habe. Schon die Wortwahl macht meiner Ansicht nach seine Bedeutung für mich ziemlich klar. Seine "Unterstützung" bei dem Ganzen bestand im Wesentlichen darin, meiner leiblichen Mutter zur Abtreibung zu raten, und, als dies nicht "klappte", die Vaterschaft zu bestreiten - alles in allem kein Mensch, den ich gerne kennen lernen mochte. Zudem dachte ich, dass - wenn überhaupt - nur zu "ihr" eine Art von Kontakt oder Verbindung da sei, schon alleine wegen der Schwangerschaft, Geburt und ersten drei Lebensmonate. Nicht zuletzt spielten in meinem Leben, angefangen mit meiner Mutter, die sich hauptsächlich um uns Kinder kümmerte, Frauen sowieso eine sehr viel größere Rolle als Männer. Dieses sind wohl die Hauptgründe, warum ich mich bei der Erforschung meiner Vergangenheit auf meine leibliche Mutter konzentriert habe.
Der eigentlichen Suche gingen noch einige Gespräche mit der oben genannten Psychologin vom Diakonischen Werk voraus. Teils zu zweit, teils zu dritt mit meiner Mutter, versuchten wir, uns über Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen und Ängste etwas klarer zu werden. Im Verlauf dieser Gespräche wurde ich mir immer sicherer, "sie" kennen lernen zu wollen. Auch wurde es mir dadurch möglich, dies ohne schlechtes Gewissen beziehungsweise ohne das Gefühl, meine Eltern zu verraten, zu tun.
Nach kurzer Zeit erhielt ich einen Anruf von der Psychologin, bei dem sie mir erzählte, dass ihr Telefonat mit meiner leiblichen Mutter sehr positiv verlaufen sei. Diese habe sich sehr darüber gefreut, von mir zu hören, und sei auch an einem Kontakt mit mir interessiert.
Darauf folgte eine sehr aufregende Zeit, in der meine leibliche Mutter und ich viele Briefe und Fotos austauschten, mit dem Bestreben, "alles" oder doch zumindest möglichst viel von der anderen kennen zu lernen. Spontan hatten wir beide das Gefühl, die andere schon zu kennen und ihr vertraut zu sein.
Diese Wahrnehmung änderte sich jedoch bei mir schlagartig, als wir uns zum ersten Mal trafen. Nach der anfänglichen Euphorie kam für mich schnell die Ent-Täuschung (was ich aber durchaus nicht nur negativ meine). Ich empfand uns in fast allen Lebensbereichen als grundverschieden, und je mehr sie unsere Ähnlichkeit betonte, desto mehr Abstand zu ihr brauchte ich.
Heute denke ich, dass ich Angst hatte, als "wieder gefundene Tochter" von ihr vereinnahmt und verschluckt zu werden. Aus diesem Grund konnte und wollte ich absolut keine Ähnlichkeit zwischen uns sehen. Auch entspricht die Sichtweise von "genetischer Determination" in keinster Weise meinem Menschenbild.
Nun, wo ich etwas mehr Abstand gewonnen habe, sind die Fragen nach Ähnlichkeiten, Unterschieden, Anlagen, Umwelt usw. für meine Situation weniger wichtig geworden. Es geht mir "einfach" darum, zu meiner leiblichen Mutter eine Art von freundschaftlichem Kontakt zu haben, bei dem jede von uns beiden als sie selbst gesehen wird und nicht die eigenen Erwartungen an sie im Vordergrund stehen.
Meine Eltern haben sich in der Zeit der Kontaktaufnahme kooperativ verhalten beziehungsweise mir mehr Unterstützung angeboten, als ich eigentlich wollte. So hatte ich das Gefühl, dass diese Suche "mein Weg" sei, und sie damit nicht zu viel zu tun haben sollten. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass meine Mutter der ganzen Sache positiver und weniger ängstlich gegenüber stand. Sie hatte es da sicher auch leichter, da sie sich unserer "Verbindung" sicherer sein konnte als mein Vater - dadurch, dass sie schlicht immer mehr "da" war als er.
Inzwischen haben sowohl meine Eltern als auch mein Bruder unabhängig von mir einen lockeren Kontakt zu meiner leiblichen Mutter. Somit ist sie langsam zu einer Bekannten der ganzen Familie geworden - und keine "Bedrohung" mehr für eine/n von uns.
Durch das Aufschreiben meiner Geschichte habe ich mich in den letzten Wochen wieder sehr viel mehr mit meiner Adoption und deren Bedeutung für mein Leben auseinander gesetzt, als ich es ansonsten tue. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich nicht den Eindruck habe, unter besonderen "adoptionsspezifischen Problemen" zu leiden. Manchmal denke ich zwar, dass meine Familie länger als üblich für "perfekt" hielt, denn dadurch, dass wir als Kinder so erwünscht waren, musste ja alles stimmen, mussten wir einfach glücklich sein. Konflikte zu sehen und zu benennen, hätte diese "heile Welt" natürlich gefährlich ins Schwanken gebracht. Auch vermute ich, dass ich manchmal - mehr als andere - das Gefühl habe, mich wie von meinem Gegenüber gewünscht verhalten zu müssen, damit ich bleiben darf beziehungsweise nicht "ins Heim muss". Auch wenn Letzteres keine Drohung war, an die ich mich direkt erinnere, ist mir diese Angst sehr vertraut.
Letztlich denke ich aber, dass diese Art von Harmoniestreben (welches sich meiner Ansicht nach in beiden Beispielen ausdrückt) in dieser Gesellschaft eher für Frauen als für Adoptivkinder typisch ist. Ich vermute, dass "Ältestes-Kind-" und "Tochter-Sein" mich viel mehr geprägt haben als das "Adoptiert-Sein". Für diese Auffassung spricht auch, dass viele meiner Freundinnen, gerade diejenigen, die auch nur/noch Brüder haben, von ähnlichen Schwierigkeiten in ihrer Familie berichten, wie ich sie kenne. Insofern ist meine Adoption ein Teil meiner Biographie, der einmal mehr und einmal weniger Aktualität besitzt. Für meine Identität empfinde ich jedoch andere Dinge als wesentlich entscheidender.
Ungewollt - unerwünscht. Geschichte einer gescheiterten Adoption
Leen Martens
Eva und ich haben drei Adoptivkinder: Die beiden jüngeren betrachten uns als ihre Eltern, und das stimmt uns zufrieden. Das älteste, nun 18 Jahre alt, ein Mädchen aus Indonesien, sieht uns hingegen gar nicht als ihre Eltern an. In ihren Augen verkörpern wir alles, was sie verabscheut. Sie verschwand plötzlich aus unserem Leben, als sie 14 Jahre alt war, an einem Samstagmorgen um 10.30 Uhr. Wir haben sie noch ein paar Mal wieder gesehen, beim "RIAGG" (Regionales Institut für Ambulante Psychiatrie), in einem Kinderheim, auch bei uns zu Hause. Zum letzten Mal habe ich sie vor zwei Jahren getroffen. Sie machte einen Einkaufsbummel in der Stadt, wo wir wohnen. Sie sah mich auch. Wir erschraken beide. Ich lehnte mich kurz gegen eine Mauer, um mich vom Schreck zu erholen. Sie drehte sich um und verschwand wieder aus meinem Leben, als ob sie niemals einen Platz darin gehabt hätte.
Wir wissen nicht, wo sie ist, was sie macht, ob sie Freunde hat, ob sie mit jemandem zusammenlebt, ob sie studiert, arbeitet oder von der Fürsorge lebt. Wir fragen uns, ob sie allmählich mit sich selbst und mit ihrem Leben ins Reine kommt, ob sie immer noch wie verzweifelt um sich schlägt, alle beschuldigt und beschimpft. Wir wissen nichts mehr von dem Kind, das wir unser Kind nannten. Und eigentlich wollen wir es auch nicht mehr wissen. Vier Jahre lang haben wir darum gekämpft, sie weiterhin unser Kind nennen zu dürfen. Diesen Kampf haben wir verloren.
Jetzt ist es an der Zeit, uns wieder miteinander und mit den anderen beiden Kindern zu befassen. Wir trauen uns wieder, uns mit der 15-jährigen Iris zu streiten, die nach unserer Meinung zu oft ausgehen will und zu spät nach Hause kommt. Den 13-jährigen Juan weisen wir zu seinem Ärger darauf hin, dass wir die Schule wichtiger finden als Fußball und Computer.
So kommen wir uns wieder wie normale Eltern normaler Kinder mit normalen Problemen vor. Aber dann bringt ein Brief oder ein Telefonanruf vom Jugendrichter oder vom Jugendamt bezüglich unserer verschwundenen ältesten Adoptivtochter wieder alles durcheinander und alles fängt wieder von vorne an. Eva reagiert wütend und illusionslos, mir selbst bricht der Schweiß aus, und ich bekomme Herzklopfen. Eva und ich fragen uns oft, ob wir das alles tatsächlich erlebt haben. Und ebenso viele Male müssen wir feststellen, dass wir tatsächlich ein Kind verloren haben.
1. Unsere Familie
Wir stammen beide aus Rotterdam, aus soliden katholischen Familien. Nach dem Abitur trat Eva eine Stelle bei einer Werbeagentur an. Ich habe noch vier Jahre die Fachhochschule für Sozialarbeit besucht. Im Jahr 1968 heirateten wir. Eva war damals 21, ich 23 Jahre alt. Wir kannten uns seit vier Jahren. Eva war klein und beherzt. Ich betrachtete mich selbst als einen "verspäteten Heranwachsenden", ängstlich und unsicher. Wir siedelten in eine Stadt im Herzen der Niederlande über, wo eine Wohnung und Arbeit vorhanden waren.
Nach einem Jahr erfuhr Eva vom Gynäkologen, dass ihre Eileiter nicht durchlässig genug waren. Sie wurde einige Male operiert. Um Kinder bekommen zu können, sollten noch einige Eingriffe vorgenommen werden. Wir beschlossen, das nicht machen zu lassen. Eva fand es erniedrigend, ihren Körper durch allerlei ärztliche und andere Eingriffe "gebärfähig" machen zu lassen. Außerdem hörten wir in dieser Zeit (1970) von der Möglichkeit einer Adoption. Wir kamen zu dem Schluss, dass es verantwortungslos sei, jahrelang an medizinischen Experimenten mitzuwirken, in der Hoffnung, dadurch ein Kind bekommen zu können, während anderswo auf der Welt Kinder in kümmerlichen Verhältnissen leben, die uns als Eltern gut gebrauchen könnten.
Im Laufe des Jahres 1973 kamen wir mit einer Frau aus Surabaja in Kontakt, die sich um verlassene Kinder kümmerte. Wir wollten eines dieser Kinder adoptieren. Nach einer einfachen Familienuntersuchung durch einen Mitarbeiter des Jugendamtes bekamen wir eine Pflegeerlaubnis. So reiste ich 1974 ohne Eva nach Indonesien, weil eine Reise zu zweit zu teuer gewesen wäre. In Surabaja begegnete ich in einem Heim unserem ersten Adoptivkind: Brigitta, die fast zwei Jahre alt war. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Zweifel über die Adoption und meine Vaterrolle schnell vergaß, weil die Verhältnisse für die Heimkinder so erbärmlich und hoffnungslos waren und mir jede Alternative besser vorkam.
Wir nahmen unsere elterlichen Aufgaben begeistert in Angriff. Brigitta war ein wunderschönes, dunkles, schmächtiges Mädchen. Wir waren stolz, dass wir ihre Eltern sein durften. Es war nicht schwer, dieses Kind zu lieben. Wir glaubten, dass wir eine harmonische Adoptivfamilie werden könnten.
In Mai 1976 adoptierten wir durch Vermittlung des Büro für internationale Adoption in Den Haag ein vier Monate altes Mädchen aus Korea, das wir Iris nannten. Unsere Familie zählte nun zwei Töchter und wir waren überglücklich.
Fünf Jahre später kam Juan dazu, ein dreijähriger Junge aus Kolumbien. Wir entschieden uns für Juan, weil er als älterer und farbiger Junge in die Kategorie schwer vermittelbarer Kinder gehörte. Wir waren der Meinung, dass wir dieser Aufgabe gewachsen waren.
Unsere Kinder haben den eigenen Namen behalten, obwohl der Name von Iris wegen der Aussprache etwas geändert worden musste. Ich war inzwischen Leiter des Sozialamtes geworden. Eva hat ihre Stelle immer behalten können, aber sie arbeitet weniger als früher.
2. Schwierige Zeiten
Brigitta war für unerfahrene Eltern wie uns am Anfang ein problemloses Kind. Wenn man sie irgendwo hinsetzte, blieb sie dort einfach sitzen, manchmal bis zu einer Stunde. Sie rührte niemals etwas an, und wir brauchten ihr nur selten etwas zu verbieten. Es war, als ob man sie in Indonesien bereits zu einem Musterkind gemacht hatte. Brigitta war introvertiert. Sie spielte am liebsten allein, liebte es, mit allerlei Materialien zu bauen, zu basteln und zu phantasieren. Damit beschäftigte sie sich lange und konzentriert. Es fiel auf, dass sie das Spielzeug oft nicht auf die übliche Weise benutzte: Sie wollte eine Karte eines Gesellschaftsspiels aufessen, das Puppenhausdach wurde zur Brücke, das Puppenhaus selbst zur Abstellkammer. Eva und ich fanden das merkwürdig, aber wir meinten auch, dass Brigitta das Recht hatte, die eigenen Phantasien zu verwirklichen.
Bereits vom dritten Lebensjahr an zog Brigitta sich in ihr Zimmer zurück, um sich dort mit ihren Spielsachen zu befassen. Eva sagte oft, dass das häufige Alleinsein nicht gut sei, aber ich fand, dass Brigitta das selbst entscheiden musste. Schon früh beherrschte Brigitta Fertigkeiten, für die Iris und Juan, wie sich später herausstellen sollte, in dem Alter noch nicht reif waren. Sie hatte vor nichts Angst, und es ging niemals etwas schief.
Jedoch weinte Brigitta schnell, gern und lang. Wir wussten nicht, was die Ursache dieses unergründlichen Weinens war. Wir dämpften sie nicht, weil wir das Gefühl hatten, dass sie etwas kompensieren oder nachholen wollte. Sie aß gern und, wenn möglich, auch viel. Dabei ließen wir ihr nicht freie Hand. Sie hatte eine starke Neigung zur Korpulenz entwickelt, und wenn wir sie gewähren ließen, nahm sie beträchtlich zu. Brigitta konnte nicht gut mit anderen Kindern spielen. Nur wenn sie ihren Willen durchsetzen konnte, ging alles gut. Wenn sie nicht das Regiment führen durfte, wurde sie barsch und manchmal handgreiflich. Als Iris und Juan älter wurden und auch die Führung übernehmen wollten, kam es zu heftigen Streitereien. Brigitta wurde dann wütend und traurig. Wir begriffen das gut, weil sie das Spiel sehr gut zu organisieren wusste, jedenfalls besser als die anderen. Brigittas Abneigung gegen Hätscheln löste bei Eva manchmal Irritationen aus, weil sie sich abgewiesen fühlte. Brigitta hat uns später anvertraut, dass sie am liebsten Einzelkind geblieben wäre, und es dann vielleicht nicht schief gegangen wäre.
Als Brigitta in die dritte Klasse ging, bekam sie zum ersten Mal ihre Periode. Wir betreuten sie so gut wie möglich, aber wir machten uns auch Sorgen, weil wir nicht herausfinden konnten, welchen Einfluss dies auf ein so junges Kind hatte. Sie wirkte - auf jeden Fall ab dem zehnten Lebensjahr - viel älter, als sie in Wirklichkeit war.
Große Sorgen machten wir uns wegen ihres Stehlens. Als sie vier war, fing sie damit an. Sie nahm Süßigkeiten aus einem Laden mit. Wir regten uns nicht darüber auf, weil wir glaubten, dass es vorübergehen würde. Dem war aber nicht so. Sie hat es immer wieder gemacht. Meistens ging es um Geld - als sie die Hauptschule besuchte, sogar um größere Beträge. Als sie noch in die Grundschule ging, kaufte sie Süßigkeiten dafür. Diese verwendete sie als Geschenke, um Freunde zu gewinnen.
Freundinnen hatte Brigitta eigentlich nie. Wenn sie eine fand, dominierte sie derart, dass die Freundschaft schnell zerbrach. Im Grunde genommen war Brigitta ein einsames Kind, das nur andere Kinder in ihrer Nähe duldete, wenn diese ihr die Anerkennung zeigten, nach der sie sich sehnte. Sie spielte allein, studierte allein, beschäftigte sich allein in ihrem Zimmer. Sie schrieb sich selbst und uns oft kurze Briefe, die zeigten, dass sie ein Kind war, das mit sich selbst nicht zufrieden war. Auch forderte sie uns auf, sie zu bestrafen, damit es ihr besser gehen würde. Ferner schrieb sie Phantasiegeschichten, die immer von Mord und Totschlag und blutigen Unfällen handelten.
Wenn wir dahinter kamen, dass Brigitta wieder etwas gestohlen hatte, erschraken wir meistens sehr. Dann versuchten wir, herauszufinden, warum sie es gemacht hatte. Es stellte sich immer wieder heraus, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte, die sie auf diese Weise dann auch reichlich bekam. Wir redeten mit ihr darüber. Dann ging es wieder eine Weile gut, manchmal ein paar Monate oder ein halbes Jahr. Und immer wieder war sie froh, wenn sich die Lage entspannt hatte. Dann strahlten ihre dunklen Augen.
Wir erwarteten, dass Brigitta in der Pubertät lernen würde, mehr an die eigenen Qualitäten zu glauben und hierdurch ihre Mängel leichter akzeptieren könnte, jedenfalls nicht mehr so stark darunter leiden würde. Wir haben damals selbstverständlich erwogen, professionelle Hilfe zu suchen, aber wir hatten in unserer Umgebung zu oft erlebt, dass die Hilfe nichts nützte, und hatten deshalb kein Vertrauen zu Beratern. Hinzu kam noch, dass wir Brigittas dominierendes Verhalten erklären konnten und hofften, dass es vorbeigehen würde.
Im April 1984 lief Brigitta in der Nacht weg. Sie war damals 11 Jahre alt und ging in die vierte Klasse. Wir entdeckten am Morgen, dass ihr Bett leer war. In einem kurzen Brief schrieb sie, dass sie nach Rotterdam fahre, um ihre leibliche Mutter zu suchen. Wir fanden das merkwürdig, weil wir ihr alles, was wir über ihr Leben wussten, gesagt hatten. Sie musste also wissen, dass ihre Mutter nicht in Rotterdam zu finden war. Wir hatten ihr versprochen, dass wir mit ihr nach Indonesien reisen würden, wenn sie 16 Jahre alt war, um ihre Familie dort ausfindig zu machen. Nach 24 Stunden rief uns die Rotterdamer Polizei an, dass wir sie abholen könnten. Wir haben nie begriffen, warum sie damals plötzlich weggegangen ist. Es gab keine anderen Spannungen als die üblichen. Wir kamen gut mit ihr aus. Gewiss, wir machten uns Sorgen, aber welche Eltern tun das nicht? Wir liebten sie sehr. Wir glaubten, dass sie sich als unser Kind betrachtete, und vielleicht war das zu dem Zeitpunkt noch der Fall.
Wir baten das RIAGG an unserem Wohnort um Rat. Dort wurde uns empfohlen, Brigitta weniger streng zu betreuen und uns damit abzufinden, dass unehrliches Verhalten manchmal nicht nachgewiesen werden könne. Wir müssten uns manchmal mit einem "offenen Ende" begnügen. Es blieb bei einem einzigen Gespräch, da man unsere Sorgen übertrieben fand: Brigitta sei dabei, eine spontane, selbständige Heranwachsende zu werden. Eva fühlte sich in ihrer mütterlichen Sorge nicht ernst genommen, war verwirrt und sehr empört. Sie ließ sich aber von mir umstimmen, und gemeinsam unterdrückten wir unsere Unruhe. Unsere frühere Arglosigkeit kehrte aber nicht mehr zurück.
3. Ein verlorener Kampf
Als Brigitta in die Hauptschule ging, herrschte am Anfang eine andere Atmosphäre in der Familie. Sie war fest entschlossen, etwas Gutes daraus zu machen. Es hatte den Anschein, als ob es auch gelingen würde. Sie fand eine Freundin, zufälligerweise auch ein Adoptivkind, die sie sehr mochte. Allmählich wurde Brigitta selbstsicherer. Das machte uns Mut. Sie blickte nicht mehr auf die Zeit der Grundschule zurück - sie wolle von neuem anfangen, wiederholte sie dauernd. Wir wussten natürlich, dass niemand jemals von neuem anfangen kann. Wir legten diese Aussage eher als eine ernst gemeinte Absichtserklärung aus.
In der Schule bekam sie bald sehr gute Noten. Ihre Lehrer waren voll des Lobes. Sie sagten, dass Brigitta mit den Mitschülern gut zurecht käme. Wir fingen an zu glauben, dass sie dabei war, sich selbst zu entdecken und - was wichtiger war - merkte, dass sie stolz auf sich selbst sein konnte. Die Erinnerung an die Aprilnacht, als sie plötzlich nach Rotterdam gefahren war, begann zu schwinden. Manchmal redeten wir noch darüber, meistens in einem ungezwungenen Ton, als ob es etwas wäre, was wir nicht wirklich erlebt hatten. Brigitta wusste nicht genau, warum sie damals geflohen war. Sie glaubte, es wäre dadurch gekommen, dass sie so unehrlich war.
Manchmal nahm Brigitta noch etwas weg. Wir reagierten kaum darauf, wie uns empfohlen worden war. Wir ließen sie wissen, dass wir Bescheid wüssten, aber dass sie selbst mit diesem Charakterzug fertig werden müsse. Eva und ich machten ihr Mut, indem wir sie darauf hinwiesen, dass ihre Entwicklung Fortschritte machte.
Vor allem in der Zeit, als sie die Förderstufe besuchte, las sie viel. In vielen Büchern waren die Hauptpersonen Kinder, die es im Leben schlecht getroffen hatten: Scheidung, Tod, Krebs, Schwangerschaft, Abtreibung... Brigitta fand, dass sie es im Vergleich zu diesen Kindern gut getroffen hätte.
Wir sahen der Zukunft mit immer mehr Vertrauen entgegen. Manchmal passierte aber etwas, was eine vage Unruhe auslöste. Dann hatte Brigitta eine Unterrichtsstunde versäumt, weil sie - draußen in der Sonne - über sich selbst hatte nachdenken müssen. Manchmal holte sie morgens um zehn Uhr bei der Nachbarin den Schlüssel ab, weil sie etwas vergessen hatte. Aber alles in allem war die Stimmung in der Familie gut. Auch außerhalb der Schule und der Familie gab es wenig zu klagen. Brigitta spielte fanatisch Trompete und Basketball und auf beiden Gebieten bekam sie bald einen guten Ruf.
Mit einem Phänomen kamen wir aber nicht zurecht: Brigitta machte jeden Tag etwa vier Stunden Hausaufgaben und am Wochenende erhöhte sie diese Zeit auf zehn Stunden und mehr. Sie sagte, sie müsse gute Noten bekommen. Sie sprach darüber, dass sie später Polizistin oder Anwältin werden wolle und dass man dafür viel lernen müsse. Wir bestritten das nicht, entgegneten aber, dass sie nicht in allen Fächern eine Eins zu schreiben brauche. Jetzt, wo ich auf diese Zeit zurückblicke, bin ich geneigt zu glauben, dass sie durch ihre Lernmanie mannhaft versuchte, eine Menge beunruhigender und bedrohender Gefühle dadurch zu verdrängen, dass sie ihnen etwas Positives gegenüberstellte. Das muss ihr viel Energie gekostet haben. In der Tretmühle der Schule lässt sich so etwas vielleicht noch erreichen, aber als die Schulferien begannen, brauchte sie das Übermaß an Energie nicht mehr. In jenem Sommer machten wir Gebirgswanderungen. Wir glaubten, dass nichts mehr schief gehen kann.
Als sie in die dritte Klasse der Hauptschule ging, wurde klar, dass sie nicht imstande war, noch einmal neue Kräfte aufzutanken. Innerhalb von drei Monaten veränderte sich alles. Wir sahen sie kaum noch. Sie blieb ganze Tage auf ihrem Zimmer, wo sie alles Mögliche machte, nur nicht die Schulaufgaben. Sie schrieb Briefe und führte ein Tagebuch, in dem sie an einer Welt baute, wo sie der Mittelpunkt aller Schrecken stand, die einem Kind zustoßen können. Ihrer Freundin, die sie weiterhin aufsuchen wollte, wies sie fast immer die Tür. Ihre Noten wurden schlechter.
In dieser Zeit entwickelte Brigitta auch eine Schlankheitsmanie: Sie warf Butterbrote weg oder versteckte sie. Wenn Eva oder ich sie zur Rede stellten, begann sie herzzerreißend zu weinen. Sie fing wieder an, Geld zu stehlen. Sie stahl überall, da sie bei Eva und mir nichts fortnehmen konnte, weil man uns empfohlen hatte, alles unter Schloss und Riegel zu halten. Es wurde immer schwieriger, mit Schulterzucken darüber hinwegzugehen, zumal es oft um Beträge von zehn Mark oder mehr ging.
Allmählich zog der Argwohn in unser Haus ein. Wie soll man mit einem Kind leben, das man eigentlich jede Minute im Auge behalten muss? Wir hatten inzwischen Dutzende von Eltern gefragt, aber niemand wusste ein Rezept. Für das Kind war es selbstverständlich auch belastend, immer wieder diese Atmosphäre der Unfreiheit und Beschränkungen spüren müssen.
Im Oktober 1986 nahm Brigitta in der Schule an einer Talentschau teil, wo sie Bruce Springsteen imitierte. Wir konnten nicht dabei sein, aber wir hörten später, dass es ein ziemlicher Reinfall gewesen sei. Sie fand, dass sie sich schrecklich blamiert habe. Ihr ohnehin schon geringes Selbstbewusstsein hat das nicht verkraften können. Von dieser Zeit an war sie mit einer Spannung umgeben, die wir nicht mehr durchbrechen konnten. Sie schminkte sich in immer aggressiveren Farben, kleidete sich ungepflegt in stets denselben Kleidern. Sie äußerte sich manchmal so provozierend, dass es schwer war, nicht darauf zu reagieren.
Eines Tages rief der Hausmeister der Schule an, um zu fragen, warum Brigitta an dem Tag nicht erschienen sei. Da kamen wir zu der Einsicht, dass sie bereits monatelang die Schule schwänzte, einmal einen Tag, ein andermal ein paar Stunden. Sie hatte immer Entschuldigungen abgegeben, wie es sich gehörte. Der Hausmeister war der Annahme, dass wir die Entschuldigungen geschrieben hätten, und hatte uns daher nicht früher angerufen.
Brigitta gab in dieser Zeit so viele Signale, dass wir nicht mehr mithalten konnten. Sie sprach von einem schwarzen Balken im Kopf, der sie verrückt mache. Sie rannte sich buchstäblich den Kopf an der Wand ein. Sie schlug das Handgelenk hart an die Tischkante und hoffte, dass es gebrochen sei. Sie ging morgens immer früher von zu Hause weg. Später hörten wir, dass die Mutter einer Freundin sie frühstücken ließ, weil wir ihr nichts zu essen gäben. Sie erzählte, dass wir ihr keine Kleidung gönnten, sie misshandelten, sie nicht liebten und sie am liebsten von hinten sähen. Wir wussten nichts von all diesen Geschichten und konnten sie deshalb auch nicht widerlegen. Die Atmosphäre in der Familie wurde unerträglich. Es fielen zwar selten harte Worte, aber trotzdem wurden wir jeden Tag nervöser.
An einem Samstagmorgen um halb elf - es war wieder im April - gab Brigitta mir einen Brief, den ich erst lesen dürfe, wenn sie weg sei. Ehe ich mich versah, war sie verschwunden. In dem Brief stand, dass sie zurückkomme, wenn sie stolz auf sich selbst sein könne, damit wir wieder unsere Freude an ihr haben könnten. Ich rief Eva und zusammen mit den beiden anderen Kindern durchsuchten wir die Nachbarschaft. Brigitta war nirgendwo zu sehen. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Ich rief ihre indische Freundin an. Was sie uns dann erzählte, kann ich bis heute noch nicht fassen. Das Mädchen sagte, dass Brigitta weggegangen sei, weil Eva und ich immer Streit miteinander hätten und kurz vor der Scheidung stünden.
Am Nachmittag erfuhren wir, dass die Eltern eines Freundes aus ihrer Klasse Brigitta weggeholt hatten. Am Abend sprachen wir mit diesen Eltern. Sie hatten einen tiefen Groll auf uns und fanden, dass wir "entartete Eltern" seien, die es nicht verdienten, Adoptivkinder zu haben. Brigitta hatte gesagt, dass wir liederliche Alkoholiker seien, die Kinder misshandelten, nur uns selbst wichtig fänden und unsere Kinder vernachlässigten. Wir hätten uns alles selbst zuzuschreiben. An den darauf folgenden Tagen zeigte sich, dass unsere "Untaten" auch anderen bekannt waren. Der Direktor der Schule wollte nicht mit uns sprechen, die Trainerin des Basketballvereins sah in die andere Richtung, als wir ihr begegneten, und die Musiklehrerin unterstellte, dass all diese Geschichten einen wahren Kern haben müssten.
Wir wussten nicht, was wir tun sollten, um unsere Tochter zurückzubekommen. In der Woche nach ihrem Weggang nahmen wir Kontakt zum RIAGG auf, das zu vermitteln versuchte. Brigitta ließ wissen, dass sie uns hasse, dass sie uns nie als Eltern gewählt habe und uns nicht mehr als solche zu haben wünsche. Unsere vertraute Welt brach vor unseren Augen zusammen. Wir versuchten, uns zu verteidigen, indem wir darauf hinwiesen, dass wir gut miteinander ausgekommen seien, dass Brigittas dominierendes Verhalten zwar viele Probleme ausgelöst habe, wir aber gehofft hätten, diese überwinden zu können.
Nach zwei Wochen wollte Brigitta plötzlich wieder nach Hause. Wir waren erleichtert. Wir verstanden nicht, was diese Wendung verursacht hatte, aber wir waren bereit, das Beste daraus zu machen. Aber schon bald merkten wir, dass es um unsere Tochter schlecht bestellt war. Wir erkannten sie kaum wieder: Sie weinte den ganzen Tag, konnte nur schlafen, wenn sie einen Walkman aufhatte und laute Popmusik hörte. Sie sagte, dass sie verrückt sei oder Selbstmord begehen würde. Wir versuchten, ihr zu helfen. Wir machten Pläne für eine andere Einrichtung ihres Zimmers. Ich sprach mit ihr über eine Schularbeit. Ab und zu weinten wir mit ihr.
Nach drei Tagen ging Brigitta wieder fort. Ich wusste, dass sie nicht mehr zurückkehren würde. Und ich war davon überzeugt, dass ich sie nicht daran hindern konnte. Sie zog wieder zu den Menschen, die sie bei uns weggeholt hatten. Der Jugendpsychiater sorgte dafür, dass sie nach einigen Tagen in eine Krisen-Pflegefamilie platziert wurde, die etwa 20 Kilometer von unserem Wohnort entfernt lebt.
Von dem Zeitpunkt an lief alles über getrennte Kanäle. Wir sahen sie nicht, sie uns auch nicht. Wir hatten Gespräche im RIAGG-Büro, wo man uns halb oder gar nicht glaubte. Der Jugendpsychiater wollte mit Eva und mir getrennt unseren Ablösungsprozess besprechen. Wir lehnten das ab, weil das nach unserer Meinung nicht die Hauptsache war. Wir versuchten, ihm klarzumachen, dass wir Brigitta ihre Selbständigkeit von ganzem Herzen gönnten, dass aber die Art und Weise, wie sie sich jetzt von uns losmachte, alles Maß überstieg. Der Jugendpsychiater verübelte es uns, dass wir nicht auf seinen Vorschlag eingingen. Er versuchte, uns davon zu überzeugen, dass wir als Adoptiveltern keine richtigen Eltern seien und dass wir Brigitta vielleicht eher als Statussymbol denn als Kind adoptiert und erzogen hätten. Wir begriffen allmählich, dass er keine blasse Ahnung von Adoption und kein Gefühl für ein Adoptivkind hatte, das um Hilfe und Unterstützung schreit, weil es auf dem Wege zur Reife den Halt zu verlieren droht.
Fünfzehn Wochen lang besuchten wir das RIAGG, aber wir kamen keinen Schritt weiter. Man sah ein, dass Brigitta wie so viele andere Adoptivkinder wahrscheinlich einen schlechten Lebensstart gehabt hatte und dass es ihr deswegen in der Zeit, wo sie sich von den festen Familien- und Schulstrukturen ablösen wollte, an einer zuverlässigen und sicheren Existenzgrundlage fehlen könnte. Aber man weigerte sich, die Konsequenzen aus dieser Einsicht zu ziehen. Stattdessen war man der Meinung, das Problem läge hauptsächlich bei uns: Wir seien nicht flexibel genug, hegten allzu hoch gespannte Erwartungen. Ob wir unsere Kinderlosigkeit eigentlich verarbeitet hätten?
Schließlich besprachen wir nur noch Nebensächlichkeiten. Brigitta hatte 300 Mark von der Pflegefamilie gestohlen, und wir wurden gebeten, den Betrag zu erstatten. Sie war wegen einer sonderbaren Lungenkrankheit ins Krankenhaus eingeliefert worden, litt an Hyperventilation. Sie schwänzte die Schule, nahm überall Geld weg. Diesen Geschichten standen wir sprachlos und machtlos gegenüber. Wir wussten nicht, wo sie war, wer sich um sie kümmerte und warum sie sich in eine Furie verwandelt hatte.
Wenn wir etwas über Brigitta wissen wollten, mussten wir mit einer Frau T. von der Jugendfürsorge Kontakt aufnehmen. Wir erklärten ihr bis zum Überdruss, dass es sich mit Adoptivkindern vielleicht anders als mit leiblichen Kindern verhalte. Aber sie argumentierte - wie alle Berater, denen wir begegnet sind - nach festen Mustern. Brigitta war ihrer Meinung nach ein geselliges und spontanes Kind, das genau wusste, was sie wollte. Wenn ich Frau T. anflehte, uns zu sagen, was Brigitta gegen uns hatte, antwortete sie, dass sie aufgrund ihrer Schweigepflicht nicht darauf eingehen könne, dass es aber auf jeden Fall sehr schlimm sei. Der Gedanke, dass wildfremde Menschen die Macht hatten, unser Kind von uns entfernt zu halten, ließ uns verzweifeln. Trotz allem begriffen wir, was Brigitta bewegte. Wir empfanden ihren Schmerz und ihre Wut wegen ihres Adoptivstatus mit. Wir fühlten heraus, dass sie in dem Augenblick, wo sie sich bewusst wurde, dass sie weggegeben worden war, einen existentiellen Schock erlebt hatte.
Ende 1987 wurde Brigitta in ein Erziehungsheim für Kinder bis 18 Jahre eingewiesen, wo wir einige Male mit ihr gesprochen haben. Sie ist zwei- oder dreimal zu Hause gewesen. Manchmal war es wieder wie früher. Manchmal war nur Trauer da. Die Scham wegen allem, was passiert war, spielte bei Brigitta eine vorherrschende Rolle. Sie glaubte nicht, dass noch etwas zu kitten wäre. Es nützte nichts, wenn wir ihr versicherten, dass sie unser Kind sei und immer bleiben werde. Manchmal geriet sie in blinde Wut auf uns und auf das Leben. Dann drohte sie, Schluss zu machen.
In dem Heim machte Brigitta, was sie wollte. Sie kam und ging, wenn es ihr passte, hatte mit Wissen der Betreuer mehrere intime Kontakte, ging fast nie in die Schule und war jedem geistig überlegen. Im Frühjahr 1988 ging sie auf eigene Initiative aus dem Heim. Sie ist nie mehr zurückgekehrt. Uns erreichte das Gerücht, dass sie zu einem älteren Freund gezogen sei. Später haben wir - obwohl Brigitta immer kerngesund gewesen war - haufenweise Krankenhaus-, Arzt- und Apothekenrechnungen erhalten, die einzigen Lebenszeichen.
Auf einmal hörten wir überhaupt nichts mehr über sie. Wir baten den Jugendrichter, sie unter Aufsicht zu stellen. Es bedurfte eines Vormundes, um Brigitta anzuregen, in die Schule zu gehen und einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Brigitta begriff bald, dass der Jugendrichter und der Vormund machtlos waren, wenn sie nicht mitwirkte. Vor einem Jahr teilte ihr Vormund uns mit, dass Brigitta eine Klage wegen geistiger und körperlicher Verwahrlosung gegen uns einreichen wolle. Aus dieser Zeit stammten auch Beschuldigungen über weit greifende Intimitäten, die ich mir mit ihr erlaubt hätte. Das ging dem Jugendrichter zu weit. Er gab zu verstehen, dass jede Klage als Verleumdung betrachtet und dementsprechend verfolgt würde. Seitdem haben wir nie mehr etwas von Brigitta gehört.
In den vergangenen Jahren sind wir derart in die Enge getrieben worden, dass wir jetzt nur noch versuchen können, uns über Wasser zu halten. Wir haben einen ständigen Kampf zur Erhaltung unserer Familie führen müssen. Wir konnten nicht anders, als uns nun von unserem ersten Adoptivkind zu distanzieren. Wir mussten sie allmählich als jemanden betrachten, der uns zugrunde richten wollte.
Auch unsere beiden anderen Adoptivkinder haben viel mitgemacht. Am Anfang haben wir oft heftig reagiert. Wir bekamen den Eindruck, dass Iris und Juan uns auch bald verlassen würden. Wenn sie ein wenig zu spät nach Hause kamen, gerieten wir in Panik. Wenn sie etwas machten, was man nicht ganz durchgehen lassen konnte, betrachteten wir es als den ersten Schritt auf dem Wege zum Abbruch ihrer Beziehung zu uns. Sie haben uns trotzdem immer als Vater und Mutter behandelt.
Heute sind wir der Sache fast wieder gewachsen. Wir sehen ein, dass wir die Ereignisse vielleicht nie hätten verhindern können. Aber die Tatsache, dass wir eine Tochter von fast 19 Jahren haben, die uns hasst, betrachten wir immer noch als den größten Misserfolg unseres Lebens. Es ist ein Loch in unserem Leben, ein Kummer, an den man sich im Laufe der Zeit gewöhnt, der aber immer da ist.
Lernen, damit zu leben
René A.C. Hoksbergen, Wim Knappstein
(Bei diesem Kapitel handelt es sich um eine gekürzte und überarbeitete Fassung eines Beitrags erschienen in: Hoksbergen/Walenkamp 1991)
In einer 25-jährigen Praxis mit Auslandsadoptionen haben wir erfahren, mit welch' großen Anforderungen Adoptivfamilien konfrontiert werden. Manchmal sind sie jahrelang durch komplexe und tief liegende Probleme rund um die Erziehung und Entwicklung ihres Adoptivkindes belastet. In diesem Kapitel werden wir anhand von zwei Fallbeispielen zeigen, dass Erziehungs- oder Verhaltensprobleme der Lebenssituation einer Familie ihre Stempel aufdrücken können.
1. Kim
Kim war vier Jahre alt und sein Bruder zwei, als sie 1974 in Korea in ein Kinderheim kamen. Ihre Mutter war kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes gestorben. Der Vater wusste anfangs innerhalb der Familie Hilfe aufzutreiben, aber als auch er Anfang 1974 plötzlich starb, gaben Verwandte die Kinder zur Adoption frei. Die Kinder, so stellte sich später heraus, mussten ungefähr ein Jahr lang in einem Kinderheim bleiben, bis eine europäische Familie gefunden wurde, die sich zur Aufnahme der beiden Kinder bereit erklärte.
In dieser Adoptivfamilie leben schon zwei Kinder: eine 14-jährige Tochter und ein 12-jähriger Sohn. Beide Eltern haben eine Arbeitsstelle. Die Mutter arbeitet in einer Schule für lernbehinderte Kinder. Der Vater ist durch seine Arbeit unregelmäßig zu Hause. Ihr Einkommen ist hoch. Sie betätigen sich auch noch in kulturellen Organisationen und Sportvereinen, sodass sie örtlich recht bekannt sind. Ihre Beweggründe für die Adoption eines Kindes wurden durch das 1971 erschienene Gutachten des Clubs von Rom beeinflusst. Sie beschließen, selbst keine Kinder mehr zu bekommen, weil es anderswo in der Welt genügend Kinder gibt, die gar keine Eltern haben.
Für Kim und seinen Bruder scheint die Situation ideal zu sein. Obwohl es Anfangsprobleme in der Familie gibt, wie Sprach-, Eß- und Schlafprobleme, und die wechselseitige Anpassung schwer fällt, findet jedes Familienmitglied im Laufe des ersten Jahres nach der Ankunft der beiden koreanischen Kinder seinen Platz wieder. Kim entwickelt sich problemlos. Er ist ein lebhafter Junge, versessen auf Sport. In der Schule hat er anfangs große Probleme. Seine Mutter hilft ihm aber durch die schweren ersten Monate. Er scheint die neue Sprache ziemlich schnell zu lernen, obwohl sein jüngerer Bruder sie besser und schneller versteht. Schon bald geht es Kim recht gut in der Klasse, obwohl den Eltern geraten wird, ihn das erste Schuljahr wiederholen zu lassen. Die Mutter ist aber dagegen und beschließt, einen Teil ihres Urlaubs in die Nachhilfe von Kim zu investieren. Dies hat Erfolg, vor allem weil Kim fleißig mitmacht.
In der zweiten Klasse geht es schon etwas besser; Kim bleibt aber ein mäßiger Schüler. Wenn er glaubt, etwas zu können, springt er schnell auf etwas anderes über. Der Lehrstoff fesselt ihn nicht wirklich, oft sitzt er da und träumt, leidet an Konzentrationsmangel. Nur dank seiner Mutter wird er immer wieder versetzt, bis er 1982 in das letzte Grundschuljahr kommt. Nun erhöht Kims Schule die Anforderungen, um einen verlässlichen Rat hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn der Kinder geben zu können. Kims Resultate sind schlecht, er muss dieses Jahr wiederholen. Sein Bruder und die beiden andere Kinder sind viel besser: Die ältere Schwester hat in Jura die Zwischenprüfung nach dem ersten Studienjahr bestanden und der ältere Bruder hat das Gymnasium erfolgreich absolviert und wird nun Physik studieren. Kims jüngerer Bruder hat wenig Lernprobleme.
Über Korea sprechen seine Eltern kaum. Sie meinen, dass ihre beiden Adoptivkinder sich möglichst bald in ihrer neuen Heimat wie zu Hause fühlen sollen. Die Vergangenheit tut ihrer Meinung nach wenig zur Sache.
Als Kim 15 Jahre alt ist, ändert er sein Verhalten radikal: Er will nicht mehr, dass seine Mutter ihm Nachhilfe gibt. Er scheint nur noch Interesse für Spielautomaten zu haben, lungert mit einigen anderen Jungen aus dem Dorf in seiner Freizeit nur herum. Auch treibt er keinen Sport mehr. Anfangs ist seinen Eltern nicht bewusst, wie Kim all sein Geld auftreibt, dann aber stellt es sich heraus, dass er stiehlt: Er wird nämlich eines Tages von der Polizei nach Hause gebracht. Nun stellt sich heraus, dass er schon früher die anderen Familienmitgliedern bestohlen hat. Kims Eltern bekommen den Rat, ihn besser im Auge zu behalten und ihm in seiner Freizeit Gelegenheiten zum Geldverdienen zu verschaffen. Dies gelingt ihnen auch.
Um seinen 16. Geburtstag herum fängt Kim an, davon zu reden, dass er ausziehen möchte. Seine Eltern sind aber der Meinung, dass Kim noch nicht reif genug ist, um selbständig zu wohnen, und das nicht zu Unrecht. Sie weigern sich also und versuchen, ihm die Gründe für ihre Entscheidung deutlich zu machen. Anfangs scheint er sich darin zu fügen, als aber nach einigen Monaten ein schöner Raum bei einem Verwandten frei wird, will er absolut dort einziehen. Die Atmosphäre zu Hause ist inzwischen schon längst zum Zerreißen gespannt. Kim schwänzt regelmäßig die Schule, und seine Hausaufgaben macht er nur noch sehr selten. Für ernste Themen ist er nicht ansprechbar. Er scheint sein Elternhaus als eine Art Pension zu betrachten.
Nachdem sich seine Eltern wiederum geweigert haben, zieht Kim sich noch tiefer in sich selbst zurück. Er wird sehr niedergeschlagen und ruhelos - von dem munteren Kim der ersten Jahre ist kaum noch etwas zu spüren. Eines Abends unternimmt er einen ersten Suizidversuch, jedoch so ungeschickt, dass die Signalwirkung deutlich ist und die körperlichen Folgen gering sind. Eine Woche später reißt Kim von Zuhause aus, nachdem er sich wieder mit seinem Vater über seine Situation an der Schule gestritten hat.
Weil sie keinen Rat mehr wissen, bitten die Eltern einen Psychologen um Hilfe. Dieser spricht schon einige Male mit Kim, aber dann bricht der Junge den Kontakt ab. Er meint, dass der Mann ihm doch nicht helfen kann. Kim will dann seinen Wehrdienst vorzeitig ableisten. Seine Eltern sind einverstanden, und nach seiner Abreise kehrt wieder Ruhe in das Haus ein.
Anfangs ist Kim ein guter Soldat. Er ist begeistert und scheint etwas aufzuleben. Kontakt zu seiner Familie hat er aber sehr wenig, eigentlich nur telefonisch, wenn er seine Eltern braucht - insbesondere wenn er Geld benötigt. Kim kann überhaupt nicht mit Geld umgehen. Er macht große Schulden - vor allem, weil er es wunderbar findet, großzügig zu sein. Manche Kameraden nehmen seine Großzügigkeit gerne in Anspruch, inzwischen stapeln sich aber die Rechnungen. Nach etwa einem halben Jahr Wehrdienst verfällt Kim in alte Verhaltensmuster. Er wird wieder niedergeschlagen, ruhelos und ohne einen eindeutigen Anlass unternimmt er einen zweiten Suizidversuch. Er wird vorzeitig aus dem Militärdienst entlassen.
Nach einigen Tagen nimmt er Kontakt mit dem ihm bereits bekannten Psychologen auf. Dieser wird mit folgenden Problemen konfrontiert: Kim hat keinen Wohnraum und sucht ein Zimmer; er will keinen Kontakt mehr mit seiner Familie und möchte auch nicht, dass der Psychologe seinen Eltern erzählt, wohin er demnächst ziehen wird; er hat Schulden in Höhe von 10.000 DM und hat keine Ahnung, wie er diese abzahlen kann; er will irgendeine Ausbildung erhalten und am liebsten das Gymnasium besuchen; er will gern seinen Bruder sprechen, aber getrennt von seinen Eltern. Dem Psychologen wird deutlich, dass nur eine intensive und längere Behandlung (vielleicht) zu einem Erfolg führen kann. Kim scheint dazu bereit zu sein.
Zunächst muss Kim einen Schlafplatz haben. Dieser wird bald bei einer mit dem Psychologen befreundeten Adoptivfamilie mit vier Kindern gefunden. Kim zeigt in der Gastfamilie zunächst seine besten Seiten. Schon bald aber werden folgende Eigenschaften deutlich: Kim ist nicht imstande, für sich selbst zu sorgen, geschweige denn für sein Zimmer; er schätzt seine eigene Möglichkeiten ganz falsch ein; so will er innerhalb eines Jahres das Gymnasium beenden und alle Schulden abbezahlen; er fühlt sich jedem Familienmitglied in hohem Maße unterlegen und empfindet eine tief liegende Scham; seine Aggressionen sind hauptsächlich gegen seine Mutter gerichtet, sein Verhältnis zu seinem Vater ist unklar; Korea und eventuelle Erinnerungen an die dort verbrachte Zeit scheinen keine Rolle zu spielen, er will sich hier niederlassen und zu Hause fühlen; Freunde hat er nicht und seine alten Bekannten will er nicht aufsuchen.
In langen Gesprächen mit einem Sozialarbeiter erweist sich, dass Kim sein Leben als eine Ansammlung von Misserfolgen betrachtet. Das Verhältnis zu seinen Eltern malt er schwarz. Er hat jetzt schon ein Jahr lang kaum Kontakt zu ihnen und will das so beibehalten. In den ersten beiden Monaten in der Gastfamilie erweist sich, dass er sich vor allem bewähren will und dadurch wahrscheinlich seiner Familie zeigen will, dass er etwas leisten kann.
Es wird ein Plan gemacht, wie mit der Arbeit in kleinen Schritten begonnen werden kann. Dies wird aber so hingestellt, als wäre es Kims eigener Plan. Ein Hausarzt wird gleichfalls eingeschaltet. Anlass dazu ist eine Reihe von körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden, Müdigkeit und Schlafprobleme. Der Arzt untersucht Kim, um mögliche körperliche Ursachen auszuschließen. Außer den Rückenschmerzen scheinen die übrigen Beschwerden die Folgen von Spannung und einem verschobenen Tagesrhythmus zu sein. Der Hausarzt vorschreibt ihm Beruhigungsmittel. Die empfohlenen Entspannungsübungen helfen Kim, seine Apathie und Lustlosigkeit zu überwinden.
Ohne viel Mühe werden einfache Stellen gefunden. Dann zeigt sich, dass Kim sehr fleißig und zuverlässig sein kann. Nachdem er einige Monate auf vielerlei Weise tätig gewesen ist, möchte er irgendwo - aber unweit von seiner Gastfamilie - ein Zimmer haben. Er findet etwas festere Arbeit und ist jetzt auch imstande, seine Schulden zu begleichen. Nach einem Jahr wird mit Hilfe eines Psychologen ein erster Kontakt mit seiner Familie hergestellt - noch nicht gleich mit seinen Eltern, aber mit einem ernsthaft erkrankten Onkel, den Kim immer sehr gemocht hat. Auch telefoniert er einige Male mit seinem jüngeren Bruder.
Nachdem Kim gut zwei Jahre von zu Hause fort ist, deutet er eines Tages an, dass er seinen Vater wieder sehen möchte. Es gibt hierzu auch einen bestimmten Anlass: Er will seinen Eltern zu ihrem 30. Jubiläum ihrer Eheschließung gratulieren. Kim ist zur Ruhe gekommen und kann für seine eigenen Wünsche eintreten. Der Psychologe hat inzwischen seine Eltern verständigt. Diese wissen, dass sie vor allem zuhören und nicht zu schnell mit Kim in der Vergangenheit graben sollten - es sei denn, dass Kim von selbst damit anfängt.
Mitte 1991 - ein Jahr später - wohnt Kim wieder zu Hause, geht in eine Abendrealschule und hat eine Arbeit, die ihm gut gefällt. Das Verhältnis zu seinen Eltern und vor allem das zu seinem Vater zeigt Tiefgang. Es ist geplant, gemeinsam nach Korea zu reisen, sobald Kim sein Abschlusszeugnis erhalten hat.
2. Diskussion
Bei dem Fallbeispiel "Kim" werden folgende wichtige Familiencharakteristika und Ursachen von Schwierigkeiten deutlich:
(a) Kims Eltern zeigen großen Einsatz bei der Erziehung ihrer Kinder. Sie sind idealistisch und erwarten keine größeren Probleme nach der Ankunft der beiden koreanischen Jungen. Es ist von einer stark überbehütenden Haltung und einem stimulierenden Vorgehen die Rede. Dies hat viele positive Folgen. Kim und sein Bruder gehen Bindungen zu ihren Eltern ein. In den ersten Jahre "läuft alles wie am Schnürchen".
(b) Dieser Einsatz und dieses Engagement haben bei Kim später - als er ein Jugendlicher geworden ist - die Wirkung, dass er sich bevormundet fühlt, zu wenig Dinge selbst erfahren hat und nicht selbst über sich bestimmen kann. Durch seine Lebensgeschichte in Korea ist er ziemlich unsicher und neigt zu einem depressiven Verhalten (Trübsinn, Suizidialität, Interessenverlust). Wahrscheinlich hat er eine gute Beziehung zu seinen leiblichen Eltern gehabt.
(c) Es besteht ein großer Unterschied zwischen den intellektuellen Möglichkeiten von Kim und denjenigen der anderen Familienmitglieder. Lange Zeit erkennen die Adoptiveltern dies nicht. Auf intellektuellem Gebiet muss Kim ständig das Letzte aus sich herausholen. Er hat dies lange durchgehalten, um dann zur anderen Seite hin auszuschlagen, und das ist letztlich nicht verwunderlich. Später erweist sich, dass Kim die hohen Leistungserwartungen folgendermaßen erfahren hat: Lernen ist nötig, um wertvoll zu sein - jeder hier kann lernen - ich kann nicht lernen, enttäusche also meine Eltern - ich tauge nichts.
(d) Die Eltern waren auf die Verwundbarkeit, die sich Kim während der Zeit in Korea zugezogen hat, nicht vorbereitet.
Die derzeitigen Probleme von Kim sind sowohl allgemein (altersspezifisches Ablösungsverhalten) als auch adoptionsspezifisch (zum Beispiel bedingt durch die ungenügende Vorbereitung der Adoptiveltern auf ein Kind mit einer gestörten Entwicklung).
3. Irma
Die ersten zehn Monate in Irmas Leben, 1980 in Indonesien, verlaufen tragisch und chaotisch. Ihre Mutter ist kurz nach ihrer Geburt gestorben. Irma ist ihr sechstes Kind. Der Vater musste sofort wieder heiraten, denn allein kann er unmöglich für seine große Familie sorgen. Der Vater hat aber Pech. Seine zweite Frau, die selbst auch Kinder hat, stirbt nach einigen Monaten. Der Vater bringt Irma, die zu diesem Zeitpunkt fünf Monate alt ist, zu einer Verwandten. Diese hat selbst eine große Familie und kann Irma nicht für längere Zeit aufnehmen. Zufällig weiß sie aber von der Möglichkeit der Adoption und zusammen mit dem Vater bringt sie Irma in ein Kinderheim.
Die Adoption wird verhältnismäßig schnell geregelt, und Irma kommt fünf Monate später zu ihren neuen Eltern. Diese haben einen leiblichen Sohn im Alter von sechs Jahren und einen gut zwei Jahre alten adoptierten Jungen aus Indonesien. Das Ehepaar weiß, dass es nach der Geburt ihres Sohnes keine weiteren Kinder bekommen kann. Da sie zwei Jungen haben, wollen sie nun gerne ein Mädchen aus demselben Land wie ihr Sohn Remo haben, der im Alter von nur drei Monaten zu ihnen kam und mit dem sie sich von Anfang an ausgezeichnet verstanden. Alles in allem handelt es sich also um eine stabile Familie. Der Vater hat einen guten und sicheren Arbeitsplatz und die Mutter kann all ihre Zeit der Familie widmen.
Nahezu von der ersten Begegnung in Indonesien an kommt die Mutter mit Irma nicht zurecht. Den Körperkontakt, den die Mutter so gerne will, wehrt Irma ab. Sie weint viel und manchmal verfällt sie scheinbar ohne jeglichen Anlass in heftige Wutanfälle. Auch wird die Nachtruhe der Familie von Irma seit ihrer Ankunft gestört. In den ersten Monate kann sie nicht allein einschlafen und wacht immer wieder kreischend auf. Am schnellsten kann sie dann vom Vater beruhigt werden. Mit ihm hat sie ein gutes Verhältnis; er muss aber die Kindererziehung hauptsächlich seiner Frau überlassen. Diese fühlt immer mehr Widerwille Irma gegenüber aufkommen - der so stark wird, dass die Eltern beschließen, die juristische Adoption vorläufig aufzuschieben.
Die Mutter hält ungefähr ein Jahr durch und sucht dann Hilfe auf Anraten anderer Adoptiveltern, mit denen sie regelmäßig Kontakt hat. Die Psychologin, die sie konsultiert, hat jedoch noch nie mit Adoptiveltern und -kindern zu tun gehabt. So geht sie völlig von ihren Erfahrungen mit anderen Familien aus. Es folgen neben längeren Gesprächen mit den Eltern Beobachtungen von Irmas Verhalten in der Familie. Das Merkwürdige ist nun, dass bei der Psychologin - sowie bei dem Vater - die stark abwehrende und erstarrte körperliche Reaktion von Irma nicht auftritt. Was Irmas Schlafprobleme angeht, bekommt die Familie gute Ratschläge, die dann auch innerhalb weniger Monate helfen. Die Wutanfälle lassen ebenfalls nach. Sie scheinen im Zusammenhang mit bestimmten Frustrationen gestanden zu haben. Nachdem nun viele ihrer Bedürfnisse ausreichend befriedigt werden, gibt es für diese Wutanfälle keinen Grund mehr. Aber Irmas Abwehrhaltung gegenüber der Mutter bleibt bestehen und irritiert diese weiterhin.
Gut ein Jahr später, als Irma etwa zweieinhalb Jahre alt ist, bittet die Mutter die Psychologin wiederum um Hilfe. Sie weiß keinen Rat mehr und fürchtet, dass sie Irma etwas antun wird. Es folgen eine gründliche diagnostische Untersuchung und eine neue Analyse der Familieninteraktion. Bei Irma wird deutlich, dass sie jemand ist, die erst einmal abwartet, "wie der Hase läuft", und nicht leicht tief gehende emotionale Beziehungen eingeht. Vielleicht entwickelt sich bei ihr Gefühlsarmut. Weil sie aber noch so jung ist, soll davon nicht voreilig ausgegangen werden. Es scheint, dass es Irma an Vertrauen in andere Menschen fehlt, wohingegen sie ein großes Bedürfnis nach Zuwendung hat. Der Umgang mit den beiden anderen Kinder ist ziemlich normal, aber auch ihnen gegenüber ist sie zurückhaltend. Sie kann sich übrigens sehr gut allein beschäftigen und scheint kein unintelligentes Kind zu sein. Es wird der Psychologin bei ihrer zweiten Untersuchung deutlich, dass die Mutter für Irmas Reaktionen viel empfindlicher ist als andere Personen.
Um die Mutter zu entlasten und um von Irma ein deutlicheres Bild zu bekommen, wird sie in ein medizinisches Tagesheim für Kinder im Vorschulalter gebracht. Dort entpuppt sie sich als ein intelligentes und kooperatives Kind im Vorschulalter. Sobald sie jedoch wieder zu Hause bei der Mutter ist, ändert sich ihr Verhalten total. Als sich herausstellt, dass die Mutter sich einige Male nicht hat beherrschen können und Irma konkret gefährdet ist, beginnt auch der Vater zu glauben, dass Irma aus der Familie weg muss. Die Situation in der Familie droht untolerierbar zu werden, und auch die beiden anderen Kinder fangen an, negativ auf Irma zu reagieren. Merkwürdig aber bleibt, dass niemand außer der Mutter das schwierige Verhalten von Irma in dem Maße wahrnimmt, wie es offenbar die Mutter erlebt. So fühlt sich die Mutter unverstanden und isoliert, ist ganz verzweifelt. Das Verhältnis mit ihrem Mann, der Irma sehr gern mag, gerät durch all diese Probleme unter Druck.
Nun wird der Vater aktiv. Er ruft das Adoptionszentrum der Universität von Utrecht an. Nach einem langen Gespräch mit dem Ehepaar wird die Familie an einen Kinderpsychiater überwiesen. Nach einer gründlichen Untersuchung kommt dieser zu dem Ergebnis, dass Irma, inzwischen drei Jahre alt, dem intimen Familienleben nicht gewachsen ist. Deswegen rät er zur Heimeinweisung mit Aufrechterhaltung von etwas Kontakt. Die Familie erfährt diesen Rat wie einen Schlag. Der Vater nimmt Kontakt mit einem Sozialarbeiter auf, den er durch eine Adoptionsorganisation gut kennt. Dieser hat drei Adoptionskinder, die schon etwas älter sind. Weil in der Ferienzeit ein Heimplatz nicht so schnell gefunden werden kann, nimmt der Sozialarbeiter Irma mit nach Hause. Diese reagiert scheinbar munter und ungerührt auf die neue Situation.
Nach vier Wochen findet beim Psychiater eine weitere Untersuchung statt. Der Psychiater bleibt bei seinem Standpunkt. Weil Irma sich aber in den ersten vier Wochen in der Familie des Sozialarbeiters so gut eingelebt hat, willigt der Psychiater ein, dass ihr Aufenthalt dort fortgesetzt wird.
Es folgt noch eine dritte Untersuchung, zwei Monate später. Der Psychiater entscheidet dann zu Gunsten der Familie, die verhüten will, dass Irma in ein Kinderheim kommt. Die neue Mutter scheint ihr gewachsen zu sein und ist jedenfalls weniger empfindlich für die stark abwehrende Haltung, die Irma inzwischen auch ihr gegenüber zeigt. Der Adoptivmutter wird geraten, Irma einige Zeit lang nicht zu besuchen und sich selbst einer gründlichen psychologischen Untersuchung zu unterziehen.
Die Pflegefamilie beschließt, mit der Adoptivfamilie in engem Kontakt zu bleiben und zu versuchen, das Verhältnis zwischen Irma und ihrer Mutter zu normalisieren. Zwischen den beiden Familien entsteht eine intensive Beziehung. Auch möchte Remo Irma gern weiter sehen, sodass Begegnungen arrangiert werden. Beide Kinder reagieren darauf sehr positiv, zur großen Freude ihrer Eltern.
Als Irma zwei Jahre in der Pflegefamilie ist, beschließen ihre Adoptiveltern, die Elternschaft abzutreten. Die Mutter hat sich hierzu nach Rücksprache mit ihrer Therapeutin entschlossen. Nach Meinung der Fachleute gehen die neuen Eltern gut mit Irma um, und sie bekommt dort alle Gelegenheit, sich positiv weiterzuentwickeln. Das Verhältnis zu den anderen drei Kindern ist befriedigend.
Ende 1992 sind weitere sieben Jahre vergangen. Irma ist 12, Remo 14 und ihr niederländischer Bruder 16 Jahre alt. Mit beiden hat Irma ein gutes Verhältnis, genauso wie mit den anderen drei Adoptivkindern. Sie ist inzwischen von den Pflegeeltern adoptiert worden. Die beiden Familien sind aber miteinander in intensivem Kontakt geblieben, dass Irma sogar seit vorigem Jahr über ihre beiden Familien spricht. Die Abwehrhaltung ist ein Teil von ihr geblieben. Jeder hat sich daran gewöhnt, auch ihre erste Mutter.
Die erste Adoptivmutter hat sich in therapeutische Behandlung begeben, in der ein unverarbeitetes Jugendtrauma hervortrat. Sie hat eine komplizierte Jugendzeit hinter sich: Ihre Eltern wurden geschieden, die Kinder der Mutter zuerkannt. Aber diese war der neuen Situation nicht gewachsen und insbesondere nicht ihrer ältesten Tochter - der jetzigen ersten Adoptivmutter. In der Analyse wurde aufgedeckt, dass es zu einer regelrechten emotionalen Vernachlässigung und auch zu einem gewissen Maß an Misshandlung kam. Dies geschah zwischen ihrem achten und dem 11. Lebensjahr. Dann ging ihre Mutter ein dauerhaftes Verhältnis mit einem Mann ein; die Ruhe kehrte ins Haus zurück. Nie aber hat sie über diese Ereignisse gesprochen, auch nicht mit ihrem Mann.
Das unverarbeitete Trauma wurde durch Irmas Verhalten aktiviert. Die Mutter will nämlich von Menschen, die ihr wichtig sind, akzeptiert werden. Zurückweisungen kann sie nicht ertragen. Sie war dadurch nicht imstande, Irmas Reaktionen von ihrem eigenen Ich getrennt zu sehen, und verband diese zu Unrecht miteinander. Zudem hatte Irma bei ihr starke Schuldgefühle ausgelöst. Tief in ihrem Herzen hatte sie sich immer für die Trennung ihrer Eltern schuldig gefühlt und hatte deswegen das negative Verhalten ihrer Mutter als eine Art von Strafe betrachtet. Dieses Verhalten hatte übrigens auch aggressive Gefühle hervorgerufen, die sie aber ihren Eltern gegenüber nicht zeigen konnte.
Die großen Schwierigkeiten, die die Mutter mit sich selbst hatte, wurden anfangs nicht erkannt. Inzwischen ist sie mit Hilfe der Psychologin wieder mit sich selbst "ins Reine gekommen".
4. Diskussion
Anfangs kann die Mutter mit Irma überhaupt nicht umgehen. Sobald Irma aber mit anderen Personen interagiert, scheint es keine Probleme zu geben. Für Adoptiveltern ist die unnahbare Haltung eines Kindes zum Verzweifeln. Von ihnen wird dann viel Geduld und Verständnis erwartet, was durch die Kenntnis auffälliger Verhaltensweisen von Adoptivkindern wie Irma gefördert wird. Gewöhnlich sind Adoptiveltern aber nicht über diese Problematik informiert. Die Ursachen liegen bei den Eltern und dem Kind. Eine eingehende Verbesserung tritt erst ein, wenn beide Seiten ihr Verhalten geändert haben.
Die Verhaltensstörung bei Irma - das fehlende Vertrauen und die dadurch bedingte Abwehrhaltung und Unnahbarkeit - ist nicht verschwunden, hat sich aber vermindert. Die turbulenten ersten zehn Lebensmonate haben offenbar einen großen negativen Einfluss auf sie gehabt, da sie vermutlich besonders verletzlich war. Der wichtigste Unterschied nach sechs Jahren in einer anderen Familie ist, dass sie selbst mit ihren Reaktionen besser umgehen kann. In der neuen Familie kann diese Störung auch weniger leicht auftreten, da es dort Liebe und den von ihr benötigten Abstand gibt.
Aus Irmas Geschichte erweist sich, dass die Umplatzierung eines Adoptivkindes nicht zu einem endgültigen Beziehungsabbruch führen muss. Das Aufrechterhalten von Kontakten ist aber in einem hohen Maße von Vereinbarungen, den Auffassungen der beteiligten Fachkräfte und insbesondere den Intentionen beider Familien abhängig. Auf jeden Fall ist viel Zeit notwendig: Den ersten Adoptiveltern muss Zeit gegeben werden, um Gefühle des Versagens und der Schuld zu verarbeiten. Das Kind muss die Zeit haben, sich anderswo einzugewöhnen. Die neuen Eltern werden ihre Zeit und Energie vor allem für das neue Familienmitglied benötigen und sollten darüber hinaus nicht mit den Problemen der ersten Familie belastet werden.
5. Schlussbemerkungen
Die Eltern von Kim und Irma haben einmal voller Erwartungen mit der Adoption begonnen. Anders als erwartet, führte die Adoption aber zu einem dramatischen Fortgehen der Kinder. Die Adoptionen scheinen misslungen zu sein. Dennoch wird in beiden Familien nach einer Anzahl von Jahren ein neues Gleichgewicht gefunden.
Eine Anzahl von Faktoren hat einen großen Einfluss auf das Scheitern oder Überwinden der Schwierigkeiten:
Erstens muss im Kind eine gewisse Grundlage bestehen, um in einer europäischen Familie mit ihren hohen Ansprüchen an Emotionalität, Beziehungsintensität und gesellschaftliche Anpassung erzogen werden zu können. Es ist aber schwer festzustellen, ob ein Kind dafür geeignet ist oder nicht. Man geht von der These aus: Alle fremdländischen Kinder sind für die Erziehung in einer Adoptivfamilie geeignet, es sei denn, dass... Es ist aber eine Illusion zu glauben, dass irgendwann alle Faktoren bekannt sind und zuverlässige Vorhersagen gemacht werden können. Die große Unbekannte wird immer die Interaktion zwischen Eltern und Kind bleiben: Manche Eltern können besser mit den Auswirkungen von Vernachlässigung, mit Bindungsängsten, Unnahbarkeit oder den Folgen frühkindlicher Trennungen umgehen als andere.
Zweitens ist die Einstellung der Eltern ein wichtiger Faktor. Zu hohe Erwartungen sind immer ein Risiko, selbst wenn sie zu großem Einsatz seitens der Adoptiveltern führen.
Eine andere wesentliche Bedingung für Erfolg ist, der Identität des Kindes genügend Raum zu geben. Bei jedem Kind, das zum Zeitpunkt der Platzierung schon etwas älter ist, hat sich die Identität bereits stark ausgebildet. An der einzigartigen Persönlichkeit kann oft nicht mehr viel geändert werden, wohl aber an bestimmten Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Das Kind muss lernen, im Alltagsleben mit seinen Verwundbarkeiten umzugehen, die es sich in der ersten Phase seines Lebens zugezogen hat. Während der Adoleszenz kommen viele Jugendliche in eine turbulente Zeit, erfahren zum Beispiel eine ernsthafte Identitätskrise. Und gerade Adoptivkinder scheinen dann besondere Probleme zu machen. Adoptiveltern tendieren dann mehr als andere Eltern dazu, an ihrer Elternschaft und ihren Erziehungsfähigkeiten zu zweifeln. Oft ist dann eine langfristige Beratung notwendig.
Zum Schluss: Dieser Beitrag trägt nicht umsonst den Titel "Lernen, damit zu leben". In beiden Familien sind nicht das irritierende Verhalten, die beschränkten Möglichkeiten und unbefriedigenden emotionalen Beziehungen verschwunden. Diese Eltern und Kinder haben lernen müssen, mit ihren Grenzen und Beschränkungen zu leben, einander zu akzeptieren und ihre ursprünglichen Erwartungen zu ändern. Dass dies geschah, hat Eltern und Kindern geholfen, wieder gemeinsam ein Stück Wegs weiterzugehen.