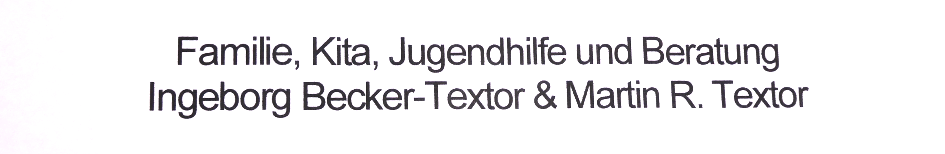Familien: Soziologie, Psychologie. Eine Einführung für soziale Berufe
Martin R. Textor
Freiburg: Lambertus, 2., erw. Aufl. 1993 - Online-Buch
Inhalt 
Vorwort
Teil 1 Familie im Wandel
Geschichte der Familie
- Familie im Mittelalter
- Familie im 19. Jahrhundert
- Familienleben um 1950
- Entwicklungstendenzen
Vorstellungen von der Familie
- Das christliche Familienbild
- Das bürgerliche Familienbild
- Das sozialistische Familienbild
Teil 2 Die Familie in der Gegenwart
Zentrale Begriffe
- Kommunikation und Interaktion
- Rollen
- System
- Struktur
Funktionen der Familie
- Haushaltsführung
- Freizeit
- Reproduktion
- Sozialisation und Erziehung
- Andere Funktionen
Der Familienzyklus
- Partnersuche und Heirat
- Die ersten Ehejahre
- Familie mit Kleinkindern
- Familie mit Schulkindern
- Familie mit Jugendlichen
- Die Familie nach Ablösung der Kinder
- Familie im Alter
Die Umwelt der Familie
- Das Netzwerk
- Familie in verschiedenen Soziotopen
Familie und Arbeitswelt
- Berufstätige - nicht erwerbstätige Mütter
Alternative Familienformen
- Wohngemeinschaften
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Teil 3 Familienprobleme
Eheprobleme und Familienkonflikte
Veränderte Familienstrukturen
- Trennung und Scheidung
- Familien Alleinerziehender
- Stieffamilien
Familien mit besonderen Belastungen
- Familie und Arbeitslosigkeit
- Familie und Armut
- Mehrkinderfamilien
- Familien mit behinderten Mitgliedern
- Familien mit pflegebedürftigen Mitgliedern
- Familien mit alkoholkranken Mitgliedern
- Ausländerfamilien
Familien mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
Gewalt in der Familie
- Misshandlung von Ehepartnern
- Gewalt gegen alte Familienmitglieder
- Kindesmisshandlung
- Sexueller Missbrauch und Inzest
Literatur
Einführung
Schon früh wurde die große Bedeutung der Familie für den einzelnen Menschen und die Gesellschaft erkannt. So schrieb zum Beispiel Aristoteles (1969) in der Nikomachischen Ethik: "Die Freundschaft zwischen Mann und Frau scheint auf der Natur zu beruhen. Denn der Mensch ist von Natur noch mehr zum Beisammensein zu zweien angelegt als zur staatlichen Gemeinschaft, sofern die Familie ursprünglicher und notwendiger ist als der Staat und das Kinderzeugen allen Lebewesen gemeinsam ist. Die andern freilich beschränken ihre Gemeinschaft gerade darauf, bei den Menschen besteht sie aber nicht nur um der Kinderzeugung willen, sondern wegen der Lebensgemeinschaft. Denn die Aufgaben sind von vorneherein differenziert und verschieden bei Mann und Frau. Also helfen sie einander, indem jedes das Seinige zum Gemeinsamen beiträgt. Darum scheint wohl das Nützliche wie auch das Angenehme in dieser Freundschaft vorhanden zu sein. Sie wird auch auf Tugend begründet sein, wenn sie beide tugendhaft sind. Denn jedes von beiden hat seine Tugend, und sie werden sich daran freuen" (VII, 14).
Die Familie wird als eine der ältesten und beständigsten Formen menschlichen Zusammenlebens bezeichnet, als die bedeutsamste und verbreiteste Form der sozialen Gruppe. Dies ist in ihrer "biologisch-sozialen Doppelnatur" (Neidhardt) begründet: Auf der einen Seite kommt sie den natürlichen Bedürfnissen des Menschen entgegen, indem sie die Geschlechtsbeziehung zwischen Mann und Frau regelt, der Mutter Schutz während der Schwangerschaft bietet, der "physiologischen Frühgeburt" Mensch das überlebensnotwendige "extrauterine Frühjahr" als "sekundärer Nesthocker" (Portmann) gewährt und die Erziehung des "Mängelwesens" (Gehlen) ermöglicht sowie die Versorgung alter (pflegebedürftiger) Menschen sicherstellt. Auf der anderen Seite erlaubt die Familie die gesellschaftliche Überformung des Menschen, seine Sozialisation und Enkulturation. Sie erfüllt eine Vielzahl von Funktionen für den Einzelnen und die Gesellschaft, prägt das ganze Leben des Individuums in der Abfolge von Herkunfts- und Zeugungsfamilie (Familienzyklus). Jedoch muss auch beachtet werden, dass Familien durch die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse der jeweiligen Epoche geprägt werden. Sie sind also ständig einem strukturellen und funktionellen Wandel unterworfen. Historische Aussagen über die Rolle der Familie in der Gesellschaft beziehen sich also auf durchaus unterschiedliche Familienformen.
Auch heute wird die große Bedeutung der Familie von Gesellschaft, Wissenschaft und Politik gewürdigt. Laut dem Wohlfahrtssurvey 1984 wird sie von 73% der Deutschen als ein sehr wichtiger (und von weiteren 24% als ein wichtiger) Lebensbereich eingeschätzt - weit abgeschlagen folgen zum Beispiel Arbeit, Einkommen, Freizeit, Erfolg oder Glaube. Nur Gesundheit wird für wichtiger gehalten (Statistisches Bundesamt 1985). Die Qualität des Familienlebens hat eine größere Bedeutung für die subjektive Lebenszufriedenheit als beispielsweise der Lebensstandard, der Beruf oder Freundschaften (Schulz 1983). Bei einer im Jahr 1989 durchgeführten Befragung von 10.000 Bundesbürgern im Alter von 18 bis 55 Jahren (Bertram 1990) wurden vor allem positive Einstellungen zur Familie geäußert. Für mehr als 80% der Befragten steht die Ehe für Sicherheit und Geborgenheit, für über 90% bedeuten Kinder ein erfülltes Leben und das Gefühl, gebraucht zu werden. Aber es wurden auch negative Aspekte erwähnt: 52% der Befragten verbinden Ehe mit dem Aufgeben persönlicher Freiheiten, 35% mit Streit und Ärger. Für 72% bedeuten Kinder Sorgen und Probleme, für 73% eine Einschränkung der Berufsarbeit und für 65%, dass Frauen auf eine Karriere verzichten müssen. Die Umfrageergebnisse stellen eine Einschätzung der genannten Sachverhalte dar - das dies der Realität entspricht, ist damit natürlich nicht gesagt. In diesem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung Ehe und Familie ablehnt, also z.B. nichteheliche Lebensgemeinschaften bevorzugt. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder negative Aussagen über den Wert und die Funktion der Familie.
Die Qualität des Familienlebens wirkt sich stark auf das psychische Wohlbefinden des einzelnen aus. Familie steht für Freude und Leid, Harmonie und Konflikte, Liebe und Feindseligkeit, Zärtlichkeit und Gewalt. Sie kann an Belastungen wie Behinderung, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Suchterkrankung oder Arbeitslosigkeit eines Familienmitgliedes zerbrechen oder an ihnen wachsen. Sie kann die seelische Gesundheit ihrer Mitglieder fördern oder zur Ausbildung von psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten beitragen. Vor allem aber wirkt sie auf Kinder ein: Die Familie ist die erste Gruppe, die der Mensch in seinem Lebenslauf angehört (Primärgruppe). So prägt sie die physische, kognitive, emotionale, psychische und soziale Entwicklung von Kindern, legt zu einem großen Teil die Grundstruktur ihrer Persönlichkeit fest. Pathogene Familieneinflüsse können die kindliche Entwicklung schädigen und zu symptomatischem Verhalten führen.
Aufgrund der hier nur kurz skizzierten Bedeutung der Familie ist es für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter unerlässlich, sich mitwissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen über diese Gruppe intensiv zu beschäftigen. So wurde im Sozialwesen die Notwendigkeit, die ganze Familie konzeptionell und praktisch in die Arbeit einzubeziehen, bereits in den 20er-Jahren dieses Jahrhunderts erkannt (Baum, Solomon). Beispielsweise schreibt Solomon schon 1926 in ihrem Buch über die soziale Diagnose: "Zum Material der Ermittlung gehören (daher) alle Tatsachen aus dem Leben des Bedürftigen und seiner Familie, die dazu helfen können, die besondere Not oder das soziale Bedürfnis des Betreffenden zu erklären und die Mittel zur Lösung der Schwierigkeit aufzuzeigen". Für den Sozialarbeiter wird es immer notwendig sein, "die Beziehungen des Menschen zur Umwelt zu studieren, nicht nur, um den Menschen zu verstehen, sondern auch um Heilmittel für die Schäden und Schwierigkeiten zu finden, die in Zukunft die einzelnen Menschen befallen können" (zit. nach Oswald 1988: 117).
Unter dem zunehmenden Einfluss der individuumszentrierten Psychoanalyse auf die Sozialarbeit geriet dieser Ansatz jedoch für längere Zeit in Vergessenheit. Vor allem nach der Etablierung der Familientherapie - die viele Sozialarbeiter nach einer familientherapeutischen Zusatzausbildung streben ließ - wurde zu einem familienorientierten Arbeiten im Sozialwesen zurückgefunden. Hinzu kamen theoretische Entwicklungen wie die Systemtheorie, das Netzwerkkonzept und die ökologische Familientheorie. Auch wurde erkannt, dass zwischenmenschliche Strukturen und Prozesse viele individuelle und gesellschaftliche Probleme mitverursachen, dass zum Beispiel die familiale Sozialisation zum Fortbestand gesellschaftlicher Schichten führt oder dass gestörte Familienverhältnisse die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mitbedingen. Zugleich nahm die Unzufriedenheit mit individuumsorientierten Ansätzen sowohl in der Sozialarbeit als auch in der Psychotherapie aufgrund der niedrigen Erfolgsquoten zu. Mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe wurde schließlich Ende der 60er-Jahre/Anfang der 70er-Jahre ein genuin sozialpädagogischer Arbeitsansatz geschaffen. Aber auch zum Beispiel im Allgemeinen Sozialdienst (ASD) wird überwiegend familienbezogene Sozialarbeit geleistet.
In diesem Buch sollen für die Arbeit mit Familien notwendige Grundlagen vermittelt werden. Dazu werden ausgewählte Erkenntnisse von Historikern, Soziologen, Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeitern und Vertretern anderer wissenschaftlicher Disziplinen über die Geschichte der Familie (Teil 1), die Familie der Gegenwart (Teil 2) und häufige Familienprobleme (Teil 3) in komprimierter Form dargestellt. Dabei beschränken wir uns auf Forschungsergebnisse und Erfahrungen, die in der Bundesrepublik Deutschland gesammelt wurden.
Teil 1 Familie im Wandel
Die Formen der Familie, die wir aus persönlicher Erfahrung und Beobachtung kennen, sind im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert entstanden. Selbst der Familienbegriff - von der lateinischen Wortform "familia" abgeleitet - wurde erst um 1700 im deutschen Sprachraum heimisch. Er wurde anfangs sowohl zur Bezeichnung der Verwandtschaft als auch der Hausgenossenschaft verwendet, wobei er in der letztgenannten Bedeutung zusätzlich Gesinde, Lehrlinge, Gesellen, Schüler usw. umfasste. Zuvor waren Begriffe wie "Geschlecht", "Sippe", "Weib und Kind" sowie "Haus" üblich, die allerdings nicht genau das bezeichneten, was wir heute "Familie" nennen. Erst nach 1800 wurde unter dem Einfluss von Naturrecht, Aufklärung und Romantik der Familienbegriff immer mehr zur Bezeichnung der personalen und affektiven Beziehungen von durch Geschlechtsgemeinschaft (Ehe) und Elternschaft verbundenen Individuen verwendet. Diese langsame Begriffsveränderung spiegelt im Grunde den sich über mehrere Jahrhunderte erstreckenden gesellschaftlichen Wandel vom "ganzen Haus" des Mittelalters über die verschiedenen Familienformen des 19. Jahrhunderts bis hin zur tendenziell partnerschaftlichen Familie der Gegenwart wider.
Geschichte der Familie
Es soll nun die angedeutete Entwicklung nachgezeichnet werden. Dabei werden wir uns auf Familienformen des Mittelalters, des 19. Jahrhunderts und der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts beschränken. Aus dem Vergleich der verschiedenen Familientypen wird deutlich werden, dass "Familie" in höchst unterschiedlichen Erscheinungsformen auftritt und soziokulturell überformt ist. Auch werden einige Entwicklungstendenzen skizziert und "Mythen" über Familientypen der Vergangenheit aufgezeigt werden.
Familie im Mittelalter
Das circa ein Jahrtausend umfassende Mittelalter war keineswegs eine gleichförmige Epoche. So war das Frühmittelalter (6. - 9. Jahrhundert) durch Adels- und Grundherrschaft geprägt, unter der die meisten Menschen als Leibeigene oder unfreie Bauern (zu Naturalabgaben und Frondiensten verpflichtet), als Bedienstete oder Handwerker lebten. Große Landstriche, vor allem im Osten, wurden urbargemacht; viele Dörfer entstanden. Das durch Rittertum und Lehnswesengekennzeichnete Hochmittelalter (10. - 13. Jahrhundert) brachte die Auflösung der Großgrundherrschaft, die in Verbindung mit dem Vordringen von Geldwirtschaft und Handel zur Ausgabe des Grundbesitzes als Zinsgüter (meist Verpflichtung zur Zahlung einer Geldrente und zu Frondiensten) führte. Auch entstanden größere Städte, in denen Handwerker und Händler als freie Bürger lebten, wobei die Berufsausübung durch das Zunftwesen geregelt wurde. Im Spätmittelalter (14. - 15. Jahrhundert) kam es dann zum Aufstieg der freien Städte, zur Entstehung mächtiger Handelshäuser und zum Erstarken des Bürgertums.
Charakteristisch für das Mittelalter waren eindeutige Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnisse. Die meisten Menschen waren als Bauern von einem Grundherrn abhängig, der sich ihnen gegenüber entweder mehr fürsorgend und schützend oder mehr ausbeuterisch und willkürlich verhielt. Bei der Gründung einer Familie waren seine Untertanen nicht nur auf seine Zustimmung angewiesen, sondern er hatte auch das Recht, jeden unfreien Mann von circa 18 und jedes Mädchen von etwa 14 Jahren sowie jede Witwe zu verheiraten.
Abgesehen von genehmigten Liebesheiraten kam es aber zu solchen gegen den Willen des Grundherrn; in diesen Fällen mussten die Partner beziehungsweise deren Eltern vielerorts neben Ehesteuern Geldstrafen zahlen. Zunächst machten viele Grundherren von dem "jus primae noctis" Gebrauch, das eine zusätzliche Blutsbande zwischen ihnen und den Bauern schuf, Letztere aber auch demütigte und in ihrer Abhängigkeit bestätigte. Später wurde der Verzicht auf dieses Recht durch eine Abgabe abgegolten. Diese musste ebenfalls an Klöster und Kirchen gezahlt werden, deren Grundbesitz fortwährend wuchs.
Alle Menschen wurden in einen bestimmten Stand geboren und verblieben zeitlebens in ihm. Er prägte ihr Verhalten und ihre Lebensform. Auch innerhalb des jeweiligen Standes gab es eine hierarchische Ordnung - so bestimmte zum Beispiel die Größe des Hofes, wo ein Bauer in der Kirche oder Dorfwirtschaft saß, mit wem er Umgang pflegte, wen er heiraten konnte und welche Aussteuer von seinen zukünftigen Schwiegereltern erwartet wurde. Sitte und Tradition waren unangefochten, festigten die Gesellschaftsordnung, prägten Tun, Wollen und Gemüt des einzelnen. Die große einheitliche Ordnung des Lebens wurde durch das Erbe des Germanentums und der Antike, vor allem aber durch das Christentum bestimmt.
Die Kirche versuchte, auch auf Ehe und Familie Einfluss zu nehmen. Zunächst musste sie sich jedoch mit der aus spätrömischer Zeit stammenden Auffassung einer scheidbaren Konsensualehe, der haus- beziehungsweisegrundherrschaftlichen Ehehoheit und der auf altem germanischen Recht fußenden Praxis der "mundt-" Ehe abfinden, bei der alle vormundschaftlichen Rechte an einer Frau vom Vater auf den Ehemann übertragen wurde. So wurde ein Paar anfangs von den Vormündern vor der Kirchenpforte getraut; anschließend fand die Brautmesse im Innenraum statt. Ab etwa 1200 nahm der Priester die Trauung vor dem Kirchentor vor, während gleichzeitig die Laientrauung verboten wurde. Jedoch konnten auch noch zu dieser Zeit junge Menschen ohne den Segen der Kirche heiraten. Selbst Trauungen ohne Anwesenheit Dritter waren gültig, falls beide Partner die vorgeschriebenen Worte sprachen und zu ihnen standen. Erst auf dem Tridentiner Konzil von 1563 wurde die Ehe zu einem Sakrament erklärt. Damit erhielt die kirchliche Handlung den Rechtssinn der eigentlichen Eheschließung, die daraufhin gänzlich in das Innere des Gotteshauses verlegt wurde. Somit wurde die kirchliche Jurisdiktion über die Ehe erst zum Ende des Mittelalters verbindlich. Die von der Kirche geforderte Unauflöslichkeit der Ehe konnte aber schon früher durchgesetzt werden, da sie der vorherrschenden Praxis der Verbindung von Besitz durch den vernunftbestimmten Akt der Eheschließung beziehungsweise der Heiratspolitik des Adels entgegenkam.
Die offizielle Haltung der Kirche zu Ehe und Familie entsprach der Auffassung von Paulus. Er schrieb (1. Korintherbrief 7), dass die Ehe nur für diejenigen sei, die nicht zölibatär leben könnten. Somit wurde sie als etwas Zweitrangiges gegenüber dem Zölibat gesehen, das jedoch erst im 11. Jahrhundert für Priester verpflichtend wurde. Damit war eine "Verteufelung" der Sexualität verbunden, die im Zusammenhang mit der Erbsünde gesehen und als unrein betrachtet wurde. So sollten Eheleute ihren Geschlechtstrieb kontrollieren und ihre Beziehung bis auf die Kinderzeugung keusch gestalten. Auf der einen Seite wurde die geistige und moralische Minderwertigkeit der Frau betont, die - mit Bezug auf die Schöpfungsgeschichte - als Verführerin gesehen wurde. Die Verfolgung von Hexen, die ja nach damaliger Auffassung durch Geschlechtsverkehr mit dem Teufel zu solchen wurden, führte zu einer weiteren Abwertung der Frau. Generell wurde von ihr Gehorsam und demütige Unterwerfung gegenüber dem Mann sowie ein geduldiges Ertragen auch von Züchtigungen erwartet. Auf der anderen Seite wirkten sich Marienverehrung, die Betonung ehelicher Liebe sowie das Verbot des Ehebruchs und der Scheidung durchaus positiv auf die Stellung der Frau aus.
Letztendlich ist die Kirche jedoch im Mittelalter mit ihren Ehevorstellungen gescheitert. Zum einen musste sie sich mit heimlichen Ehen abfinden, da viele Männer und Frauen, die (aufgrund fehlender finanzieller Mittel) keine Familie gründen konnten oder (aufgrund fehlender Zustimmung des Grundherrn beziehungsweise der Gemeinde) durften, dennoch zusammenlebten. Zum anderen war Sexualität nicht privatisiert. Da viele nicht aus Liebe, sondern aufgrund materieller Beweggründe heirateten, suchten sie in außerehelichen Beziehungen sexuelle Erlebnisse. Auch diejenigen, die nicht heiraten durften, wollten natürlich auf sexuelle Bedürfnisbefriedigung nicht verzichten.
Nacktes oder halb nacktes Baden in Badehäusern sowie zunftmäßig organisierte Prostitution waren in der Stadt, Probenächte und "Fensterln" auf dem Lande üblich. Auch wurden schamlose Lieder gesungen sowie derbe Geschichten und Schwenke erzählt, wobei die Anwesenheit von Kindern keine Hemmungen erzeugte. Uneheliche Kinder waren zunächst den ehelichen gleichgestellt, erbten aber nicht den Stand des Vaters. Erst später wurden sie vor allem in der Stadt diskriminiert. Generell spielte die Liebe romantischer Art nicht eine so große Rolle wie heute. Ob es eine besondere Form der "höfischen Liebe" (Minne) gab, ist eine ungeklärte Frage geblieben; der Minnegesang wird zum Beispiel auch als eine zeittypische Art des dichterischen Ausdrucksbetrachtet.
Während in vielen Fällen Liebe, Leidenschaft und Entscheidungsfreiheit bei der Partnerwahl durchaus eine Rolle spielten, waren bei anderen Zuneigung, romantische Gefühle und Anziehungskraft ohne Bedeutung. Insbesondere bei Besitzenden bestimmte der Vater den zukünftigen Ehepartner, wobei er gelegentlich Brautwerber einsetzte. Jedoch gelang es manchem Sohn und mancher Tochter, sich dem Willen des Vaters erfolgreich zu widersetzen (obwohl dieser von Körperstrafen Gebrauch machen konnte), wenn ihnen der ausgewählte Partner nicht gefiel. Auch auf Wiederheiraten, die mehr als ein Viertel aller Eheschließungen ausmachten, konnten die Eltern kaum Einfluss nehmen.
Ausschlaggebend war, dass durch die Heirat der soziale und ökonomische Status der Familie erhalten blieb oder verbessert wurde. So spielten das von der Braut eingebrachte Vermögen beziehungsweise ihre körperliche Gesundheit, Tüchtigkeit und Arbeitskraft häufig die entscheidende Rolle. Im Ehevertrag zwischen den Elternpaaren wurden Sach- und Geldleistungen, bei Bauern auch Feld- und Gartennutzung oder die Benutzung des Altenteils genauestens geregelt. Bei abhängigen Bauern und Handwerksgesellen war die Heirat von der Zustimmung des Grundherrn beziehungsweise Zunftmeisters abhängig. Diese erfolgte zumeist erst dann, wenn der Mann den elterlichen Hof oder eine Meisterstelle übernehmen konnte. In größeren Ortschaften und Städten mussten Ärmere später oft auch die Genehmigung der Gemeinde einholen, die zur Armenunterstützung verpflichtet war und deshalb selbst bei festen Beziehungen oder trotz Vorhandenseins gemeinsamer Kinder die Eheschließung besitzloser Personen oft verbot. Falls eine freie Frau einen Leibeigenen heiratete, wurde sie zur Leibeigenen des Herrn - im umgekehrten Fall wurde der Mann meist nicht mehr als Bürger einer freien Stadt aufgenommen. So war durch die Eheschließung ein sozialer Aufstieg nicht möglich, sondern nur ein Abstieg. Für viele Frauen bedeutete die Hochzeit den bruchlosen Übergang aus der Herrschaft des Vaters in die des Ehemannes. Da adelige Mädchen oft schon mit acht Jahren verlobt und in der Regel im Alter von etwa 14 Jahren verheiratet wurden, hatten sie so gut wie kein Zustimmungsrecht bei der Auswahl des Partners durch die Väter. Bauern- und Handwerkertöchter heirateten jedoch meist erst weit nach Vollendung ihres 20. Lebensjahres, so dass sie eher ihren Willen durchsetzen konnten. Von allen Frauen wurde erwartet, dass sie die für sie vorgesehenen Arbeiten schnell und gut erledigen sowie viele Kindergebären. Anfangs richtete sich sogar ihr gesellschaftlicher Wert danach, ob sie noch gebären konnten - so war zum Beispiel im salfränkischen Volksrecht des 6. Jahrhunderts das Strafmaß für die Tötung einer gebärfähigen Frau dreimal so hoch wie für eine Frau nach der Menopause. Da die Ehefrau dem Mann untergeordnet war, war die Hausgemeinschaft des Mittelalters durch eine patriarchalische Struktur gekennzeichnet, die der Vorstellung einer hierarchisch gegliederten Weltordnung entsprach. Jedoch gelang es auch Frauen, innerhalb der Hausgemeinschaft eine machtvolle Position zu erreichen. Maßten sie sich aber an, ihre Ehemänner herumzukommandieren, standen den Dorfbewohnern beispielsweise Maßnahmen wie Haberfeldtreiben zu ihrer Disziplinierung zur Verfügung. Im Regelfall bestimmten aber die Männer über die Arbeitskraft und das Verhalten der anderen Familienmitglieder, des Gesindes oder der Gesellen. Die Hausväter besaßen den anderen Mitgliedern des "Hauses" gegenüber das Züchtigungsrecht, wovon viele auch ausgiebig Gebrauch machten. Manche kamen auch den mit ihren Rechten verbundenen Schutz- und Fürsorgepflichten nicht nach, sondern beuteten ihre Untergebenen schamlos aus.
Im Vergleich zur Kleinfamilie der Gegenwart war im Mittelalter das "Haus" der Bauern und Handwerker - mit diesen wollen wir uns zunächst beschäftigen, da nahezu die gesamte Bevölkerung diesen Gruppen zuzuordnen ist - eine Lebensgemeinschaft, die vielfach unverheiratete Verwandte, Gesinde, Lehrlinge und Gesellen umfasste. Seine Größe war abhängig von Faktoren wie zum Beispiel der Größe des Landbesitzes, dem Erbrecht, der Bodenbeschaffenheit oder der Konkurrenzsituation. Aufgrund der hohen Sterblichkeit und des späten Heiratsalters waren die meisten Haushalte recht klein und umfassten selten mehr als fünf Personen (große Altersunterschiede). Die Mitglieder dieser Lebensgemeinschaft wohnten zumeist in Häusern mit ein bis drei Räumen, von denen einer mit dem Vieh geteilt beziehungsweise als Arbeits- und Verkaufsstätte genutzt wurde. Somit lebten die verschiedenen Geschlechter und Altersstufen auf engstem Raum zusammen, schliefen zu mehreren in einem Bett und erlebten einander bei den intimsten Verrichtungen. Dementsprechend gab es keine Privatsphäre - aber auch nach außen hin mangelte es an einer klaren Abgrenzung: Das Haus stand immer für Nachbarn und Verwandte offen, die an allen größeren Ereignissen beteiligt waren und zusammen mit der Herrschaft, der Kirche und den Zünften eine starke soziale Kontrolle ausübten. Die Mitglieder der Hausgemeinschaft waren also in ein enges Beziehungsnetz eingebettet, in dem sie gefühlsmäßige Bindungen und sexuelle Kontakte fanden. Dementsprechend verbrachten sie Sonn- und Feiertage sowie ihre geringe Freizeit nicht daheim, sondern in der größeren Gemeinschaft des Dorfes oder des Stadtteils.
Im Gegensatz zur Familie von heute war das "Haus" des Mittelalters in erster Linie eine Produktionsstätte. Es diente der Existenzsicherung, der Erhaltung des Besitzes, der alltäglichen gegenseitigen Hilfe und der materiellen Versorgung der Alten und Kranken. Die gemeinsame Arbeit und Produktion als Zweck der Hausgemeinschaft prägten die zwischenmenschlichen Beziehungen; das Hausinteresse stand meist an erster Stelle. Somit war das "Haus" weniger eine sittliche Institution als eine Einrichtung zum Überleben. Dabei ist zu bedenken, dass im Mittelalter Ackerbau und Viehzucht noch unterentwickelt waren. Obwohl 70 bis 80% der Bevölkerung als zumeist abhängige Bauern lebten, reichten die von ihnen produzierten Lebensmittel gerade für den eigenen und den regionalen Bedarf. Meist befanden sie sich am Rande des Existenzminimums und litten immer wieder unter Hungersnöten, da aufgrund der geringen Marktverflechtung und der schlechten Transportmöglichkeiten nur selten Überschüsse aus anderen Regionen in das von einer Missernte, kriegerischen Auseinandersetzungen usw. betroffene Gebiet geschafft werden konnten. Auch in guten Zeiten konnte der eigene Bedarf nur dann gesichert werden, wenn alle Mitglieder des "Hauses", einschließlich der Kinder und alten Leute, an sechs Tagen in der Woche von Sonnenaufgang bis -untergang arbeiteten. Freizeit gab es nur an Sonn- und Feiertagen sowie in Arbeitspausen.
Somit waren die im "Haus" vorherrschenden zweckmäßigen Beziehungen für das Überleben unter der ständigen Bedrohung durch Krankheiten, Hungersnöte und Kriege wichtiger als gefühlsmäßige. Dementsprechend wurde eheliche Liebe vielfach als eine Form christlicher Nächstenliebe betrachtet, wurden außereheliche sexuelle Verhältnisse eher toleriert. Der "Familiensinn" war weniger stark ausgeprägt als in späteren Jahrhunderten, obwohl in manchen Zeugnissen aus der damaligen Zeit auch von engen emotionalen Banden zwischen Familienmitgliedern berichtet wird. In der Eltern-Kind-Beziehung spielten Gefühle eine geringere Rolle als heute - dabei ist jedoch zu bedenken, dass die meisten Kinder noch vor Erreichen des ersten Lebensjahres starben, so dass die Eltern zu ihrem Selbstschutz eine gewisse psychische Distanz wahren mussten. Die Tatsache, dass ein Säugling die ersten ein, zwei Lebensjahre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben würde, mag auch erklären, weshalb die Eltern beim Tod eines ihrer Kinder weniger Trauer zeigten: Er war ein durchaus "normales" Ereignis. Zudem konnte damit gerechnet werden, dass bald ein anderes Kind an die Stelle des Gestorbenen treten würde, da Methoden der Empfängnisverhütung unbekannt waren. Der häufigere Tod von Kindern und Müttern (insbesondere im Kindsbett) prägte auch die Familienstrukturen: So wuchs ein Großteil der Kinder mit Halb- und Stiefgeschwistern auf, gab es große Altersunterschiede zwischen ihnen.
Kinder wurden in erster Linie als zukünftige Arbeitskräfte und als Garanten der Altersversorgung der Eltern gesehen. Ihr "Wert" richtete sich stark nach ihrem Nutzen für die Produktionsgemeinschaft. Dementsprechend war die Dauer der Kindheit auf das zarteste Kindesalter beschränkt, das heißt auf den Lebensabschnitt, in dem Kinder noch nicht ohne fremde Hilfe auskommen können. Zumeist wurde auf ihre Pflege und Erziehung aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Eltern und einem fehlenden Bewusstsein für Erziehung nur wenig Zeit verwendet. Säuglinge blieben oft längere Zeit unbeaufsichtigt, so dass von Fällen berichtet wird, wo sie von frei herumlaufenden Hausschweinen gefressen wurden. Sobald Kinder laufen und von den Händen Gebrauch machen konnten, wurden sie übergangslos zu den Erwachsenen gezählt, trugen dieselbe Kleidung und teilten ihre Arbeit. In der Regel wuchsen Kinder unmerklich in ihren späteren Aufgabenbereich hinein, indem sie von Eltern, Gesinde und Verwandten frühzeitig zu Helferdiensten herangezogen wurden. So erfolgten Erziehung und Ausbildung durch das Zusammenleben mit Erwachsenen. Oft wurden aber auch Kinder im Alter von circa zehn Jahren an Verwandte oder Lehrherren fortgegeben, deren Alltags- und Arbeitsleben sie teilten. Dabei wurden sie nicht nur in einem Beruf und in häuslichen Diensten ausgebildet - auch Knaben mussten zum Beispiel den Tischdienst verrichten -, sondern eigneten sich auch die für ein Überleben in der mittelalterlichen Gesellschaft notwendigen Kenntnisse, Sitten und Erfahrungen an. Blieben erwachsene und verheiratete Söhne bei den Eltern wohnen, kam es oft zu Spannungen mit den Vätern, welche die Leitung der Hausgemeinschaft nicht aus der Hand geben wollten.
Bei Adeligen und reichen Bürgern verlief das Leben in anderen Bahnen. Sie wohnten in großen Häusern, die für die tagtäglichen Besuche von Verwandten, Bekannten und Geschäftspartnern immer offen standen. So war ein ständiges Kommen und Gehen, da sich Arbeit, Privatleben und gemeinschaftliche Vergnügungen nicht in getrennten Sphären, sondern nahezu immer im Haus abspielten. In ihm waren die einzelnen Räume nicht zweckgebunden, sondern gingen ineinander über. So konnten nahezu alle Zimmer für das Abwickeln von Geschäften, den Empfang von Gästen, das gemeinsame Mahl oder die Nachtruhe benutzt werden. Dementsprechend war das Mobiliar gestaltet: Beispielsweise wurden zusammenklappbare Tische zur Essenszeit aufgestellt oder Betten erst nachts aufgebaut. Auch im Adel und im reichen Bürgertum konnten sich also die Mitglieder des "ganzen Hauses" nicht voneinander absondern oder eine Privatsphäre ausgrenzen. Das Leben der Familienmitglieder wurde von Bediensteten, Verwaltern, Schreibern und Lehrlingen geteilt, die Teil einer umfassenden Gemeinschaft waren. Dementsprechend wurden zum Beispiel Diener nicht wie in späteren Jahrhunderten missachtet, sondern konnten mit einem gewissen Maß an Anteilnahme und Fürsorge rechnen. Jüngere Bedienstete, Lehrlinge und Kinder standen in einem engen Verhältnis zueinander, da sie beispielsweise miteinander spielten und vielfach ähnliche Aufgaben wie den Tischdienst zu erfüllen hatten.
Familie im 19. Jahrhundert
Die Auflösung der Lebensform des "Hauses" und die Entstehung moderner Formen der Familie im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert wurden durch Entwicklungen bedingt, die teilweise bereits im 16. Jahrhundert begannen. So wurde die Macht der Kirche geschwächt (Reformation ab 1517), geriet sie in Konkurrenz zu den sich verselbständigenden Wissenschaften (Kopernikus; Gründung der ersten Universitäten), zum Gedankengut der Antike (Renaissance) und zur Philosophie (Humanismus). Mit der Entdeckung der Individualität kam es zu einer stärkeren Hinwendung zur Welt und zur Betonung der Autonomie des persönlichen Ichs, des Innerlich-Subjektiven, der Selbstverantwortung und Lebenslust. Die mittelalterliche Ordnung löste sich langsam auf, mitbedingt durch die Ausschaltung des Ritterstandes (Ritterkrieg von 1522/23), die Schwächung zentraler Gewalten und die rasche Ausbreitung des städtischen Handels und Gewerbes. So entstanden reiche Patrizierfamilien, in denen bereits eine Trennung zwischen Arbeitsplatz und Haushalt eingeführt wurde und die Ehefrau eine rein repräsentative Funktion übernahm - eine Lebensordnung, die für die Familie des 19. Jahrhunderts in gewisser Weise zum Leitbild wurde. Allerdings gab es auch Patrizierfrauen, die während der Geschäftsreisen ihres Mannes die Firma führten und weiterhin einen Beitrag zum Familieneinkommen leisteten. Zugleich wurden Frauen erstmalig außerhalb der Familie als Mütter oder Geliebte von Königen bedeutsam.
Gleichzeitig begann sich die Stellung des Kindes zu ändern, da die Moralisten vermehrt seine zu schützende Unschuld, seine Erziehungsbedürftigkeit und die Notwendigkeit einer christlichen Erziehung betonten. Da Kinder Ebenbilder der Engel seien und von Jesus Christus besonders geliebt würden, müssten die Erwachsenen die Verantwortung für ihre Entwicklung übernehmen. Diese Bestrebungen wurden im 17. Jahrhundert verstärkt. Das moralische Interesse am Kind wandelte sich zu einem psychologischen (langsames Erkennen der Eigenart des Kindseins); Anstandsfibeln und Abhandlungen über Erziehung wurden publiziert; durch die Kritik an der Bevorzugung der Erstgeborenen wurde eine größere Gleichbehandlung von Geschwistern erreicht; die Eltern widmeten sich mehr der Formung von Seele, Geist und Körper ihrer Kinder. Damit verbunden war eine stärkere Wertschätzung und Emotionalisierung der Eltern-Kind-Beziehung. Zudem kam es zu einer Aufwertung der Familie durch die Kirchen, die sie mit der "Familie Christi" verglichen. Auch wurde mehr und mehr die Notwendigkeit einer schulischen Bildung betont, und in einigen deutschen Kleinstaaten wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, die jedoch noch häufig - vor allem auf dem Land - umgangen wurde. Im 17. Jahrhundert wurde die Kindheit als eine Übergangsphase zwischen Kleinkindheit und Erwachsenendasein entdeckt. Familie und Schule wirkten bei der Ausgliederung des Kindes aus der Erwachsenengesellschaft zusammen und definierten Kindheit als die Lebensphase bis zum Verlassen der Schule.
Diese Tendenzen verstärkten sich im 18. Jahrhundert, einer besonders "pädagogischen" Epoche (Aufklärung, Philanthropen, deutsche Klassik, Neuhumanismus). Das Bürgertum erkannte in der Bildung den Weg zu Mündigkeit, Autonomie und einem vernunftbestimmten Leben sowie ein Mittel zum gesellschaftlichen Aufstieg. So bemühte es sich um das schulische Fortkommen der männlichen, vereinzelt auch der weiblichen Kinder. Diese Entwicklung führte zu immer enger werdenden Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie zu mehr affektiver Nähe, aber auch zu Sittenstrenge und Disziplin. Die Kinder sollten möglichst lange von der verderbten Welt der Erwachsenen fern gehalten werden. Familiensinn und Sinn für die Kindheit nahmen mehr oder mindergleichzeitig zu; der Familienbegriff mit seiner Betonung personaler und emotionaler Aspekte setzte sich durch.
Es kam jedoch nicht zur Neubestimmung der Eltern-Kind-Beziehung, sondern auch zu einer neuen Sicht der Ehebeziehung: Die intensivere Beschäftigung mit dem Naturrecht - ihrerseits Ausdruck der wachsenden Säkularisierung und Aufklärung - führte dazu, dass die Eheschließung wieder als ein Akt des weltlichen bürgerlichen Rechts, als ein aus freiem Willen der Partnererfolgender Vertragsabschluss verstanden wurde. Auch in der Aufklärung wurden die Selbstbestimmung und die Rechte der Frau betont. So sah zum Beispiel Kant im Ehevertrag ein "moralisches Institut", in dem die Partner frei und ungezwungen den gegenseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften zum gemeinsamen Genusse vereinbarten. Dieses wurde als Zweck und Wesen der Ehe betrachtet - also nicht mehr zum Beispiel die Erhaltung und Vermehrung des Besitzes oder die zweckmäßige Verbindung zweier Familien. Die Humanisierung der Ehebeziehung wurde durch die Romantik verstärkt, die in der Gemütsverbindung, im ganzheitlichen Einswerden von Mann und Frau sowie in der Versöhnung der gegensätzlichen Pole des Männlichen und Weiblichen das Wesentliche sah. Aus der Forderung, dass Ehe immer nur eine Liebesehe (Schlegel) sein sollte, folgten die Befürwortung einer freien Partnerwahl, die Aufwertung des Status der Frau und eine größere Akzeptanz des Körperlichen und Sexuellen. Freiheit (der Partnerwahl) und Gleichheit (der Geschlechter) waren auch Forderungen der französischen Revolution. Jedoch sollte es noch viele Jahrzehnte dauern, bis sich diese Vorstellungen endgültig durchsetzten.
Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der beginnenden politischen Revolution und Emanzipation des Bürgertums, das zu einer immer stärkeren Bevölkerungsgruppe wurde. Und es sah den Anfang der industriellen Revolution, die auf dem Gebiet der deutschen Kleinstaaten jedoch erst im 19. Jahrhundert richtig einsetzte. Sie führte zur Entstehung der Arbeiterschaft als einer neuen Klasse, deren Leben durch Lohnabhängigkeit, rücksichtslose Ausbeutung, Entpersönlichung der Arbeit (Auswechselbarkeit), festgelegte Arbeitszeiten ohne größere Pausen, Kontrolle und Disziplinierung gekennzeichnet war. Da die Industrie auch qualifizierte Fachkräfte benötigte, kam es bald zu einer Differenzierung zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern. Vor allem Letztere waren so schlecht bezahlt, dass sie auf die Mitarbeit von Frauen und Kindern angewiesen waren. So waren zum Beispiel 1882 540.000 Frauen und 520.000 Kinder unter 14 Jahren, 1907 bereits l.560.000 Frauen, aber nur noch 280.000 Kinder in der Industrie tätig. Im letztgenannten Jahr waren schätzungsweise weitere 300.000 Kinder unter 14 Jahren in der Heimarbeit beschäftigt (Hubbard 1983; Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1987).
Die neuen Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Schulwesenermöglichten vielen einen raschen gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung und Unternehmergeist. Zur vertikalen Mobilität kam in Verbindung mit der Urbanisierung die horizontale. So kamen 1849 auf 100 Städter 300 Landbewohner, 1900 nur noch 84 (Reble 1971). Auch entstanden die ersten Großstädte (Anonymität als neue Lebenserfahrung). Die zunehmende Komplexität und Differenzierung der Gesellschaft führten zu veränderten Sitten und zur Zivilisierung (Notwendigkeit von Selbstbeherrschung, Disziplin, Triebbeschränkung, guten Manieren usw.). Gleichzeitig kam es zu wachsenden Klassenunterschieden und einer größeren Trennung der Lebensräume. Die große Armut der Arbeitslosen und Bettler - in Bayern lebten 1800 circa 7% der Bevölkerung vom Betteln, fand um 1850 eine intensive Diskussion über den "Pauperismus" statt, wurde mehr und mehr der vierte Stand, das Proletariat, als Bedrohung erlebt - kontrastierte mit der Amüsierlust, dem luxuriösen Überschwang und der Eleganz des reichen Bürgertums zur Jahrhundertwende.
Ferner wurde eine umfassende säkulare Rechtsordnung durch den modernen Staat geschaffen. So wurde generell die Zivilehe eingeführt, beispielsweise im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung war die Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1900. Hier wurde die Ehe als eine Lebensgemeinschaft definiert, in welcher der Mann über alle das gemeinsame Leben betreffenden Angelegenheiten entscheiden durfte, prinzipiell der Frau Unterhalt gewähren musste und alleine ihre Vermögen verwalten konnte, sofern ein Ehevertrag nicht eine andere güterrechtliche Regelung festlegte. Die Frau war verpflichtet, das Hauswesen zu leiten und eventuell im Geschäft des Mannes mitzuarbeiten. Sie besaß im Prinzip die volle Prozess- und Geschäftsfähigkeit, Letztere konnte aber teilweise vom Mann eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Eine Scheidung war möglich, wenn sich ein Ehegatte des Ehebruches schuldig machte, den anderen böswillig verließ, ihm nach dem Leben trachtete, seine Pflichten schwer verletzte oder sich ehrlos und unsittlich verhielt. Ein allein für schuldig erklärter Mann hatte der Frau grundsätzlich nach der Scheidung standesgemäßen Unterhalt zu gewähren; im umgekehrten Fall musste die Frau jedoch nur dann den Mann unterhalten, wenn er nicht arbeitsfähig war. Im Bürgerlichen Gesetzbuch wurde also eine Benachteiligung der Fraufestgeschrieben. Durch die in den Gesetzesbestimmungen festgelegte patriarchalische Familienstruktur wurde auch die Eltern-Kind-Beziehung geregelt. So war einerseits nur der Vater berechtigt, die Kinder rechtlich zu vertreten und zu züchtigen, ihr Vermögen zu verwalten und dieses zu nutzen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern bezüglich der Erziehung hatte laut Gesetz die Auffassung des Vaters den Vorrang. Dieser war andererseits verpflichtet, für die Kinder zu sorgen, sie zu erziehen und zu beaufsichtigen sowie Töchtern eine angemessene Aussteuer zu gewähren. Kinder mussten laut Gesetz bis zum Erreichen der Volljährigkeit (mit 21 Jahren) den Eltern gehorchen sowie in ihrem Hauswesen und Geschäft mitarbeiten.
Diese gesetzlichen Veränderungen und die Lohnarbeit ermöglichten eine freie Partnerwahl - eine Zustimmung der Eltern oder anderer Personen war nicht mehr notwendig. Allerdings dauerte es oft lange, bis die materiellen Grundlagen zur Familiengründung gegeben waren. So betrug zum Beispiel zwischen 1881 und 1886 das durchschnittliche Heiratsalter von Männern in Preußen 33,4 Jahre bei Beamten, 32,5 Jahre im Kirchendienst, 30,9 Jahre in Handel und Versicherung, 30,0 Jahre in der Textilindustrie, 29,6 Jahre in der Landwirtschaft, 28,6 Jahre im Baugewerbe und 27,7 Jahre bei Fabrikarbeitern (Hubbard 1983). Aufgrund des hohen Heiratsalters, der immer noch - im Vergleich zu heute - großen Kindersterblichkeit und der niedrigen Lebenserwartung blieben die Familien recht klein. Wohl gab es fünf bis sechs Geburten je verheirateter Frau (auf dem Land tendenziell mehr als in der Stadt), aber zumeist starben noch mehr als ein Drittel der Kinder (Schlumbohm 1983). Da aufgrund der langen Stillzeit der durchschnittliche Abstand zwischen Geburten zwei Jahre betrug, trennten erst- und letztgeborenes Kind oft mehr als 10 bis 15 Jahre.
Aufgrund des in Relation zu heute geringen Einkommens - so verdienten 1907/08 nach einer Erhebung des Kaiserlichen Statistischen Amtes Arbeiter circa 1.800 M, Mittlere Beamte 2.900 M und Lehrer 3.300 M jährlich, mussten diese zwischen 35 und 50% ihres Verdienstes allein für Nahrungsmittel (ein Huhn kostete zum Beispiel 2,25 M, 1 Pfund Rindfleisch 0,80 M) ausgeben (Schuhmacher 1910; Hubbard 1983). Auch waren die Wohnverhältnisse, vor allem in den Städten, sehr beschränkt. Beispielsweise lebten 1895 in München etwa 67% der Lohnarbeiter mit ihren Familien in Wohnungen mit nur einem heizbaren Zimmer, nur etwa 26% hatten zwei Räume zur Verfügung. Gehilfen in Handel, Bankwesen und Verkehr lebten zu 63% und Gehilfen im Gewerbe zu 84% mit ihren Familien in Ein- oder Zweizimmerwohnungen. Selbständige wohnten hingegen zu mehr als 50% in Wohnungen mit drei und mehr heizbaren Räumen (Hubbard 1983).
Aufgrund der großen Klassenunterschiede und der höchst verschiedenen Lebensweisen im 19. Jahrhundert ist es sinnvoll, grob vier Familienformen zu unterscheiden. Zunächst sollen bürgerliche Familien beschrieben werden, deren Erscheinungsbild unseren Eindruck von dieser Epoche besonders stark prägt. Dann werden Charakteristika von adligen, Arbeiter- und Bauernfamiliendargestellt werden.
Das Bürgertum des 19. Jahrhunderts war keine homogene Gruppe: Es umfasste das alte Patriziertum, Kaufleute, Akademiker, Beamte, Offiziere und reiche Handwerker. Nur ein Teil dieser Personengruppen lebte ohne finanzielle Sorgen und materielle Einschränkungen, konnte sich zum Beispiel große Wohnungen und Dienstboten leisten. Dennoch wurde ihre Lebensweise zum Vorbild und Maßstab für den größten Teil der Bevölkerung. Die bürgerliche Kultur war durch eine hohe Wertschätzung der Bildung, des konservativen Gedankenguts (vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts) und der humanistischen Ideale des Wahren, Guten und Schönen gekennzeichnet. Die Bürger sprachen einander mit Titeln und Amtsbezeichnungen an; die Anredeform "Sie" setzte sich durch. Autoritätsdenken paarte sich mit Fortschrittsglauben.
Charakteristisch für die bürgerliche Familie war die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Der Mann übte in der Regel seinen Beruf außerhalb des Hauses aus und war alleine für das Familieneinkommen verantwortlich. Die Frau war nicht mehr in die arbeitsteilige Wirtschaftsordnung der bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts typischen Hausgemeinschaft integriert, verlor ihre produktiven Aufgaben und wurde stärker vom Mann abhängig. Zudem wurde sie aus der Berufsweltausgeschlossen. Ihre Funktion reduzierte sich auf die Pflichten der Hausfrau und Mutter. In ärmeren Bürgerfamilien versorgte sie den Haushalt, hielt durch sparsame Wirtschaftsführung das Familieneinkommen zusammen und musste oft ein Ausgabenbuch führen, das vom Mann regelmäßig geprüft wurde. In reicheren Familien wurde die Frau zur Dame und verbrachte den Tag mit der Beaufsichtigung der Dienstboten und mit vornehmem Müßiggang. Das Hauspersonal nahm jetzt nicht mehr am Familienleben teil, sondern wurde in Nebenräume verwiesen und nur noch bei Bedarf über Klingelanlagen herbeigerufen. Die großen Bildungsunterschiede, die Ausbildung schichtspezifischer Normen, der wachsende Standesdünkel und die zunehmende Geringschätzung körperlicher Arbeit begründeten und symbolisierten die wachsenden Statusunterschiede. Auch sahen sich Bürgerfamilie nicht mehr zur Fürsorge verpflichtet, da Dienstboten einen Arbeitsvertrag erhielten und zu Lohnempfängern wurden.
Die Bestimmung der Frau zur Gattin, Hausfrau und Mutter wurde durch biologische Unterschiede erklärt und mit "wissenschaftlichen" Forschungsergebnissen über ihre seelische und sittliche Minderwertigkeit begründet. Es wurde von ihr erwartet, dass sie sich in erster Linie um das persönliche Wohl der Familienmitglieder, insbesondere des Mannes, sorgt, sich diesem unterordnet, sanftmütig, liebreizend, zart und schwach ist. Während einerseits die eheliche Liebesbeziehung idealisiert wurde, war andererseits das Thema "Sexualität" tabu. So zeigten sich die Ehepartner einander nicht nackt. Zudem wurde von einer gesitteten Frau erwartet, dass sie ihren unbekleideten Körper nicht betrachtet: So musste sie zum Beispiel beim Baden Sägespäne auf das Wasser streuen. Die Tabuisierung der Sexualität wurde auch durch die Wissenschaft gefördert, die vor zu häufigem Geschlechtsverkehr und vor der Onanie warnte. Die Schattenseite dieses Verhaltens war nicht nur die doppelte Moral der Männer, die sich im Besuch von Bordellen und im Kauf pornographischer Luxusausgaben zeigte, sondern auch die mangelnde geschlechtliche Befriedigung beider Partner.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs tendenziell die Zahl von bürgerlichen Frauen, die mit ihrer Rolle unzufrieden waren. Sie fühlten sich diskriminiert, weil Hausarbeit und Kindererziehung nur als Liebesdienst angesehen wurden - als etwas, was unproduktiv und nichts wert sei (das Geld wurde zum Maßstab aller Dinge). Zudem gerieten sie als Erzieherinnen immer mehr in Konkurrenz zur Schule. So widmeten sich viele Frauen der Selbsterforschung, versuchten, als Schriftstellerinnen, Dichterinnen oder Malerinnen aus ihrer unbefriedigenden Situation auszubrechen, oder schlossen sich der erstarkenden Frauenbewegung an. Diese trug auch dazu bei, dass Mädchen "aus besseren Kreisen" eine umfassendere Schulbildung erhielten, die Universität besuchen konnten und bestimmte Berufe - vor allem im Bildungs- und Sozialbereich - ergreifen durften.
Die meisten Frauen verwendeten ihre Kräfte aber auf die Ausgestaltung des Heims und die Schaffung eines gefühlsbetonten Familienklimas. Die Wohnungen nahmen eine andere Form an als in den vorausgegangenen Jahrhunderten: Die meisten Räume waren nur noch von einem Flur aus zugänglich, gingen also nicht mehr ineinander über. So ermöglichten sie es einzelnen Familienmitgliedern, sich zurückzuziehen und abzukapseln. Die Ausgrenzung einer Privatsphäre wurde noch dadurch gefördert, dass nun im Gegensatz zu früher die Räume zweckbestimmt waren: Es gab Schlaf- und Kinderzimmer, die Putzstubebeziehungsweise den Salon, das Herrenzimmer und separate Räume für das Personal. Die Wohnung wurde geschmackvoll eingerichtet; zum Beispiel wurden die Fußböden mit Teppichen belegt, die gute Stube mit Sofa, Blumentischchen, Vitrinen (mit feinem Porzellan) und Seitentischchen (mit Nippes)ausgestattet, prunkten im Salon Sekretär, Pianoforte oder Flügel. Zugleich wurde diese häusliche Idylle immer mehr von der Außenwelt abgeschirmt. So gab es nur noch bestimmte Empfangstage, fanden Besuche nur noch auf Einladung oder nach Voranmeldung statt, wurden persönliche Kontakte durch briefliche ersetzt. Die Abgrenzung von gesellschaftlichem, beruflichem und Privatleben erfolgte auf Kosten verwandtschaftlicher, freundschaftlicher und nachbarschaftlicher Kontakte - diese Entwicklung wurde aber teilweise durch das Aufkommen von Kaffeehäusern, Stammtischen, Vereinen und Zirkeln als Ort zwischenmenschlicher Kontakte kompensiert. Zugleich förderte die für die bürgerliche Familie so typische Privatheit die Ausbildung enger gefühlsmäßiger Bindungen, die Entstehung von häuslicher Intimität, Familiensinn und -identität. Die Familienmitglieder verbrachten mehr Zeit miteinander; das Dämmerstündchen wurde zum Plaudern und Märchenerzählen genutzt; am Wochenende wurden gemeinsam Ausflüge unternommen, Cafes besucht oder Museen besichtigt. Die Auseinanderentwicklung von (gefühlsbetonter) Familienwelt und (durch Konkurrenzkampf, Rationalität und Materialismus geprägter) Außenwelt wurde nur von wenigen Zeitgenossen als Paradoxieerkannt.
In der bürgerlichen Familie war die Kindererziehung von besonderer Bedeutung. In der Säuglingspflege war sie die Erste, welche die von Ärzten und Pädagogen vorgetragene Kritik am Ammenwesen und am Wickeln berücksichtigte. Sie erkannte auch als Erste die Bedeutung von Schule und Universität. Die Eltern erörterten gemeinsam Erziehungsfragen, lasen mit Interesse entsprechende Zeitschriftenartikel und kauften Standardwerke der Pädagogik. Obwohl die Erziehungsaufgabe in erster Linie der Mutter zugeschrieben wurde, da sie wegen der hoch angesehenen und für einen elementaren weiblichen Triebgehaltenen Mutterliebe zu dieser Tätigkeit prädestiniert sei, übernahmen auch immer mehr Väter erzieherische Funktionen. So wurde die Kinderstube zu einem Ort umfassender Erziehung und moralischer Einwirkung. Mit Liebe und Strenge (Körperstrafen wurden von der Gesellschaft akzeptiert) versuchten die Eltern, ihre Kinder zur Beherrschung der Begierden, zu einem gesitteten Betragen, zu Höflichkeit, Lernbereitschaft, Ordnung, Sauberkeit und Gehorsam zu bewegen. Eine sexuelle Aufklärung fand nicht statt; auch führte die Einrichtung von Kinderzimmern zur Isolierung von der elterlichen Sexualität. Die Masturbation wurde schwer bestraft und durch Fesseln zu verhindern versucht.
Aufgrund der Beschränkung der Geburtenzahl, der hohen materiellen Investitionen (Schulgeld) und der emotionalen Bindung wurden Kinder unersetzlich. Die Eltern sorgten sich mehr um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen, wandten sich ihnen voller Liebe zu und freuten sich am Zusammensein mit ihnen. Sie begannen, mit ihnen zu spielen, erfanden anonyme Gabenbringer wie Nikolaus und Osterhase, gestalteten Weihnachten und Ostern zu Kinderfesten aus. Im 19. Jahrhundert setzte sich eine besondere Kleidung für Kinder durch, kam es zu einer Blüte des Kinderbuches und Märchens, begann die Massenproduktion von Spielzeug - obwohl um 1900 noch schätzungsweise 75 bis 80% aller Kinder keine Spielsachen besaßen. Auch wenn bereits Anredeformen wie "Mutter" und Diminutive aufkamen, blieb im Vergleich zu heute noch eine gewisse Distanz zwischen Eltern und Kindern bestehen. So mussten erstere in der Regel noch mit "Sie" angeredet werden.
Die Erziehung in der bürgerlichen Familie war stark geschlechtsspezifisch geprägt. Da die Bestimmung der Frau die Ehe war, besuchten Mädchen zunächst nur wenige Jahre lang die Schule; später gewannen Lyzeen, Pensionate und Schulen für "höhere Töchter" an Bedeutung. Generell war die Erziehung darauf ausgerichtet, dass das Mädchen einen Haushalt führen, schwierige Handarbeiten ausüben, dem Mann das Leben versüßen und in der Gesellschaft mit Bildung, französischer Konversation und Talenten wie Klavierspiel und Gesang glänzen konnte. Kam eine Tochter ins heiratsfähige Alter, unterhielten die Eltern einen ausgiebigen Gesellschaftsverkehr (Tanztees, Hausbälle), um sie mit passenden jungen Männern bekannt zu machen. Oft wurden Ehen nocharrangiert, wobei - abgesehen von lieblosen Geldheiraten - aber großer Wert auf die Meinung der Tochter gelegt wurde. Wenn das Einkommen des Auserwählten noch nicht gesichert war, kam es zu langen Verlobungszeiten. Genauso wie eine verheiratete Frau vor Scheidung sicher war, konnte sich eine verlobte auf das Wort des Mannes verlassen, da die Auflösung einer Ehe oder einer Verlobung gesellschaftlich geächtet wurde. Unverheiratete Frauen blieben zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei den Eltern beziehungsweise bei Verwandten wohnen oder zogen in ein Damenstift. Erst später wurde in solchen Fällen eine Berufstätigkeit üblich und akzeptabel.
Das Leben der Adligen auf dem Lande wurde im ausgehenden 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch ihre Stellung als Grundherren bestimmt. So zogen sie einen wesentlichen Teil ihres Einkommens aus den Diensten und Abgaben der Bauern. Auch repräsentierten sie ihnen gegenüber Macht, Überlegenheit und Wohlhabenheit. Selbst wenn sie an Dorf- oder Kirchenfesten teilnahmen, wahrten sie immer eine vornehme Distanz. Schon kleine Kinder von Adeligen hoben sich durch Kleidung und herrschaftliche Umgangsformen von der Dorfjugend ab. In der Stadt übte der Adel einen großen Teil der Staatsmacht aus. Er nahm Einfluss auf die Landstände, besetzte die höchsten Positionen in Verwaltung und Heer, umgab Kaiser und Könige am Hof. Die eigene gesellschaftliche Stellung wurde aufwendig repräsentiert; die verschwenderische Repräsentation führte in ihrer Folge oft zu Verarmung. Zudem waren die Sitten in der Stadt freier, gab es mehr Zügellosigkeit als auf dem Lande. Jedoch wurde auch in der Stadt großer Wert auf kultivierte Umgangsformen, Körperbeherrschung und einen verfeinerten Lebensstil gelegt.
Die Familien Adliger blieben im 19. Jahrhundert patriarchalisch strukturiert. Der Mann stand dem Hause vor und konnte unbedingten Gehorsam seitens der Frau, der Kinder und der Dienerschaft erwarten. Er repräsentierte eine lange Familientradition, deren Bedeutung zum Beispiel durch die Ahnengalerieversinnbildlicht wurde und die immer wieder durch das Erzählen der Taten großer Vorfahren lebendig gemacht wurde. So war der Einzelne ein Glied in einer langen Kette von Personen und gewann daraus einen Teil seiner Identität. Er war auf den Platz seiner Familie in der regionalen Geschichte stolz und wollte ihr in der Regel alle Ehre machen. Die adlige Frau war wohl einerseits Herrin des Hauses und des Gesindes, andererseits aber dem Mann klar unterstellt. Die Eltern nahmen großen Einfluss auf die Partnerwahl ihrer Tochter; konnten sie ihr keine angemessene Mitgift geben, kam sie eventuell schon mit zehn oder zwölf Jahren in ein Damenstift. Wenn eine Frauunverheiratet blieb, nahm sie eine besonders niedrige Stellung in der Gesellschaft ein.
Die Kinder waren ihren Eltern untergeordnet; meist wurde von ihnen strikter Gehorsam verlangt. In der Regel wurden sie von Hauslehrern, Gouvernanten und Hofmeistern erzogen, da sich die Eltern nur wenig um sie kümmern konnten. Deshalb kannten diese vielfach die Bedürfnisse, Sorgen und Nöte ihrer Kinder nicht. Die Kinder wurden von Anfang an in die herrschaftliche Lebensführung eingeübt, wobei das Lernen durch Beispiel und Nachahmung eine große Rolle spielte. So lernten sie von klein auf das Befehlen, waren sie doch immer von diensteifrigem Personal umgeben. In ihrer Erziehung waren Tanzen, Reiten, Jagen und Fechten von großer Bedeutung, da sie einen Teil der adeligen Lebensweise bildeten. Wissensvermittlung wurde hingegen für weniger wichtig erachtet; der Adlige sollte nicht zu einem bürgerlichen Gelehrten herangebildet werden. So wurde auch auf ein vertieftes Fachstudium wenig Wert gelegt, falls der Sohn eines Adligen eine Universität besuchen sollte. Jedoch galt eine "Kavalierstour" als empfehlenswert, bei der er auswärtige Höfe besuchte, dort Kenntnisstand und Umgangsformen verbesserte und wichtige Beziehungen knüpfte. Generell lernte der junge Adlige, die für ihn vorgesehenen Aufgaben zu übernehmen, indem er sie unter der Anleitung seines Vaters ausübte und diesen nachahmte. Die geschlechtsspezifische Sozialisation war im Adel sehr stark ausgeprägt. So wurde auf die Erziehung der Mädchen weniger Wert gelegt.
Ähnlich wie im Bürgertum gab es auch in der Arbeiterschaft verschiedene Familienformen, was teilweise durch das unterschiedliche Einkommen mitbedingt wurde. In dieser Schicht kam es aber sehr viel seltener vor, dass der Mann ausschließlich die Rolle des Ernährers und die Frau die Aufgaben der Haushaltsführung und Kindererziehung übernahm. So waren vor allem Heimarbeiter zum Überleben auf die Mitarbeit von Frauen und Kindern angewiesen. Dieses Berufsfeld entstand mit der Ausbreitung des Verlagssystems im 18. Jahrhundert und gewann hauptsächlich in ländlichen Regionen mit Realteilung in der Erbfolge an Bedeutung. Aufgrund des Erbrechts gab es hier nämlich viele kleine Höfe, deren Ertrag nicht mehr einer Familie als Existenzgrundlage ausreichte. Die Verleger boten diesen Familien durch die Lieferung von Rohmaterial und Arbeitsgeräten sowie durch die Abnahme der Endprodukte die Möglichkeit eines Nebenverdienstes an.
Zunächst wurden Einzelteile für die Textilindustrie, später vor allem hölzerne Gegenstände und Spielzeug hergestellt. Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch die industrielle Massenproduktion und des deswegen immer niedriger werdenden Einkommens verschlechterten sich Arbeits- und Lebensbedingungen der Heimarbeiterfamilien im Verlauf des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So waren schließlich alle Familienmitglieder gezwungen, 12 bis 16 Stunden täglich und auch an Sonntagen zu arbeiten - oft unter unhygienischen Bedingungen, umgeben von unangenehmen Dünsten und Gerüchen. Zudem standen ihnen zumeist nur ein bis zwei Räume in ihren kleinen Behausungen zur Verfügung, so dass sie in demselben Zimmer arbeiteten, schliefen, kochten und aßen. Die Ernährung war teilweise sehr schlecht und bestand nahezu ausschließlich aus Kartoffeln, sofern sie nicht nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft versorgten.
Dennoch bot die Heimarbeit vielen besitzlosen Menschen die Möglichkeit, eine eigene Familie zu gründen und zu ernähren. Da junge Männer und Frauen ein eigenes Geldeinkommen erwirtschafteten, waren sie bei der Partnerwahl nicht mehr auf die Zustimmung ihrer Eltern angewiesen, konnten sie früher heiraten und die Liebe zum entscheidenden Kriterium ihrer Wahl machen. Aufgrund ihrer größeren Unabhängigkeit und Selbständigkeit lebten sie nach der Heirat oft von den Eltern getrennt, so dass sich in dieser Bevölkerungsgruppe nur selten Dreigenerationenfamilien fanden. Haushalt und Arbeitsplatz bildeten vielfach noch eine Einheit; eine starre geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gab es nicht, da die Familienmitglieder ähnliche Tätigkeiten ausübten. Dementsprechend besaß der Ehemann auch weniger Autorität als in der bürgerlichen oder Bauernfamilie. Da die Kinder frühzeitig zur Mitarbeit herangezogen wurden, blieben für Erziehung und Unterricht wenig Zeit.
Die Industriearbeiter rekruierten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zumeist aus nicht erbberechtigten Männern und Frauen aus ländlichen Regionen mit Anerbenrecht (hier gab es nur einen Hoferben). Sie verbrachten 12 bis 14 Stunden pro Tag am Arbeitsplatz, hatten nur am Sonntag frei (zu Beginn des Jahrhunderts vereinzelt aber noch nicht einmal an diesem Tag), waren Lärm, Gestank, Hitze und den Schikanen ihrer Vorgesetztenschutzlos ausgesetzt. Auch lebten sie in ständiger Sorge um ihren Arbeitsplatz; Kündigung, Unfall, Krankheit oder Tod waren Katastrophen, die manche Familien in Armut und Elend führten. Aufgrund des geringen Einkommens ihrer Männer, vereinzelt aber auch wegen deren Trunksucht, mussten viele Frauen als Fabrikarbeiterinnen, Zugehfrauen, Wäscherinnen oder Heimarbeiterinnen berufstätig sein. So ergab eine 1899 von Otto (nach Hubbard 1983) in Oberbayern durchgeführte Befragung von 1.253 Müttern, dass 496 in der Fabrik arbeiteten, weil der Mann zu wenig verdiente, 317, weil er zum Haushalt nichts beitrug, 219, um besser leben zu können, 120, um Geld zu sparen oder Schulden abzuzahlen, 95, um Angehörige zu unterstützen - nur sechs waren ohne zwingenden Grund berufstätig. Der Arbeitslohn diente also nicht der Emanzipation oder Selbstverwirklichung der Frau, sondern war für das Überleben der Familie unverzichtbar. Meist wurden Frauen als billige Arbeitskräfte ausgenutzt und lebten in ständiger Angst vor Schwangerschaft und Krankheit. Unverheiratete Frauen bekamen oft nichteheliche Kinder - und mussten wie diese Diskriminierung und Stigmatisierung ertragen.
Es ist offensichtlich, dass sich unter diesen Bedingungen Arbeits- und Familienleben kaum miteinander vereinbaren ließen und wenig Zeit für Kinder blieb. Säuglinge wurden schnell abgestillt und dann von größeren Geschwistern betreut, die vielfach auch den Haushalt führen mussten. So nahm die Säuglingssterblichkeit in industriellen Ballungszentren entgegen der allgemeinen Entwicklung zu, war sie von der sozialen Stellung der Eltern abhängig: Beispielsweise starben in der Textilstadt Augsburg von 1871 bis 1873 65% der Fabrikarbeiterkinder im ersten Lebensjahr gegenüber 43% der Kinder aus der übrigen Bevölkerung (nach Peikert 1982). Zudem wurden kleinere Kinder häufig vernachlässigt und sahen vielfach ihre Eltern nur am Sonntag. So ergab zum Beispiel die oben erwähnte Befragung von Otto auch, dass 1899 924 Kinder der befragten Fabrikarbeiterinnen von Verwandten (oft im Haus lebende Großeltern), 571 von Fremden und 553 in Anstaltenbetreut wurden; 27 blieben ohne Aufsicht. Ältere Kinder spielten stundenlang auf der Straße oder organisierten sich in Banden. Die Gefährdung durch Verwahrlosung führte dazu, dass immer mehr Kinderbewahranstalten, Kleinkinderschulen und Kindergärten entstanden, die häufig durch eine Stiftung gegründet wurden und oft zu ihrem Unterhalt auf Spenden angewiesen waren. Viele Kinder mussten auch bis zu 12 Stunden in Fabriken arbeiten -eine Berufstätigkeit von Kindern unter neun Jahren wurde beispielsweise in Preußen erst 1839 und in Bayern ein Jahr später verboten. Die Kinderarbeit ging erst nach 1871 zurück, als die zunehmende Mechanisierung der Industrie Hilfskräfte weitgehend unnötig machte.
Der Lebensstandard von Arbeiterfamilien war von der Ausbildung und dem Beruf des Mannes, der Arbeitsmarktlage, der Zahl der Erwerbstätigen und der Familiengröße abhängig. Den einen Pol des Spektrums bildeten gutgestellte Familien, die in Wohnungen mit mehreren Zimmern lebten und in denen entsprechend dem bürgerlichen Familienideal (durch Schule, Zeitschriften und Anschauung auch in den unteren Schichten verbreitet) die Mütter daheim bleiben und die Kinder versorgen konnten. Den anderen Pol bildeten arme Familien, in denen ein Ernährer durch Krankheit, Unfall oder Tod ausgefallen war und die in Einzimmerwohnungen oder feuchten Kellern hausten. Oft mussten sie noch Untermieter oder Bettgeher aufnehmen, um die durch Wohnungsnot und Spekulantentum verteuerten Mieten zahlen zu können. Die übergroße Enge und das Fehlen einer Privatsphäre führten leicht zu Spannungen und Aggressivität, die unhygienischen Verhältnisse und die einseitige Ernährung zu Schwindsucht und Mangelkrankheiten. Aber auch unter diesen Bedingungen fanden sich Paare mit einem stabilen und gefestigten Familienleben, da die ständige Existenzbedrohung vielfach zu innerfamilialer Solidarität führte. Zudem handelte es sich bei Arbeiterehen in der Regel um Liebesheiraten, da die Eltern aufgrund der finanziellen Unabhängigkeit der jungen Leute und wegen der fehlenden Mittel für eine Mitgift kein Mitspracherecht bei der Partnerwahl besaßen. Vielfach nahm die Frau eine starke Stellung in der Familie ein, da sie zum Familieneinkommen beitrug und dieses auch verwaltete. Die Situation von Arbeiterfamilien verbesserte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums und der Sozialgesetzgebung (1883 Krankenversicherung, 1884 Unfallversicherung, 1889 Invaliditäts- und Altersversicherung, 1891 Arbeiterschutzgesetz).
Bei Bauernfamilien, aber auch bei kleinen Handwerkern, hielten sich Strukturen des mittelalterlichen "Hauses" bis ins 20. Jahrhundert hinein. Große Veränderungen brachten zu Beginn des letzten Jahrhunderts die Befreiung der Bauern von der Grundherrschaft und die Säkularisation - so war zum Beispiel in Kurbayern die Kirche zuvor Herrin über 56% des Gesamteigentums an Land und über die Hälfte aller grunduntertänigen Familien gewesen (Ohe 1985). Eine negative Folge der Bauernbefreiung war aber die starke Verschuldung vieler Höfe. Auch gab es große regionale Unterschiede im Lebensstandard und in der Wirtschaftsform entsprechend des Erbrechts. Während in Gegenden mit der Realteilung Hofgrößen entstanden, die einer Familie nicht mehr das Überleben ermöglichten, blieben in Regionen mit Anerbenrecht große Gehöfte erhalten. Während hier der Bauer mit seinen Söhnen und Knechten für Feldarbeit und Großvieh, die Bäuerin mit Töchtern und Mägden für Haus, Stall und Garten zuständig war, konnte auf kleinen Höfen eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung kaum realisiert werden.
Ein Großteil der (Groß-) Bauern lebte in Mehrgenerationenfamilien, die weiterhin eine Produktions- und Versorgungsgemeinschaft bildeten. Sie waren patriarchalisch strukturiert; die Kontrolle über den Hof und damit über die Existenzgrundlage gab dem Vater eine große Macht. Auch erwachsene Kinder blieben bis zur Hofübergabe von ihm abhängig und mussten häufig bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Heiraten warten. Es ist offensichtlich, dass dieses vielfach zu großen Spannungen zwischen den Generationen führte. Mit der Hofübergabe wechselten die Eltern ins Altenteil, wobei in dem oft notariell abgefassten Übergabevertrag genauestens die Verpflichtungen der jüngeren Generation festgelegt wurden. Derartige Vereinbarungen lassen vermuten, dass in Bauernfamilien gefühlsmäßige Bindungen von geringerer Bedeutung waren als im Bürgertum. Nach der Übernahme des Hofes musste der erbende Bauer bei Anerbenrecht seine Geschwister auszahlen, was für ihn eine große finanzielle Verpflichtung bedeutete. Diese wurde teilweise durch die Mitgift seiner Frau abgedeckt - bei der Partnerwahl waren also weiterhin zweckrationale Kriterien wie Mitgift, Besitz und Arbeitstüchtigkeit wichtig. Jüngere unverheiratete Geschwister blieben jetzt jedoch seltener auf dem Hof wohnen, sondern suchten öfters Lohnarbeit in der Stadt. Viele wanderten auch nach Amerika oder Australien aus.
Säuglinge wurden ein bis zwei Jahre und länger gestillt und bis ins 20. Jahrhundert hinein gewickelt. Oft wurden schon Kleinkinder mit den Hirten auf die Weide geschickt; mit acht Jahren mussten Kinder bereits selbst Ziegen oder Schafe hüten. Vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Schulpflicht auf dem Land noch nicht durchgesetzt wurde, besuchten sie nur insoweit die Schule, wie die Arbeit dazu Zeit ließ. Dementsprechend konnten sie sich bloß eine geringe Schulbildung aneignen. So wurden Kinder wie im Mittelalter weiterhin in erster Linie als Arbeitskräfte betrachtet. Sie arbeiteten entweder auf dem Hof ihrer Eltern oder wurden - falls dieser zu klein war - als Gesinde, Tagelöhner o.Ä. auf andere Gehöfte gegeben, manchmal sogar als Hütejungen versteigert. Vielfach erhielten sie eingewisses Arbeitspensum zugeteilt, wobei streng darauf geachtet wurde, dass sie es ableisteten. Falls sie die Erwartungen der Eltern nicht erfüllten, mussten sie mit schweren Körperstrafen rechnen. Hatten aber die Kinder die ihnen aufgetragenen Aufgaben erledigt, so konnten sie ohne nennenswerte Kontrolle der Eltern auf dem Gehöft, im Wald oder auf den Wiesen herumtollen, basteln und spielen. Zumeist mussten sie ihre Spielsachen selbst herstellen, da von den Eltern für derartige Dinge kein Geld ausgegeben wurde. An Spiel und Freizeitgestaltung nahmen diese aufgrund von Zeitmangel nur selten teil, so dass die Erziehung auch von einer gewissen Vernachlässigung (neben Härte und Strenge) gekennzeichnet war. Die Kinder waren dabei, wenn Erwachsene Geschichten und Schwenke erzählten, sangen oder feierten. Sie teilten vollständig deren Leben, mussten zum Beispiel bei bestimmten Gesprächsthemen auch nicht den Raum verlassen. So erfolgte Erziehung indirekt durch Lernen am Vorbild und die Mitwirkung auf dem Hof. Dabei erreichten die Kinder eine erstaunliche Vielseitigkeit, da die bäuerliche Produktion in großen Teilen subsistenzwirtschaftlich erfolgte (wenig verfügbares Bargeld) und damit auf den Höfen höchst unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt wurden. Durch Arbeit und Spiel wuchsen die Kinder ebenso "unmerklich" in die Sozialstruktur des Dorfes hinein und eigneten sich die vorherrschenden Normen, Einstellungen und Leitbilder an.
Familienleben um 1950
Im Dritten Reich wurde das Bild der Familie vor allem von der nationalsozialistischen Ideologie geprägt. Der Familien- und Mutterkult äußerte sich in Vorstellungen von kräftigen, anspruchslosen Frauen, die ihren lieben Ehemännern ein trautes Heim bereiten und von einer Schar glücklicher Kinder umringt sind. Die Erwerbstätigenquote bei Frauen nahm jedoch zu, diese wurden aber von höheren Positionen ausgeschlossen. Um die Vermehrung der Herrenrasse zu beschleunigen und um die Expansionsgelüste befriedigen zu können, wurde eine kostspielige Geburtenförderung betrieben. Dennoch kam es im Dritten Reich zu einem Rückgang der durchschnittlichen Kinderzahl, da beispielsweise Wohnungen knapp und vielfach zu klein waren. In der Bevölkerungs- und Rassenpolitik wurde die Pflege der besten rassischen Elemente angezielt: Das deutsche Volk sollte zum nordischen Typus (blond, hoch gewachsen, langschädelig, schmales Gesicht) hingezüchtet werden. Kerngesunde Körper, Abhärtung, Willens- und Entschlusskraft waren Erziehungsziele. Der ideologischen Schulung - teilweise auch der körperlichen Ertüchtigung - dienten nationalsozialistische Verbände wie das Deutsche Jungvolk und die Jungmädels, die Hitler-Jugend und der Bund Deutscher Mädels, der Reichsarbeitsdienst und die Gliederungen der NSDAP. Da diese letztlich recht kurze Zeitepoche für den Vergleich mit der Gegenwart und das Herausarbeiten von Entwicklungstendenzen wenig fruchtbar ist, wollen wir uns auf diese Aussagen beschränken und uns nun der Nachkriegszeitzuwenden. Während Bauernfamilien in dieser Zeit kaum Not litten, sondern zu einem großen Teil sogar von den Hamsterfahrten der Städter profitierten, lebten Ausgebombte und Flüchtlinge in dürftigen Notquartieren, in Ruinen oder als Einquartierte in den unzerstörten Wohnungen der Stadtrandgebiete und umliegenden Dörfer. Selten stand mehr als ein Raum pro Familie zur Verfügung. Heizmaterial, Nahrungsmittel und Kleidung waren knapp. So mussten Kinder und Jugendliche dürres Holz und Tannenzapfen in nahen Wäldern suchen, die in Kanonenöfen verfeuert wurden. Das Essen bestandvielfach nur aus trockenem Brot und Mehlsuppe; viele Kleinkinder und alte Menschen starben an Unterernährung. Kleidungsstücke wurden selbst angefertigt, wobei improvisiert werden musste: So entstanden zum Beispiel aus Gardinen Sommerkleider, aus Uniformen Zivilanzüge. Dabei ging auch die scharfe Trennung zwischen den Gesellschaftsschichten verloren, die das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert gekennzeichnet hatte.
Familie und Verwandtschaft übernahmen vorübergehend wieder stärker Funktionen, die scheinbar in den vergangenen Jahrzehnten verloren gegangen waren. Sie hielten zusammen, versorgten ausgebombte, verwaiste und alte Familienmitglieder, stellten Möbel und Kleidung füreinander her und versorgten einander mit Gemüse, das zwischen den Ruinen angebaut wurde. Zudem bot die Familie den Menschen den einzigen Halt und erfuhr so eine neue Wertschätzung. Auch gelang es ihr unter großen Schwierigkeiten, seelische Schäden bei den frühzeitig erwachsen gewordenen Kindern und Jugendlichen relativ klein zu halten. Viele Familienverbände wurden aber durch Flucht und Evakuierung, durch die Suche nach Arbeit und die unzureichenden Wohnbedingungen auseinander gerissen. Aufgrund der großen erzwungenen Mobilität fühlten sich auch viele Menschen wenig verwurzelt und heimatlos. Ferner fehlten in vielen Familien die Männer, die entweder tot waren beziehungsweise vermisst wurden oder noch bis in die 50er-Jahre hinein ausgezehrt und von ihren Angehörigen (Kindern) entfremdet aus der Gefangenschaft zurückkehrten. Zu Hause erwartete die Heimkehrer zumeist Arbeitslosigkeit, aber auch aufgrund des hohen Frauenüberschusses - acht Frauen kamen auf fünf Männer - eine große Auswahl möglicher Partnerinnen. Häufig entstanden so genannte "Onkelehen", bei denen es zu keiner Heirat kam, weil die Frau zum Beispiel ihre Kriegswitwenrente nicht verlieren wollte oder ihr erster Mann noch vermisst wurde.
Nach der Währungsreform (1948) und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (1949) kam es in den darauf folgenden Jahren zu einem raschen wirtschaftlichen Aufschwung. Dennoch blieb die Arbeitslosenquote vorerst hoch, gab es immer noch eine große Wohnungsnot. So lebten Anfang der 50er-Jahre zum Beispiel in Frankfurt ein Drittel aller Familien mit Kindern in Untermiete. Auch war die materielle Situation der meisten Familienschlecht: Nach einer Erhebung bei 808 Haushalten verdiente in den Jahren 1950/51 eine Arbeiterfamilie 3.920 DM und eine Angestelltenfamilie 4.681 DM im Jahr (laut Hubbard 1983). Ähnlich wie im 19. Jahrhundert mussten noch über 40% des Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben werden.
Während die durchschnittliche Haushaltsgröße 1871 im Deutschen Reich 4,6 Personen umfasst hatte, waren es 1950 in der Bundesrepublik Deutschland nur noch 3,1 Individuen. Drei- oder Viergenerationenfamilien fanden sich häufig auf dem Land (sie machten zum Beispiel in einem Dorf bei Marburg 45% und im Darmstädter Hinterland 42% der Familien aus), während sie in der Stadt immer seltener wurden. Auch arbeiteten nur noch rund 15% der Bevölkerung in der Land- und Forstwirtschaft; die Urbanisierung und die weitere Ausdifferenzierung der Gesellschaft setzten sich fort. Während 1871 63% der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern und nur 6% in Großstädten gewohnt hatten, lauteten die entsprechenden Zahlen für 1953 27 und 29% (alle Angaben nach Mayntz 1955). Diese Entwicklungen waren durch den Zustrom der Vertriebenen und Flüchtlinge beschleunigt worden.
In den 50er-Jahren nahm das Mitspracherecht der Eltern bei der Partnerwahl ihrer Kinder weiter ab, zumal sie aufgrund ihrer materiellen Lage seltener über eine Mitgift oder die Zusage finanzieller Zuwendungen Einfluss nehmen konnten. Eine Aussteuer war bald aber wieder üblich. Meist war der Altersunterschied zwischen den Partnern gering, wurde relativ früh geheiratet - in der Regel aber noch nach einer Verlobungszeit. Da unverheiratete Frauen viel selbständiger als im 19. Jahrhundert und vielfach berufstätig waren, lernten sie ihre zukünftigen Ehepartner weniger durch die Vermittlung von Eltern und Verwandten kennen, sondern mehr in Beruf, Verein oder Freundeskreis. Da beide Seiten zumeist finanziell unabhängig waren, spielten psychologische Motive wie romantische Liebe, geistige Übereinstimmung oder das Bedürfnis nach Geborgenheit und Glück bei der Partnerwahl die entscheidende Rolle. Aber auch andere Gründe waren von Bedeutung: So heirateten laut einer Befragung von circa 70 Ehepaaren rund 40% wegen Schwangerschaft, 20%, weil nur verheirateten Paaren Wohnraum zugewiesen wurde, und 18% wegen einem starken Kinderwunsch (Nave-Herz 1984).
Voreheliche sexuelle Beziehungen wurden nicht mehr wie im 19. Jahrhundert verboten: So akzeptierten Anfang der 50er-Jahre schon 71% der Bevölkerung Geschlechtsverkehr zwischen unverheirateten Personen. Dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Säkularisierung und der fortschreitenden Emanzipation begegnete man generell der Sexualität aufgeschlossener und freier: 58% der Bevölkerung benötigten sie für ihr persönliches Lebensglück (Befragungsergebnisse nach Mayntz 1955).
Etwa die Hälfte der Paare blieb zu Beginn der 50er-Jahre aufgrund des Wohnungsmangels nach der Eheschließung im Haushalt der Eltern oder anderer Verwandter wohnen, zumeist für länger als ein Jahr. In der Regel stand ihnen bloß ein eigenes Schlafzimmer zur Verfügung. Dementsprechend besaß auch nur etwa die Hälfte aller Paare eine vollständige Wohnungseinrichtung, zu der aber zum Beispiel selten teuere Gegenstände wie Gas- oder Elektroherdegehörten (Nave-Herz 1984). So ist es nicht verwunderlich, dass in der Ehe vielfach eine Interessengemeinschaft, ein Bündnis für den Lebenskampf oder ein Zweckverband gesehen wurde, in dem materielle Wünsche und Ziele von großer Bedeutung waren. Obwohl es üblich war, dass Frauen ihren Beruf bei der Eheschließung oder Geburt eines Kindes aufgaben, blieben circa 26%erwerbstätig (Mayntz 1955). Laut einer von Pfeil (nach Hubbard 1983) 1956/57 durchgeführten Befragung von 872 Müttern arbeiteten aber nur noch 26% aus Existenznot. Während ihrer Abwesenheit wurden 53% der Kleinkinder von Verwandten, 13% in fremden Haushalten und 21% in Krippen oder Kindergärten beaufsichtigt. In Großstädten waren bereits circa 20% der Schüler "Schlüsselkinder".
Vor allem die aus dem Krieg heimkehrenden älteren Männer drängten in ihre frühere patriarchalische Rolle zurück. Zumeist stießen sie aber auf große Widerstände seitens der Frauen, denen der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit eine der männlichen Rolle in keiner Weise nachstehende Selbständigkeit aufgezwungen hatten: Sie mussten zunächst die von der Wehrmacht eingezogenen Männer in Industrie, Handel und Verwaltung ersetzen, waren also berufstätig geworden. In der Nachkriegszeit sicherten sie dann zu einem großen Teil das Überleben ihrer Familien in der Nachkriegszeit und wirkten als Trümmerfrauen am Wiederaufbau der Städte mit. Die aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrenden Männer waren in der Regel zunächst arbeitslos. Diese Erfahrungen hatten die Frauen selbstbewusst gemacht und ließen sie die althergebrachte "natürliche" Vorrangstellung des Mannes in Fragestellen. Um 1950 untersuchte Wurzbacher 150 Familien und stellte fest, dass in knapp drei Viertel die grundsätzliche Gleichrangigkeit der Partner anerkannt wurde, während Baumert bei der Befragung von 387 Familien im Darmstädter Gebiet nur noch ein Viertel mit einer patriarchalischen, aber schon ein Viertel mit einer partnerschaftlichen Familienstruktur fand (nach Mayntz 1955). Auch verwalteten viele Frauen das Familieneinkommen.
Diese sich ändernden Einstellungen wirkten sich jedoch noch nicht auf die häusliche Arbeitsteilung aus. So blieben die Frauen, einschließlich der berufstätigen Mütter, weiterhin für Haushalt und Kindererziehung zuständig. Sie erfuhren nur wenig Mithilfe seitens der Männer und litten manchmal unter Überlastung - insbesondere wenn Berufs- und Familientätigkeit miteinander vereinbart werden mussten. Da diese Umstände aber als selbstverständlich galten und nur von wenigen hinterfragt wurden, schienen die meisten Frauen mit ihrer Situation zufrieden zu sein und thematisierten oder problematisierten sie nicht in Gesprächen mit ihrem Partner. So waren laut einem Umfrageergebnis circa 85% der Erwachsenen mit ihrer Ehe zufrieden (nach Mayntz 1955). Es stieg aber auch die Zahl der Scheidungen: Während 1912/14 erst 2,6 auf 10.000 Einwohner kamen, waren es 1950 bereits 15,7. Zudem war der Einfluss der Verwandtschaft auf die Familie geringer als in früheren Jahrhunderten, obwohl sie für wichtiger gehalten wurde als heute. Generell hatten Ehepaare einen kleineren Kreis von Freunden und Bekannten (zumeist weniger als zehn Personen bei Ehebeginn), trafen sich seltener mit ihnen und verbrachten mehr Zeit daheim als heute (Nave-Herz 1984).
In den 50er-Jahren legten viele Ehepaare die Zahl ihrer Kinder im Voraus fest. Diese wurden nämlich immer mehr als eine wirtschaftliche Belastung gesehen. Zudem wurde die Notwendigkeit einer guten Erziehung und Schulbildung allgemein anerkannt, da sich in der Nachkriegszeit berufliches Wissen und Können als einzige unverlierbare Besitztümer erwiesen hatten. Bei der Geburt eines Kindes war im Gegensatz zu heute der Vater nur seltenanwesend. Auch führte das Vorhandensein eines Säuglings noch zu weniger gravierenden Veränderungen, etwa im Tagesrhythmus in der Familie, wurde das Kleinkind nicht so sehr als eine Belastung erlebt. Allerdings kam es ebenfalls zu einer Reduzierung von Außenkontakten und zur verstärkten Häuslichkeit der Frau (Nave-Herz 1984).
Generell waren die Eltern weniger kindorientiert als heute. Ihre Kinder besaßen einen größeren Entwicklungsraum, mehr Freiheiten und mehr Mitbestimmungsrechte (zum Beispiel bei der Wahl von Spielkameraden, der Festlegung von Familienaktivitäten) als noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zudem waren das Vertrauensverhältnis und die Gefühlsbindungen zwischen Eltern und Kinder stärker ausgeprägt, gingen erstere mehr auf Letztere ein und fanden sich fast immer zu einem Gespräch bereit. Ein partnerschaftlicher Erziehungsstil und ein kameradschaftlicher Umgangston setzten sich immer mehr durch. Jedoch begannen die Eltern auch unsicherer zu werden, da sie sich nicht mehr an eindeutigen Normen orientieren konnten (Wertepluralismus), mit widersprüchlichen Empfehlungen von Pädagogen konfrontiert wurden und von Psychologen (Psychoanalyse) immer wieder auf die Gefährdung der kindlichen Entwicklung durch Erziehungsfehler hingewiesen wurden. Zudem mussten sie sich immer mehr mit "heimlichen Miterziehern" auseinander setzen.
Neben Zeitschriften, Radio, Kino und später auch dem Fernsehen gewannen gleichaltrige Jugendliche großen Einfluss: Es bildete sich eine eigene Jugendkultur mit bestimmten Leitbildern, Musikvorlieben, Kleidungsvorschriften und Verhaltensweisen heraus - ein Phänomen, das wohl erstmalig zu Beginn des 20. Jahrhunderts auftrat (zum Beispiel Jugendbewegung). Generell wollten Jugendliche eigenständig, unabhängig und in Anwesenheit von Freunden ungestört sein. Bei Mädchen wurde es immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit, dass sie nach Beendigung der Schule einen Beruf erlernten. Die damit verbundene gesellschaftliche Anerkennung, die erlebte Belohnung erbrachter eigener Leistungen, die dauernde geistige Anregung und die neuen sozialen Erfahrungen führten dazu, dass junge Frauen selbständiger und selbstbewusster wurden und immer häufiger gegenüber gleichaltrigen Männern auf Gleichberechtigung bestanden.
Entwicklungstendenzen
In diesem Teil möchten wir - den Inhalt der vorausgegangenen Kapitel aufgreifend und auf die Gegenwartbeziehend - einige wichtige Entwicklungen der vergangenen Jahrhunderte diskutieren, die zum einen zu den uns aus eigener Erfahrung und Beobachtung bekannten Familienformen führten und zum anderen auf die Vielzahl möglicher Ausprägungen von "Familie" verweisen. Dabei möchten wir auch mit einigen Vorurteilen über die Vergangenheit brechen. Beispielsweise wird oft davon ausgegangen, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr früher aufgrund gesellschaftlicher und kirchlicher Normen und Sanktionen, aber auch wegen fehlender Verhütungsmittel, eine Ausnahme war. Bei unserer Betrachtung des Familienlebens im Mittelalter haben wir jedoch festgestellt, dass damals vor- und außereheliche sexuelle Erfahrungen durchaus toleriert wurden und üblich waren.
Einen Hinweis auf das Ausmaß nichtehelichen Geschlechtsverkehrs im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt die Zahl nichtehelicher Geburten. So waren zum Beispiel in Bayern von 1.000 Geburten 196 in den Jahren 1816/20, 208 in den Jahren 1851/55, 127 in den Jahren 1901/05 und immerhin noch 123 in den Jahren 1951/55 nichtehelich, während es 1986 nur noch 9 von 1.000Geburten waren. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden etwa 13%, um die Jahrhundertwende knapp 20% und um 1930 etwa 38% der Kindernachträglich legitimiert (Hubbard 1983). Zudem ist zu bedenken, dass häufig -auch noch in den 50er-Jahren - während der Schwangerschaft der Fraugeheiratet wurde, diese also einer der wichtigsten Heiratsgründe war.
Schließlich ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass in der Vergangenheit ebenfalls viele nichteheliche Kinder abgetrieben wurden, obwohl dieses mit ganz wenigen Ausnahmen strafbar war: So schätzte zum Beispiel Stoeckel in seinem "Lehrbuch der Geburtshilfe", das 1945 in achter Auflage in Jena erschien, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche (auf l.000 Lebend- und Totgeborene) für die Jahre 1890 auf circa 100, für 1912 auf circa 200 bis 250, für 1927 auf circa 330 und für 1930 auf circa 500 (nach Hubbard 1983). Hierbei handelt es sich um eine konservative Schätzung; andere Autoren gehen von höheren Zahlen aus. 1984 wurden übrigens in der Bundesrepublik 148 Kinder auf l.000 Geburten abgetrieben.
Während also vorehelicher Geschlechtsverkehr in der Vergangenheit durchaus üblich war, nur in verschiedenen Epochen unterschiedlich stark sanktioniert wurde (was sich natürlich auch auf die gesellschaftliche Stellung nichtehelicher Kinder auswirkte), ist die Freiheit der Partnerwahl für nahezu alle Menschen eine neue Errungenschaft. Zum einen besitzt heute fast jeder die finanziellen Voraussetzungen für die Gründung einer Familie. Auch gibt es keine Heiratsverbote aufgrund der gesellschaftlichen Position oder materiellen Situation mehr. So sind derzeit anstatt der knappen Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung circa 80%mindestens einmal verheiratet gewesen. Die Verheiratetenquoten in den verschiedenen Gesellschaftsschichten haben sich einander angenähert. Zum anderen ist der Einfluss von Eltern und Verwandtschaft auf die Partnerwahl stark zurückgegangen. Während diese früher durch Stand, Klassenbewusstsein, Besitz und Familienbeschluss bestimmt wurde, ist sie heute frei und individuell, sind Zuneigung und Liebe die entscheidenden Kriterien. Auch die Bedeutung der Konfessionszugehörigkeit ist stark geschwunden: So waren zum Beispiel in Bayern, einem Land mit katholischer Bevölkerungsmehrheit (nur etwas mehr als 25% aller Bayern sind evangelisch), in den Jahren 1871/72 nur 5,5%, im Jahr 1986 aber bereits 34,1% aller Ehen konfessionell gemischt (nach Hubbard 1983). Das durchschnittliche Heiratsalter ist in diesem Jahrhundert etwas gesunken; schichtspezifische Unterschiede sind geringer geworden.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der Regel keine Geburtenkontrolle. In erster Linie bestimmte der Mann durch sein Sexualverhalten die Zahl der Schwangerschaften seiner Frau. Da Kinder aber aufgrund der Schulpflicht einen immer geringeren Beitrag zum Haushalt leisteten und zunehmend Kostenverursachten und da ihr Überleben aufgrund des medizinischen Fortschritts immer häufiger gewährleistet war, ihre Funktion als Ernährer kranker oder alter Eltern aufgrund des Ausbaus des Sozialstaates aber zunehmend schwand und der Einfluss vor allem der katholischen Kirche abnahm (die eine eheliche Vereinigung von Mann und Frau um der Lust willen verbot), setzten sich nach 1875 immer häufiger verschiedene Maßnahmen und Formen der Geburtenregelung durch. Das zeigt sich zum einen an der Zahl der Lebendgeborenen pro Jahr (auf l.000 Personen): In Bayern sank sie zum Beispiel von 40,1 Lebendgeborenen in den Jahren 1871/75 und 24,1 Lebendgeborenen in den Jahren 1921/25 auf 11,1 Lebendgeborene im Jahr 1986 (nach Hubbard 1983). Zum anderen wird die Bedeutung der Empfängnisverhütung an der Bevölkerungsentwicklung deutlich, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum noch anstieg. Das Aufkommen moderner Verhütungsmethoden führte aber auch zur Kontrolle der Frau über ihren eigenen Körper - eine der Vorbedingungen für ihre Emanzipation.
Die Vorstellung, dass im 19. und in den vorausgegangenen Jahrhunderten aufgrund von fehlender Geburtenkontrolle, hohen Geburtenzahlen und dem Zusammenleben mehrerer Generationen der Typus der Großfamilie vorgeherrscht hätte und Kleinfamilien eine Folge der Industrialisierung seien, hat sich aufgrund wissenschaftlicher Befunde als falsch erwiesen. Wohl war früher die Zahl der Lebendgeborenen größer (s.o.), wurden mehr Kinder pro Ehe geboren. So lag die Durchschnittszahl der Lebendgeborenen pro Ehe (nach 20-jähriger Dauer) für die Ehejahrgänge 1899 und früher bei 4,9 Kindern (Preußen) und für den Jahrgang 1910 immerhin noch bei 3,0 Kindern (Preußen), für den Jahrgang 1920 aber nur noch bei 2,3 Kindern (Deutsches Reich) (Hubbard 1983). Gleichzeitig waren aber auch Mütter- und Kindersterblichkeit sehr hoch. So starben zum Beispiel in Bayern von 1.000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahr in den Jahren 1832/35 302 Kinder, in den Jahren 1901/05 240 Kinder und in den Jahren 1951/55 50 Kinder, während es 1976/80 nur noch 14 Kinder waren (Hubbard 1983).
Die Mütter- und Kindersterblichkeit, die man im Zusammenhang mit einer hohen Zahl von Fehl- und Totgeburten sowie von primitiven Abtreibungen sehen muss, führte nicht nur zu einer großen Instabilität der Familien, zu einer Vielzahl von Stieffamilien und zu großen Altersunterschieden zwischen den Geschwistern, sondern eben auch zu einer Familiengröße, für die der Begriff "Großfamilie" nicht zutrifft. So betrug zum Beispiel in Bayern die durchschnittliche Haushaltsgröße in den Jahren 1818, 1852 und 1871 4,6 Personen, stieg 1900 kurz auf 4,7 Personen an und sank dann 1925 auf 4,3 Personen, 1950 auf 3,2 Personen und 1980 auf 2,6 Personen (Hubbard 1983). Zudem ist zu bedenken, dass zum Beispiel in ländlichen Regionen Bayerns Anfang des 19. Jahrhunderts das Heiratsalter des Bräutigams bei über 28 Jahren und das der Braut bei 27 Jahren lag (Ohe 1985), so dass aufgrund der niedrigen Lebenserwartung und des früheren Eintretens der Menopause nur etwa 15 Jahre für die Zeugung von Kindern zur Verfügung standen. Das erklärt auch, wieso Mehrgenerationenfamilien relativ selten waren.
In vielen Haushalten lebten und arbeiteten früher familienfremde Personen, was beim Vergleich von Haushaltsgrößen aus verschiedenen Jahrhunderten zu berücksichtigen ist. So lebten zum Beispiel 1882 im Deutschen Reich l.282.414 Dienstboten im Haus des Arbeitgebers; 1925 waren es l.016.022 und 1939 immerhin noch 995.117 Personen. In der Bundesrepublik Deutschland wohnten 1950 etwas mehr als 600.000, 1980 aber nur noch 160.000 Dienstboten bei ihrem Arbeitgeber(Hubbard 1983). Während in Bayern im Jahre 1910 noch in 20% der Haushalte Gesinde und in knapp 11% Untermieter beziehungsweise Schlafleute lebten, traf dieses 1970 nur noch auf etwa 1,5% aller Haushalte zu (a.a.O.). Größere Haushalte gab es in der Vergangenheit nur bei den Besitzern großer Höfe, bei Adligen, reichen Kaufleuten und erfolgreichen Handwerkern, später auch bei höheren Beamten. Generell herrschten aber in der Vergangenheit Kleinfamilien und unvollständige Familien vor. Überblickt man die letzten Jahrhunderte, dann kann man nicht von einem Übergang von der Großfamilie zur Kleinfamilie reden. Allerdings ist für die letzten Jahrzehnte ein starker Anstieg der Zahl von Alleinlebenden zu verzeichnen.
Die Ausgliederung von Verwandten und familienfremden Personen aus dem eigenen Haushalt, die Mobilität, die Urbanisierung mit der größeren Anonymität der städtischen Lebensweise, die Trennung von Familie und Arbeitsplatz sowie der Individualismus und die Säkularisierung haben zu mehr Unabhängigkeit und Autonomie der Familie von heute geführt. Sie wird weniger durch Verwandtschaft, Nachbarschaft, Kirche und Gemeinde kontrolliert. Die Familienmitglieder wurden somit aus traditionellen Bindungen entlassen, können nun ihren Lebenslauf selbst bestimmen und individuell gestalten (Individualisierung). Zugleich müssen sie sich aber mit der Vielzahlkonkurrierender Werte, Leitbilder und Normen auseinander setzen. Die Verhaltenskontrolle und -einübung wurde teilweise von Institutionen wie Schule, Jugendamt oder Polizei übernommen; Verwandten- und Nachbarschaftshilfe wurden vielfach durch Maßnahmen von Einrichtungen des Sozialwesens ersetzt. Auch spielen Bildungssystem, Arbeitsplatz und Freundeskreis eine größere Rolle bei der Eingliederung des einzelnen in die Gesellschaft. Die These, dass diese Entwicklungen zur Isolierung der Familie und zu einer mangelnden Unterstützung durch Netzwerke geführt hätten, findet heute nur noch wenig Zustimmung findet.
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Scheidungsrate starkangestiegen. So kamen zum Beispiel in Bayern auf l.000 Eheschließungen 6 Scheidungen in den Jahren 1836/40 und 1881/85, aber bereits 50 Scheidungen in den Jahren 1921/25, 133 Ehescheidungen in den Jahren 1946/50 und 274 Scheidungen im Jahr 1986 (vgl. Hubbard 1983).
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass unaufgelöste Ehen heute mehr als doppelt so lange bestehen wie vor 100 Jahren, dass früher etwa gleich viele Ehen durch den vorzeitigen Tod eines Partners beendet wurden wie heute durch Scheidungen und dass es dementsprechend damals ebenfalls eine große Zahl von Alleinerziehenden und Stieffamilien gab. Auch ist natürlich die geringe Scheidungsrate in der Vergangenheit kein Indiz für eine bessere Qualität der Ehebeziehung. So spielten früher Liebe und Emotionalität eine geringere Rolle, wurden weniger Erwartungen an die Partnerschaft gestellt, warenaußereheliche Beziehungen häufig.
In den vergangenen Jahrzehnten ist ferner eine Entwicklungstendenz von patriarchalisch strukturierten Familien hin zu mehr partnerschaftlichen Familienbeziehungen festzustellen. Da Beziehungen nicht mehr durch eindeutige Normen und Leitbilder festgelegt sind, müssen sie ausgehandelt und individuell gestaltet werden. Der Ehemann und Vater besitzt nicht mehr die Autorität von früher, repräsentiert nicht mehr alleine die Familie und bestimmt weniger das Verhalten ihrer Mitglieder. Die Frauen sind selbständiger, unabhängiger und emanzipierter geworden. Zudem sind sie häufiger erwerbstätig. So waren 1882 29,2%, 1933 35,5% und 1988 38,8% aller Erwerbstätigen weiblich (vgl. Hubbard 1983). Dementsprechend wird die gesellschaftliche Position einer Frau immer weniger entsprechend ihrer Herkunft und dem Beruf ihres Ehemannes bewertet, sondern - wie beim Mann - nach ihrer Ausbildung, ihrem Einkommen und Erfolg.
Aber nicht nur die außerhäusliche Berufstätigkeit unterscheidet die Biographie der (verheirateten) Frau von heute von ihrem Lebenslauf in vergangenen Jahrhunderten. Eine große Rolle spielt auch die steigende Lebenserwartung. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang zum einen, dass nahezu alle Frauen heute mit einer langen Altersphase rechnen können, wobei sie mehr Zeit als früher ohne ihren Ehepartner verbringen müssen. Zum anderen ist aufgrund der sehr viel niedrigeren Geburtenrate die Zeit zwischen Heirat und Menopause nicht mehr durch mehrere Schwangerschaften und Mutterpflichten ausgefüllt. Wenn Frauen das 35. Lebensjahr erreichen, sind die Kinder in der Regel schon längst eingeschult. Dann müssen die Mütter entscheiden, wie sie die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte bis zum Rentenalter verbringen möchten. Frauen- und Mutterrolle haben sich also in den vergangenen Jahrzehntenauseinanderentwickelt; die Frauen haben circa 40 Jahre hinzugewonnen, über die sie freier und ungebundener verfügen können als zuvor.
Dementsprechend hat sich auch der Familienzyklus geändert: So ist die Phase zwischen Heirat und Geburt des ersten Kindes länger geworden, die Phase mit Kleinkindern jedoch kürzer. Aufgrund der langen Schul- und Ausbildungszeiten sind die Phasen mit Schulkindern und Jugendlichen gegenüber dem Mittelalter neu hinzugekommen beziehungsweise im Vergleich zum 19. Jahrhundert länger geworden. Auch die Phasen des "empty nest" (wenn die Kinder unabhängig geworden sind und die Familie verlassen haben) und der "alten" Familie haben erst in diesem Jahrhundert an Bedeutung gewonnen und sind immer länger geworden. Ein in deutliche Phasen gegliederter Familienzyklus ist somit ein neuartiges Phänomen.
Mit der zunehmenden Differenzierung der Gesellschaft in ökonomische, politische, kulturelle, religiöse und andere Teilbereiche veränderten sich im Verlauf der letzten Jahrhunderte auch die Funktionen der Familie. Sie ist zu einem spezialisierten Subsystem der Gesellschaft geworden, dessen herausragendes Charakteristikum seine "Menschlichkeit" ist - in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich spielen Affektivität, Solidarität, ganzheitliche Personenwahrnehmung, Individualität usw. eine derartig große Rolle. Eine Folge dieser Differenzierung und Spezialisierung ist beispielsweise, dass die Familie die Produktionsfunktion verlor, wie sie das "Haus" im Mittelalter besaß. Heute gibt es selbst auf dem Lande keine Familien mehr, die sich weitgehend selbst versorgen. Wohl werden zunehmend Arbeiten in Haus und Garten (zum Beispiel renovieren, tapezieren, reparieren) aufgrund der hohen Handwerkerkosten und des Wunsches nachkörperlicher Betätigung wieder selbst erledigt, aber das Haushaltseinkommen wird im Regelfall außerhalb des Familienverbandes verdient. Dabei muss normalerweise auf eine Mitarbeit der Kinder (außer zum Beispiel bei Landwirten) verzichtet werden. Eine Folge dieser Entwicklung ist die Trennung von Arbeitsplatz und Familienleben - selbst der eine Ehepartner hat häufig keine genaue Vorstellung von der beruflichen Tätigkeit des anderen mehr und zeigt deshalb oft wenig Verständnis für dessen Erfolge und Probleme. Auch haben die Gemeinsamkeit des Kampfes um das Überleben des "Hauses" und um die Wahrung des Besitzstandes sowie der Zwang zur Zusammenarbeit an Bedeutung verloren. Das hat zur Folge, dass heute der Familienzusammenhalt nicht mehr durch äußere Notwendigkeiten gestützt wird, sondern in erster Linie von der persönlichen Bejahung der Ehebeziehung durch die Partner abhängt. Von einer Produktionseinheit ist die Familie zu einer reinen Konsumgemeinschaft geworden.
Ähnliches trifft auf die kulturelle Funktion der Familie zu. Während früher zum Beispiel Familienmitglieder an der Gestaltung von Volks- und Kirchenfesten beteiligt waren und - zumindest im Bürgertum - die Künste durch Hausmusik, Gedichtvortrag, Gesang usw. pflegten, beschränkt sich heute ihre Teilnahme am Kulturleben auf den Besuch von Vorstellungen, die von spezialisierten Institutionen (Theater, Oper, Museum usw.) abgeboten werden oder auf den Medienkonsum. Ferner ist festzustellen, dass Familien immer seltener eine religiöse Funktion wahrnehmen. Nur noch eine Minderheit ist durch eine christliche Lebensweise geprägt - obwohl sich wahrscheinlich auch in der Vergangenheit die religiösen Betätigungen vieler Familien auf den regelmäßigen Gottesdienstbesuch (wobei man sich während der lateinischen und damit unverständlichen Messe ungehindert unterhielt) und auf Rituale wie das (immer gleiche) Tischgebet beschränkten. Heute haben die meisten Familien die Weitergabe und Einübung der christlichen Lehre, von Ritualen usw. sowie die religiöse Erziehung an Kindergarten, Schule und Kirche delegiert - sofern sie überhaupt noch an einer religiösen Sozialisation interessiert sind. Im Zusammenhang mit der Ausdifferenzierung des medizinischen und Sozialsystems sowie des Versicherungswesens hat die Familie ferner einen großen Teil ihrer Aufgaben im Bereich der Versorgung kranker, behinderter, alter oder arbeitsloser Mitglieder verloren.
Veränderungen hat es auch bezüglich der Reproduktions- und Sozialisationsfunktion der Familie gegeben. Zum einen ist die Zeugung als eine zentrale Funktion der Ehe in den Hintergrund getreten, werden weniger Kinder geboren. Das generative Verhalten führt zu einer Abnahme und zunehmenden Alterung der Bevölkerung: So stieg das durchschnittliche Alter aller Personen von 27,1 (1900) über 34,7 (1950) auf 39,3 Jahre (1985); es soll im Jahr 2030 für Männer 45,8 und für Frauen 48,8 Jahre betragen (Der Staatsbürger, Juli 1990). Zum anderen sind die Erwartungen der Gesellschaft an die Sozialisation von Kindern und die Ansprüche der Eltern an sich selbst als Erzieher gestiegen. So macht nicht nur die Umwelt das Ehepaar für das Verhalten ihrer Kinder verantwortlich, sondern dieses übernimmt auch von sich aus die Verantwortung, insbesondere für die ersten Lebensjahre. Während Eltern einerseits für längere Zeit als früher ihre Kinder betreuen müssen, sind andererseits viele Erziehungs-, Bildungs- und Ausbildungsaufgaben von Kindergarten, Schule und Universität (sowie von der Wirtschaft) übernommen worden, deren Angebote in gleichem Maße ausgebaut wurden (Ausweitung des öffentlichen Sektors). Kinder, Jugendliche und Studenten sind dementsprechend aus der Erwachsenenwelt ausgegliedert und eigene, vielfach pädagogisch arrangierte Lebensbereiche integriert worden, in denen andere Normen, Erwartungen und Regeln gelten. Aber auch die Erziehungsziele haben sich geändert. Anstatt von Gehorsam, Ordnungsliebe, Höflichkeit usw. werden Selbständigkeit, Mündigkeit, Emanzipation u.Ä. gefordert - während gleichzeitig Jugendliche und junge Erwachsene länger als je zuvor materiell und finanziell von ihren Eltern abhängig bleiben: Oft dauert es 20 Jahre länger als im Mittelalter, bis sie sich selbst ernähren können. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass Erziehungsziele heute weniger geschlechtsspezifisch sind, aber häufiger sehr hohe Anforderungen an die Kinder beinhalten.
Eine Funktion der Familie, die im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte an Bedeutung gewonnen hat, ist die der emotionalen Stabilisierung. Gerade weil die Außenwelt vielen Menschen aufgrund von Technisierung, Rationalisierung und Bürokratisierung immer kälter und inhumaner erscheint, ist für sie die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse und der Wünsche nach Solidarität, Intimität und gefühlsmäßiger Verbundenheit innerhalb der Familie sehr wichtig geworden. Häufig finden sie nur noch dort die Möglichkeit für ein dialoghaftes, tief gehendes Gespräch.
Aber auch die Freizeitfunktion der Familie hat gegenüber früher an Bedeutung gewonnen. Zum einen steht mehr arbeitsfreie Zeit zur Verfügung, die zusammen mit anderen Familienmitgliedern für gemeinsame Aktivitäten oder im Rahmen der vielfältigen Angebote der Freizeitindustrie genutzt werden kann. Zum anderen ist aufgrund der meist einseitigen beruflichen Belastung, des hohen Leistungsdrucks und der neu geweckten Bedürfnisse der Wunsch nach Erholung, Regeneration des Arbeitsvermögens und abwechslungsreichen Aktivitäten größer geworden.
Abschließend ist festzuhalten, dass es in der Vergangenheit viele unterschiedliche Familienformen und Lebensweisen in Deutschland gab. Familien, wie wir sie aus eigener Beobachtung und Erfahrung kennen, sind das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses und unterscheiden sich stark von früheren Familienformen - selbst von solchen, die zu Beginn dieses Jahrhunderts weit verbreitet waren. Somit wird offensichtlich, dass Familie und Familienleben durch Wirtschaft, Staat, Kirche, Kultur, Wissenschaft usw. geprägt werden. In vielerlei Hinsicht sind sie also ein Produkt ihrer Zeit. Nur wenige Charakteristika wie zum Beispiel die Reproduktionsfunktion sind relativ konstant geblieben, und dieser Wandel von der Familie und vom Familienleben dauert heute noch fort.
Vorstellungen von der Familie
Im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte entstanden verschiedene Vorstellungen von der Familie, insbesondere das christliche, das bürgerliche und das sozialistische Familienbild. Es handelt sich hier um rechtanschauliche und emotional getönte Leitbilder, die sich auf die "richtige" Gestaltung des Familienlebens beziehen. Sie werden zumeist von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen (Kirchen, Schichten, Parteien usw.) getragen, stehen in einem engen Zusammenhang zu Weltanschauungen, Religionen und Ideologien, werden von den jeweiligen gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Strukturen geprägt und wandeln sich somit im Verlauf der Zeit. Dem Einzelnen dienen derartige Familienbilder zur Orientierung und lenken sein Handeln in bestimmte Bahnen, werden aber zumeist nur annäherungsweise erreicht. Auch Sozialpädagogen beurteilen oft das Familienleben ihrer Klienten anhand derartiger Leitbilder.
Das christliche Familienbild
Die christlichen Vorstellungen von Ehe und Familie beruhen auf der Bibel und auf kirchlichen Traditionen. Sie sind recht unterschiedlich, da sich weder im Alten und Neuen Testament noch in der Kirchengeschichte eindeutige Aussagen finden lassen. Vielmehr werden in der Bibel eine Fülle verschiedenartiger familialer Lebensformen beschrieben, und in der christlichen Überlieferung gibt es höchstunterschiedliche Lehren. Im Alten Testament wurden schon in der Schöpfungsgeschichte Notwendigkeit und Sinn der Ehe dargestellt: So sollten sich die Partner gegenseitig ergänzen (l. Mose 2, 18), "ein Fleisch" werden (1. Mose 2, 24) und fruchtbar sein (1. Mose 1, 28). Zudem wurde der Frau die gleiche Würde wie dem Mann zugesprochen, da sie ebenfalls im Ebenbild Gottes erschaffen wurde (1. Mose 1, 26 - 27). Hinsichtlich der Familienform lässt sich wohl eine Tendenz zur Monogamie feststellen, aber auch die Polygamie (Extremfall: Salomos 700 Frauen und 300 Nebenfrauen) wurde akzeptiert. Die Familien waren patriarchalisch strukturiert. Die Kaufehe war üblich; die Frau war der Gewalt des Mannes unterstellt, galt als sein Besitz und sollte vor allem den Fortbestand seiner Familie sichern. Dementsprechend war auch das Scheidungsrecht in erster Linie ein Recht des Mannes. Die Position der Frau wurde aber dadurch aufgewertet, dass sie durch die Zehn Gebote vor Nachstellungen der Männer (2. Mose 20, 17) und vor Ehebruch (2. Mose 20, 14) geschützt wurde. Zudem konnte sie wie ihr Mann Gehorsam, Achtung und Fürsorge ihrer Kinder beanspruchen (2. Mose 20, 12). Die Familie wurde auch als Glaubens- und Kultusgemeinschaft geschätzt; die Ehe wurde dadurch überhöht, dass der Bund Gottes mit seinem Volk als ihr Urbild bezeichnet wurde (Sprüche 2, 17). Daraus wurde gefolgert, dass sich der Ehemann seiner Frau personal und fürsorgend zuwenden sollte.
Im Neuen Testament wurde einerseits die Familie (im Sinne der Ursprungsfamilie) geringer geschätzt: Pflichten gegenüber Gott gehen familiären Verpflichtungen vor und können sogar zum Bruch mit der Herkunftsfamilie führen. So tut recht, wer seine Familie verlässt und Gott nachfolgt (Markus 10, 20 - 30; Lukas 9, 59 - 62); ist eine Person Christi Bruder oder Schwester, wenn sie Gottes Willen tut (Markus 3, 33 - 35). Zudem ordnete Paulus den Zölibat der Ehe über und wertete die Geschlechtlichkeit ab (1. Korintherbrief 7).
Andererseits wurde der Ehe große Achtung entgegengebracht und durch eine Verschärfung der Bestimmungen über Scheidung und Ehebruch noch bessergeschützt: Sie wurde als Abbild der Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche bezeichnet (Epheserbrief 5, 21 - 33). Ein Mann verstößt schon gegen den Willen Gottes, wenn er eine Frau nur anschaut und dabei begehrt (Matthäus 5, 27 - 28), wenn er ihr - wie zuvor erlaubt - einen Scheidebrief gibt(Matthäus 5, 32) oder wenn er eine Geschiedene freit (Matthäus 19, 9). Eine Scheidung ist nur noch bei Ehebruch erlaubt (a.a.O.); ansonsten darf nicht getrennt werden, was Gott zusammengefügt hat (Matthäus 19, 1 - 12).
Auch im Neuen Testament wurde eine patriarchalische Familienstruktur vertreten: Frauen, Kinder und Gesinde waren dem Mann untergeordnet und sollten ihm gehorchen (Kolosserbrief 3, 18 - 22; l. Petrusbrief 3, 1). Wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so sollte der Mann das Haupt der Frau sein(Epheserbrief 5, 22 - 23). Einerseits wurde die Frau als ungleichbetrachtet, da sie später und um des Mannes willen erschaffen wurde (1. Korintherbrief 11, 8 - 9) und da die Erbsünde auf ihr lastet (l.
Timotheusbrief 2, 13 - 14); dementsprechend hatte sie zum Beispiel in der Gemeinde zu schweigen (l. Korintherbrief 14, 34) und durfte nicht lehren (1. Timotheusbrief 2, 12). Auch kann sie unter anderem nur durch das Gebären von Kindern selig werden (1. Timotheusbrief 2, 15). Andererseits sind Mann und Frau als Gottes Kinder gleich (Galaterbrief 3, 26 - 28), kann die Frau durch ihren Glauben einen ungläubigen Mann heiligen (1. Korintherbrief 7, 14). Auch sollte der Mann seine Frau so lieben, wie er sich selbst und wie Christus seine Gemeinde liebt (Epheserbrief 5, 25 - 32). So wurde die Ehe weniger als ein Besitzverhältnis gesehen, sondern mehr als eine durch die Liebe geprägte personale Beziehung. Auch gegenüber den Kindern sollten die Väter ihre Autorität liebevoll ausüben; sie sollten sie nicht reizen (Epheserbrief 6, 4) oder einschüchtern (Kolosserbrief 3, 21).
Bedingt durch die verschiedene Auslegung der Bibel und die unterschiedliche Tradition müssen ein katholisches und ein evangelisches Familienbild unterschieden werden. Ihre Darstellung erfolgt anhand lehramtlicher Aussagen - von denen die subjektive Deutung und Praxiseinzelner Christen durchaus abweichen können.
(1) Die katholische Tradition: In der kirchlichen Überlieferung wurden Ehe und Familie von der Katholischen Kirche als "zweite Wahl" gegenüber dem Zölibat und der Ehelosigkeit betrachtet. Damit einher ging eine negative Haltung gegenüber der Sexualität.
So war die leiblich-seelische Freude am Geschlechtsverkehr seit den Kirchenvätern Clemens von Alexandria, Gregor von Nyssa und Augustinusverdächtig, galten gute Menschen als durch Geschlechtlichkeit und Leiblichkeit gefährdet. Dementsprechend wurde Geschlechtsverkehr nur zur Vermeidung von Unzucht zugelassen, wobei er selbstverständlich auf die Ehebeziehung zu beschränken war. Auch sollten die Ehegatten bestrebt sein, nur bei dem bewussten Wunsch nach einem Kind sexuell miteinander zu verkehren. So wurde im Codex Juris Canonici (1918), dem alten kirchlichen Gesetzbuch, als Hauptzweck der Ehe die Erzeugung (und Erziehung) von Kindern festgelegt. In der Vergangenheit waren viele Vertreter der Katholischen Kirche (zum Beispiel Thomas von Aquin) der Auffassung, dass die Frau im Vergleich zum Mann geringerwertig sei. Zugleich wurde eine patriarchalische Ehe- und Familienstruktur für richtig erachtet, die nur von sehr wenigen Vertreter der Katholischen Kirche hinterfragt wurde.
Erst das 2. Vatikanische Konzil (1962 - 1965) führte zu einem Perspektivenwechsel: Die Beziehung zwischen den Ehepartnern wurde als eine partnerschaftliche definiert. Die Ehe wurde weniger als ein Vertrag denn als ein durch Gott geheiligter Bund gesehen und als ein Weg zum Heil betrachtet; die gegenseitige Förderung der Partner in ihrer Glaubensentwicklung wurde betont.
Erst seit dem Konzil von Trient (1563) gilt die Ehe in der Katholischen Kirche als ein Sakrament, das von Jesus Christus eingesetzt wurde. Wie jedes Sakrament ist auch die Ehe Gedächtnis, Vollzug und Prophetie des Heilsgeschehens: So soll erstens der Taten Gottes gedacht (Ehe und Partnerschaft als Zeichen der Gnade Gottes), zweitens die unendliche Liebe Gottes bezeugt (indem die Partner diese durch zwischenmenschliche Liebe in ihren Familienbeziehungen sichtbar machen und einander die Treue halten) und drittens Hoffnung auf eine zukünftige Begegnung mit Christus gezeigt werden. Zugleich gewinnt die Ehe ihren Heilssinn dadurch, dass sie den neuen, ewigen und unlösbaren Bund zwischen Jesus Christus und seiner Kirche symbolhaft darstellt (also eine untrennbare Einheit ist). Auch bildet sie dessen bräutliche Liebe zeugnishaft ab. Die eheliche Gemeinschaft ist also ein Zeichen der Verbundenheit Christi mit seiner Gemeinde und lässt die Partner die bedingungslose Zusage Gottes erfahren. Daraus, aber auch aus der Hoffnung heraus, dass sie nach ihrem Tode weiterleben werden, gewinnen diese die Kraft, als christliche Eheleute in einer unauflösbaren, durch unbedingte Treue gekennzeichneten Einheit zu leben. Eine Scheidung dieser von Gott gewollten Verbindung ist dementsprechend nicht möglich und wird von der Katholischen Kirche verboten. Auch können nichteheliche Lebensgemeinschaften nicht mit einem derartigen unauflösbaren Bund gleichgesetzt werden.
In der kirchlich geschlossenen Ehe wird die natürliche Liebe der beiden Ehepartner vollendet: Gott berief die Menschen zur Liebe und zum Dienst am Leben, als er sie aus Liebe nach seinem Bilde erschuf. Die Partner können sich in ihrer leib-seelischen Ganzheit in die Ehebeziehung einbringen und sollen einander unbedingt annehmen, einschließlich ihrer Schwächen.
Ihre Liebe hat laut der Lehrmeinung der Katholischen Kirche etwas Totales an sich, umfasst alle Dimensionen der Person, führt zur gegenseitigen Ergänzung von Mann und Frau, zur Verbindung von Körper, Geist und Seele. In der Ehe haben beide Partner dieselbe Würde und dieselben Rechte, sind Mann und Frau einander gleichgestellt. Auch findet ihre Geschlechtlichkeit in der sie verbindenden intensiven Liebesbeziehung den für sie vorgesehenen Platz. So heißt es in dem Beschluss "Christlich gelebte Ehe und Familie" der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland: "Die unbefangene, sittlich verantwortete Verwirklichung der Geschlechtlichkeit in der Ehe bietet den Partnern vielfache positive Möglichkeiten: Sie fördert die personale Entwicklung des Mannes und der Frau, vermittelt die Erfahrung lustvoller Hingabe, vertieft die Freude am Ehepartner, setzt opferbereiten Verzicht voraus, stärkt den Willen, füreinander da und in Treue verbunden zu sein, und trägt so zum Gelingen der Ehe bei. Die sexuelle Begegnung in der Ehe ist aber nicht nur auf die Vollendung der Gatten und auf deren vertiefte Zusammengehörigkeit, sondern ebenso auch auf die Weckung neuen Lebens und auf die Erziehung der Kinder hingeordnet" (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 1975: 25, 26). Die lebensschenkende Fruchtbarkeit entspricht also dem Wesen der ehelichen Liebe; in der Geburt eines Kindes findet diese ihre Krönung und Vollendung. Zugleich ist die Weitergabe des Lebens ein Abbild der göttlichen Schöpfungskraft: Die Ehepartner werden zu Mitarbeitern Gottes, da sie seinen Willen verwirklichen. Dabei sollten sie laut der Lehrmeinung der Katholischen Kirche verantwortungsbewusst handeln und bei ihrer Entscheidung für (oder gegen) ein Kind die familialen Gegebenheiten (materielle Situation), die Eigenschaften der Gatten sowie das Wohl der Erwachsenen, der bereits geborenen Kinder und der Gesamtgesellschaft berücksichtigen. So wird eine Geburtenregelung durch Enthaltsamkeit oder die Zeitwahlmethodeerlaubt. Jegliche Art der künstlichen Empfängnisverhütung, einschließlich von coitus interruptus und Sterilisation, wird jedoch verboten, da sie ein Verstoß gegen die natürliche, gottgegebene Ordnung sei, die für alle Arten gelte (Thomas von Aquin). Es ist selbstverständlich, dass auch Abtreibung und Eingriffe in das genetische Erbe des Menschen als Verstöße gegen die "natürliche" Ordnung und das Sittengesetz abgelehnt werden.
Durch die Realisierung der Fruchtbarkeit wächst die Familie als die umfassendere Gemeinschaft aus der Ehe heraus, entfaltet sich das Sein als Vater und Mutter aus dem Sein als Mann und Frau. Nach den lehramtlichen Äußerungen der Katholischen Kirche werden Gottesebenbildlichkeit und Teilhabe am Bund Gottes in der Familie stärker erfahren als in der Ehe: Der Vater verdeutlicht die Vaterschaft Gottes; die elterliche Liebe ist ein Sinnbild der Liebe Gottes; die Gemeinschaft von Vater, Mutter und Kind gilt als Abbild der Dreifaltigkeit; die Erziehung der Kinder ist eine Teilnahme am Schöpfungswerk und wird durch das Ehesakrament zu einem "Amt" der Kirche.
In der Familie als "Kirche im Kleinen" (Chrysostomus) wird den Kindern das Evangelium verkündet, werden sie zu den Grundwerten der Gerechtigkeit, der Achtung der personalen Würde des anderen und der Nächstenliebe hingeführt, erfahren sie Hingabe und Aufopferungsbereitschaft, lernen sie ihre persönliche Berufung kennen. Die Eltern sollen sie zu Glauben, Keuschheit und Sittlichkeit durch Vorbild, Lehre und gemeinsames Gebet erziehen, ihnen moralische und religiöse Überzeugungen vermitteln und sie in die Kirche als Familie Gottes einführen (Feier der Sakramente, Besuch der Messe). Die christliche Religion sollte die ganze Familie durchdringen und sie zu einem Hort der Frömmigkeit und Liebe machen. Indem diese zu einer Schule des Laienapostolats wird, kann sie an der Sendung der Kirche mitwirken: So soll sie anderen Menschen den katholischen Glauben und die Liebe Christi verkünden (Missionsgeist, prophetischer Auftrag) und durch den täglichen Dienst an Schwachen, Kranken, Armen und Alten an der christlichen Weltgestaltung mitarbeiten. Staat und Gesellschaft sollen das ursprüngliche, unableitbare und unveräußerliche Erziehungsrecht der Eltern respektieren und ihnen angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten im öffentlichen Bildungssystem einräumen. Auch haben sie die Familie bei ihrer Aufgabenerfüllung zu unterstützen, da diese als Schule sozialer Tugenden (Solidarität, Dienst am Nächsten, Dialogfähigkeit usw.) und als Vermittler ethischer, geistiger und religiöser Werte einen unverzichtbaren Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft und zum Wohlergehen ihrer Mitglieder leistet.
(2) Die evangelische Tradition: In der Reformationszeit brach Martin Luther auch mit der lehramtlichen Auffassung der Katholischen Kirche von der höheren Qualität des Zölibats und von dem Ehesakrament als "kirchlich verwaltetem Gnadenmittel". So bezeichnete er einerseits Ehe und Familie (neben dem Beruf) als Orte der Bewährung vor Gott, während er andererseits in der Eheschließung ein weltliches Rechtsgeschäft sah, das durch den Staat zu regeln sei. Dementsprechend gab es auch bis ins 18. Jahrhundert hinein keine protestantischen Trauungen - die auch heute nur als Bestätigung des bereits erfolgten rechtskräftigen Eheversprechens vor Gott betrachtet werden. Für Luther waren das persönliche Gewissen und das Bibelwort der Maßstab für die Gestaltung des Ehe- und Familienlebens.
Heute wird bei der Interpretation der Bibel der Zeitgeist berücksichtigt; zum Beispiel gilt die Überordnung des Mannes, wie sie im Alten und Neuen Testament vertreten wird, als Phänomen früherer Epochen. Stattdessen werden in der Evangelischen Kirche nun die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau vertreten. Beide Geschlechter sind einander zugeordnet und aufeinander angewiesen; ihre Bestimmung ist die Gemeinschaft, das partnerschaftliche Zusammenleben. So entspricht ihre Verbindung dem Willen Gottes. Die Ehe ist eine Ordnung beziehungsweise "Stiftung" Gottes, ein Zeichen seiner Liebe zu den Menschen. Mann und Frau erfahren in der Begegnung mit der Andersartigkeit des Partners eine Ergänzung und eine leiblich-seelische Vereinigung.
Die Ehebeziehung wird laut Lehre der Evangelischen Kirche als eine personale und eine Liebesgemeinschaft gesehen, in der die Partner sich selbst und den anderen immer besser kennen lernen, gemeinsame Ziele und Werte verfolgen, aufeinander Rücksicht nehmen, einander helfen und füreinander leben. Da diese die volle Verantwortung für ihre Ehebeziehung haben, können sie sie auf höchst unterschiedliche Weise ausgestalten. Jedoch sollten Liebe, Vertrauen und Treue immer zu den herausragenden Merkmalen ihrer Gemeinschaft gehören. So wird auch in der Evangelischen Kirche von der Einehe ausgegangen, die grundsätzlich für die Dauer des Lebens geschlossen wird und sexuelle Beziehungen zu anderen Personen (Ehebruch) ausschließt. Dennoch bejaht sie das Scheidungsrecht, da sie um die Macht der Sünde weiß und die Gefährdung von Kindern durch pathogene Ehebeziehungen ausschließen möchte. Jedoch betrachtet sie die Trauung Geschiedener prinzipiell als Ausnahme, die nur dann erfolgen darf, wenn durch Buße und Vergebung ein neuer Anfanggesetzt wurde. Generell wird aber davon ausgegangen, dass Ehekonflikte und Krisen ohne Auflösung der Ehe durchgestanden werden sollten.
Nach der Lehrmeinung der Evangelischen Kirche hat der Geschlechtsverkehr seinen eigentlichen Platz in der Ehe, sind außereheliche sexuelle Beziehungen verboten. Hingegen gibt es unterschiedliche Auffassungen bezüglichvorehelicher Kontakte. So fordern einige Stimmen Enthaltsamkeit, Triebkontrolle und Keuschheit, während andere Geschlechtsverkehr von verlobten oder eng befreundeten Paare innerhalb einer dauerhaftenganzheitlichen und personalen Beziehung akzeptieren und nur flüchtige Kontakte mit wechselnden Partnern ablehnen. Die Sexualität sollte innerhalb der Ehe Teil des personalen Lebens sein, wobei eine Geschlechtsgemeinschaft auch nach Erlöschen der Fortpflanzungsfähigkeit nicht abgelehnt wird.
Beide Partner sollten im sexuellen Bereich gleichberechtigt sein. Bei der gemeinsamen Entscheidung über die Zahl der Kinder und den Abstand zwischen den Geburten sollten sie berücksichtigen, wie ihr Gesundheitszustand ist, ob ihre Liebes- und Erziehungsfähigkeit für ein weiteres Kind ausreicht, ob dieses die Entwicklungsmöglichkeiten der anderen beschneiden wird und ob die materiellen Voraussetzungen gegeben sind. Somit ist die Verwendung empfängnisverhütender Mittel gestattet, ein generelles Nein zu Kindern wird aber abgelehnt: Jede Ehe sollte in eine Familie münden. Ein Schwangerschaftsabbruch wird nicht erlaubt - es sei denn, eine medizinische Indikation oder eine Vergewaltigung liegen vor.
Davon ausgehend, dass Kirche, Staat und Gesellschaft von der Sozialisationsleistung der Familie abhängig sind, wird in der Lehre der Evangelischen Kirche die große Bedeutung der Familienerziehung betont: Die Kinder sind ihren Eltern von Gott anvertraut worden, damit diese sie in das Leben und den Glauben hineinführen. Ihre Erziehung müsse sowohl nützlich als auch christlich sein, so dass sich die Kinder in Beruf, Gesellschaft und Kirche bewähren und ein sensibles Gewissen ausbilden können. Die religiöse Erziehung sollte in erster Linie dadurch erfolgen, dass die Familie zu einem Ort des Glaubens, des Gebetes und des Lesens der Bibel gemacht wird und die Eltern durch ihr Verhalten den Kindern als Vorbild dienen. Aber auch die Sexualerziehung gilt als wichtige Aufgabe der Eltern. Sie sollten die Kinder in ihrer Geschlechtlichkeit annehmen, sie aufklären und zu Liebesfähigkeit führen. Eine große Bedeutung komme dabei der Ehe der Eltern zu: Sie sollte Vorbild für die partnerschaftliche Begegnung der Geschlechter sein.
Das bürgerliche Familienbild
Das bürgerliche Familienbild, das erst im Laufe des 19. Jahrhunderts entstand und zunehmend zur gesellschaftlichen "Norm" wurde, entspricht einer Idealisierung der oben bereits beschriebenen Form der bürgerlichen Familie und soll deshalb hier nur kurz behandelt werden. Es beruht auf einer Aufteilung der Welt in einen außerhäuslichen Bereich des Geldverdienens, Geschäftemachens und Eigeninteresses sowie in einen familialen Bereich der Liebe und schenkenden Hingabe. Dem entspricht eine scharfe Trennung zwischen der Rolle der Frau und der des Mannes. So soll die Frau Empfindsamkeit, Emotionalität, Sittlichkeit, Kultur und Frömmigkeit verkörpern. Sie ist für die Binnenbeziehungen der Familie, die gemütliche Ausgestaltung des Heims, die sparsame und tüchtige Haushaltsführung sowie die Kindererziehung zuständig. Der Mann vertritt hingegen die Familie nach außen, unterhält sie finanziell, bestimmt ihren Status durch die Art seiner Berufstätigkeit sowie die Größe seines Vermögens und besitzt in ihr die höchste Autorität. Seine Interessen liegen vor allem im wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Bereich. Untermauert wird diese Rollenzuschreibung durch den Glauben an verschiedene Geschlechtscharaktere: So wird der Mann als mehr aktiv und rational, die Frau hingegen als mehr passiv und emotional bezeichnet.
Da die Freiheit der Partnerwahl garantiert ist, heiraten Mann und Frau aus Liebe und Neigung. Somit hat ihre Ehe keinen Zweck außer sich selbst. Sie ist ein moralisches Verhältnis und wird nach außen hin starkabgegrenzt, so dass Privatheit eines ihrer wichtigsten Charakteristika ist. Auch sollte die Ehe nach dem bürgerlichen Familienideal eine freie, fortdauernde Liebesgemeinschaft sein, in der geistige Übereinstimmung herrscht und beide Gatten ihre Persönlichkeit entfalten können. Die Sexualität bleibt auf die Partnerbeziehung beschränkt; vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr sind verboten. Treue gilt als ein wichtiger Wert und als Grundlage der Ehe.
Besondere Bedeutung kommt nach dem bürgerlichen Familienbild der Erziehung zu, die als eine höchst persönliche Verantwortung der Eltern gilt. Obwohl die Elternrechte stark betont werden, finden gleichzeitig das Wohl und die Menschenwürde des Kindes große Beachtung - letztlich steht es im Mittelpunkt der Familie. Allerdings muss es sich immer der Autorität der Eltern (insbesondere des Vaters) unterordnen. Damit es alle seine Fähigkeiten entfalten kann, sollte ihm ein Höchstmaß an Förderung zukommen, entsprechend seiner Erziehungs- und Bildungsfähigkeit. Die Erziehung des Kindes und die Förderung seiner geistigen, emotionalen, moralischen und sozialen Entwicklung werden vor allem als Aufgaben der Mutter gesehen. Die Kennzeichen der Mutter-Kind-Beziehung im bürgerlichen Familienbild sind Emotionalität und Intimität. Die Mutter behütet ihre Kinder und schirmt sie von der Außenwelt ab. Da der Bildung eine große Bedeutung zugesprochen wird, achtet sie sehr auf deren Schulleistungen. Zumeist wird ein Studium für die Kinder angestrebt, für das beide Eltern große Opfer zu erbringen bereit sind. Im Gegensatz zum 19. und zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielen geschlechtsspezifische Erziehungs- und Bildungsziele heute bei Vertretern des bürgerlichen Familienbildes eine geringere Rolle. Auch wird eine Berufstätigkeit der Frau bis zur Hochzeit beziehungsweise bis zur Geburt des ersten Kindes toleriert.
Das sozialistische Familienbild
Das sozialistische Familienbild entstand im 19. Jahrhundert. Es beruht auf einer Analyse der geschichtlichen Entwicklung und der damaligen Gesellschaftsstruktur. Laut Engels sind drei Hauptformen der Familie in der Geschichte der Menschheit zu finden, nämlich die Gruppen-, die Paarungs- und die monogame Familie.
Innerhalb der Familie kam es zuerst zu einer Aufgabenteilung, die zur wirtschaftlichen Arbeitsteilung und zur Ungleichheit der Menschen führte. Aufgrund dieser Entwicklung und des Siegs des Privateigentums über das ursprüngliche Gemeineigentum bildete sich dann die bürgerliche Einzelfamilie heraus, die auf der offenen oder verhüllten "Haussklaverei" der Frau gründete: Ihre Energie wurde mit unproduktiver Hausarbeit verschwendet; der Mann verfügte über ihre Arbeitskraft. Durch die Konzentration von Einkommen und Besitz in den Händen des Mannes gewann er eine Machtstellung gegenüber Frau und Kindern, die der Herrschaft des Bourgeois über den Proletarier entsprach. So gab es in der Familie im Kleinen dieselben Klassengegensätze wie in der Gesellschaft im Großen. Für die Partnerwahl des Bürgers waren laut der sozialistischen Gesellschaftsanalyse in erster Linie ökonomische Motive ausschlaggebend. Da Geld und Langeweile in der bürgerlichen Familie das Bindende waren und die Partner oft nur gezwungenermaßen zusammenlebten, tendierte der Mann zu häufigem Ehebruch und Heimlichtuerei. So war das kapitalistische System nicht nur durch die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gekennzeichnet, sondern zum Beispiel auch durch den moralischen Verfall in Ehe und Familie.
Laut Marx und Engels war eine andere Situation in Arbeiterfamilien gegeben. Wohl führte einerseits die kapitalistische Wirtschaftsordnung zu Verarmung und Kinderarbeit, zum Zerbrechen von Familien und zur Prostitution aus Notwendigkeit der Existenzsicherung. Auch waren erwerbstätige Frauen besonders benachteiligt, da sie als industrielle Reserve gegen die Männer ausgespielt und schlechter bezahlt wurden. Andererseits entfielen in Proletarierfamilien aufgrund der Eigentumslosigkeit und der Berufstätigkeit der Frau die ökonomischen Grundlagen für die Vorherrschaft des Mannes. Somit war dort eine höhere Form der Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter zu finden, deren moralisches Fundament die Liebe war.
Marx und Engels schätzten die Ehe positiv ein. Sie betonten die sittliche Schönheit der geistigen Verbindung sowie die Heiligung des Geschlechtstriebes durch die Ausschließlichkeit der Partnerbeziehung. Auch sprachen sie sich für ihre Rechtsverbindlichkeit und Dauerhaftigkeit aus. In ihrer "Replik an die Kritiker eines Ehescheidungs-Gesetzentwurfs der Preußischen Regierung" wandten sie sich gegen Personen, die für eine Erleichterung der Scheidung eintraten, und warfen ihnen vor: "Sie stellen sich auf einen eudämonistischen Standpunkt, sie denken nur an die zwei Individuen, sie vergessen die Familie, sie vergessen, dass beinahe jede Ehescheidung eine Familienscheidung ist und, selbst rein juristisch betrachtet, die Kinder und ihr Vermögen nicht von dem willkürlichen Belieben und seinen Einfällen abhängig gemacht werden können. Wäre die Ehe nicht die Basis der Familie, so wäre sie ebenso wenig Gegenstand der Gesetzgebung, als es etwa die Freundschaft ist. ... Niemand wird gezwungen, eine Ehe zuschließen; aber jeder muss gezwungen werden, sobald er eine Ehe schließt, sich zum Gehorsam gegen die Gesetze der Ehe zu entschließen. Wer eine Ehe schließt, der macht, der erfindet die Ehe nicht, so wenig als ein Schwimmer die Natur und die Gesetze des Wassers und der Schwere erfindet. Die Ehe kann sich daher nicht seiner Willkür, sondern seine Willkür muss sich der Ehe fügen. ... Der Gesetzgeber ehrt also die Ehe, erkennt ihr tiefes sittliches Wesen an, wenn er sie für mächtig genug hält, viele Kollisionen bestehen zu können, ohne sich selber einzubüßen" (zit. nach Wingen 1984: 16, 17).
Somit setzten sich Marx und Engels für eine Erschwerung der Scheidung ein und achteten sehr auf das Kindeswohl. Sie haben aber kein eindeutiges Bild von der Stellung der Familie in der sozialistischen Gesellschaft entworfen. So finden sich nur vereinzelt Aussagen zu dieser Thematik; beispielsweise schrieb Engels Ende der 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts: "Welchen Einfluss wird die kommunistische Gesellschaftsordnung auf die Familie ausüben? Antwort: Sie wird das Verhältnis der beiden Geschlechter zu einem reinen Privatverhältnis machen, welches nur die beteiligten Personen angeht und worin sich die Gesellschaft nicht zu mischen hat. Sie kann dies, da sie das Privateigentum beseitigt und die Kinder gemeinschaftlich erzieht und dadurch die beiden Grundlagen der bisherigen Ehe, die Abhängigkeit des Weibes vom Mann und der Kinder von den Eltern vermittels des Privateigentums, vernichtet" (zit. nach Löw 1985: 88, 89).
Somit sollen laut Marx und Engels Mann und Frau einander in der Ehe gleichberechtigt, frei und auf der Grundlage der Liebe begegnen. Die Partner sind in der sozialistischen Gesellschaft unabhängig, da sie beide an der Produktion beteiligt sind (Berufstätigkeit als Bedingung für die Emanzipation der Frau). Auch können beide auf diese Weise ihre Selbstverwirklichung erreichen, die generell nur durch Arbeit möglich sei. Pflege und Erziehung der Kinder sollen in der sozialistischen Gesellschaft eine öffentliche Angelegenheit sein und ab einem bestimmten Zeitpunkt durch die Gesellschaft und auf deren Kosten erfolgen.
Das sozialistische Familienbild von heute beruht auf den genannten und ähnlichen Auffassungen. Da die Produktions- und Besitzverhältnisse sowie die Gesellschaft die Art und Weise der Begegnung der Geschlechter, die Bewältigung von Konfliktsituationen, die Familienstruktur und die Erziehung prägen, können positive zwischenmenschliche Beziehungen nur untersozialistischen Bedingungen entstehen.
So gehören zu den Voraussetzungen unter anderem die Vergesellschaftung des Privateigentums, ein neuer Charakter der Arbeit (keine Ausbeutung), die Aufhebung des Gegensatzes von Kopf- und Handarbeit, das Heranziehen aller Arbeitsfähigen zur Arbeit, die soziale Sicherheit und eine durch den Sozialismus bestimmte geistig-kulturelle Atmosphäre.
Auch müssen Mann und Frau rechtlich und ökonomisch gleichgestellt sein und alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Positionen ohne Benachteiligung eines Geschlechts besetzt werden. Die Frau ist in der sozialistischen Gesellschaft aufgrund ihrer Berufstätigkeit unabhängig und kann alle ihre Fähigkeiten in der Arbeit entfalten. Generell ist eine harmonische Verbindung von Beruf, gesellschaftlicher Betätigung und Familie möglich.
Unter diesen Bedingungen kann sich - so die Vorstellungen der Vertreter des Sozialismus - ein historisch neuer Familientyp entwickeln. Da es keine materiellen Motive für die Familiengründung mehr gibt, heiraten Männer und Frauen nur noch aus Liebe, Zuneigung, Vertrauen und wechselseitiger Anziehungskraft, ist die Freiheit der Partnerwahl aufgrund der Unabhängigkeit beider Seiten gegeben. So können sich stabile und harmonische Familienbeziehungen auf der Grundlage eines tiefen Zusammengehörigkeitsgefühls und auf einem Fundament der Liebe, der gegenseitigen Achtung und Hilfsbereitschaft ausbilden. Mann und Frau sind in Ehe und Familie gleichberechtigt, können die gegenseitige Entwicklung fördern und gemeinsam gleiche Verantwortung füreinander, den Haushalt und die Kinder übernehmen. Jedoch haben sie auch die Freiheit, jederzeit ihre Ehebeziehung wieder aufzulösen.
Zu den wichtigsten Funktionen der sozialistischen Familie gehören laut den Vertretern des sozialistischen Familienbildes die Reproduktion, die Befriedigung der physischen, geistigen und psychischen Bedürfnisse ihrer Mitglieder, die Erneuerung ihrer Arbeitskraft durch Erholung und Freizeit, die Unterstützung junger, alter und kranker Mitglieder (Solidarität) sowie die gegenseitige Ergänzung und Förderung. Ihre Hauptfunktion ist aber die Herausbildung einer allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeit bei Eltern und Kindern. Generell wird nicht nur von einer Übereinstimmung der Ziele und Interessen von Familie und Gesellschaft ausgegangen, sondern auch deren wechselseitige Abhängigkeit gesehen: Einerseits prägt eine sozialistische Gesellschaftsordnung die Familie, andererseits fördert diese den Sozialismus durch die Ausbildung entsprechender Persönlichkeitsstrukturen, Einstellungen und Verhaltensweisen.
Aufgrund dieser großen Bedeutung der Familie setzen Sozialisten hohe Erwartungen in sie, insbesondere in ihre Erziehungsfunktion. So sollen sich Ehepartner nur bewusst für Kinder entscheiden (Förderung der Geburtenregelung) und sich dabei von ihren Wunschvorstellungen, ihren Fähigkeiten und den gesellschaftlichen Notwendigkeiten leiten lassen. Ihre materiellen Möglichkeiten sind im Sozialismus aber nicht von Bedeutung: Die Eltern haben ein Anrecht auf die Unterstützung von Staat und Gesellschaft. Ihre Erziehung soll auf die Herausbildung der Individualität ihrer Kinder, die Förderung ihrer Begabungen, die Ausbildung positiver Lernhaltungen und die Befähigung zur Fortentwicklung des Sozialismus abzielen. Die Eltern sollen ihnen die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglichen, sie also nicht zum Objekt ihrer Wünsche machen und ihnen nicht ihren Willen aufzwingen. Sie sollen Söhne und Töchter gleich erziehen, sie sexuell aufklären und zu einem natürlichen Verhältnis zum anderen Geschlecht führen.
Da die Sozialisation der Kinder als gesellschaftliche Aufgabe aufgefasst wird, spielt auch die Erziehung der Kinder in öffentlichen Einrichtungen eine große Rolle. Diese soll allen Kindern die ihren Fähigkeiten am besten entsprechende Bildung ermöglichen - unabhängig von ihrem Geschlecht und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern (Chancengleichheit). Auch sollen Geist und Körper gleichermaßen geschult werden, wobei die polytechnische Bildung von großer Bedeutung ist. Die Eltern sollen durch Ausschüsse auf die Ordnung und den Prozess der öffentlichen Erziehung Einfluss nehmen können.
Teil 2 Die Familie in der Gegenwart
Nicht erst heute beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Familie. So stammen erste familienbezogene Erkenntnisse von Aristoteles und vielen anderen Philosophen, von Pädagogen wie Comenius, Rousseau, Pestalozzi und Salzmann, von den politischen Arithmetikern und den Autoren der "Hausväter-Literatur".
Aber erst seit dem 19. Jahrhundert stehen Ehe und Familie im Mittelpunkt (sozial-)wissenschaftlicher Analysen. Zumeist werden Riehl und Le Play, deren Hauptwerke im Jahr 1855 erschienen, als Begründer der Familiensoziologie genannt. Erste juristische und rechtshistorische Abhandlungen über Ehe und Familie stammen bereits aus den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts - historische (Engels), ethnologische (Morgan, Westermarck) und haushaltsstatistische (Mucke, Quételet) Arbeiten sind späteren Ursprungs. In der Sozialpädagogik setzte sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts die Einsicht durch, dass die ganze Familie konzeptionell und praktisch in die Arbeit einbezogen werden sollte. Auch die Psychologie wandte sich erst im gleichen Zeitraum der Familie zu. Dabei übernahm die Psychoanalyse eine gewisse Vorreiterrolle, die allerdings auf die Theorie beschränkt war: Die psychoanalytisch orientierte Praxis war bis in jüngste Zeit hinein individuumszentriert. So mussten sich zum Beispiel Familienberatung und -therapie in ihrer Anfangsphase (50er- und 60er-Jahre dieses Jahrhunderts) mit starken Widerständen seitens der Psychoanalytiker auseinander setzen.
In der Gegenwart beschäftigen sich Soziologen, Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, Historiker und Vertreter vieler anderer wissenschaftlicher Disziplinen mit der Familie - in Teil 1 dieses Buches wurden bereits viele Befunde aus der historischen Forschung dargestellt. Besonders viele Forschungsergebnisse und theoretische Abhandlungen zum Gegenstand "Familie" werden von der Familiensoziologie vorgelegt - während sich die Familienpsychologie und Familienpädagogik noch in ihren Anfängen befinden, hat sich diese Teildisziplin schon längst aus der Soziologie herausdifferenziert. Im Zusammenspiel mit der Sozialisationsforschung beziehungsweise der Untersuchung der demographischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Wandels erlebte die sozialwissenschaftliche Familienforschung Anfang der 60er-Jahre und seit Mitte der 80er-Jahre einen großen Aufschwung.
Heute erfolgt die Erforschung von Ehe und Familie auf der Grundlage einer Vielzahl von Theorien, die größtenteils allgemeiner Natur sind (also nicht nur für Familien gelten). Dazu gehören zum Beispiel der historische Materialismus (Engels, Secombe, Gardiner), der Strukturfunktionalismus (Parsons, Goode), die Systemtheorie (von Bertalanffy, Luhmann), die sozialen Austauschtheorien (Thibaut/Kelley, Homans, Nye), die Familien- und Haushaltsökonomik (Schultz, Becker), der Symbolische Interaktionismus (Mead, Blumer), lebensweltorientierte Ansätze (Schütz, Luckmann), tiefenpsychologische Theorien (Freud, Adler, Toman), die ökologische Familienforschung (Bronfenbrenner, Ries, Bargel), die Kritische Theorie (Habermas, Osmond), feministische Ansätze (Harding, Keller), die Kommunikationstheorie (Bateson, Watzlawick), der Familienzyklusansatz (Duvall, Hill, Rowntree) oder die Netzwerktheorie (Bott, Keupp). In der Vergangenheit lassen sich Phasen feststellen, in denen jeweils ein oder zwei der erwähnten Theorien im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses standen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert, von der Politik aufgegriffen oder für die Sozialarbeit relevant wurden. Es ist in diesem Buch leider nicht möglich, diese Theorien und ihre Bedeutung für die Familienforschung ausführlich darzustellen.
Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass schon die Vielzahl der genannten Theorien zeigt, dass keine von ihnen die Familienwirklichkeit als ganze um- und erfasst. Sie beziehen sich nicht auf die Gesamtheit aller beobachtbaren und erschließbaren Vorgänge in Familien, sondern nur auf Teilausschnitte familialer Realität. So beschäftigen sie sich zum Beispiel mit dem Einfluss der (kapitalistischen) Produktionsverhältnisse auf die Familienstruktur (historischer Materialismus), der funktionalen Binnendifferenzierung der Familie (Strukturfunktionalismus), den System-Umwelt-Beziehungen und der inneren Komplexität der Familie (Systemtheorie), den Kosten-Nutzen-Entscheidungen in Familienbeziehungen (soziale Austauschtheorien), der Rolle von Bedeutungen, Symbolen und Interpretationen im sozialen Handeln (Symbolischer Interaktionismus), den intrapsychischen und historischen Komponenten des Familienlebens (Tiefenpsychologie) usw.
Die Notwendigkeit, sich bei der wissenschaftlichen Analyse auf einzelne Teilbereiche der Familienrealität zu beschränken, wird deutlich, wenn wir uns die Komplexität von Familien und ihrer Lebenskontexte vor Augen führen - die Unmenge an Variablen kann von keinem Forscher erfasst, geschweige denn mit sozialwissenschaftlichen Methoden untersucht werden. Er muss deshalb seine Beobachtungen und Reflexionen auf eine sinnvolle und handhabbare Anzahl von Faktoren beschränken. Die von ihm entwickelte oder erweiterte Theorie und seine Forschungsergebnisse beziehen sich also nur auf diesen Ausschnitt der Familienwirklichkeit. Ein umfassendes Bild der Realität würde somit nur entstehen, wenn man die verschiedenen Theorien und die (auf ihrer Grundlage gesammelten) Forschungsergebnisse miteinander verknüpfen würde. Eine derartige integrative Theorie - wie ich sie zum Beispiel für den Bereich der Familientherapie zu entwickeln versucht habe (Textor 1985) -liegt jedoch noch nicht vor und kann im vorliegenden Buch auch nicht geschaffen werden. Dies ist nur in einem interdisziplinär zusammengesetzten Team möglich und wäre eine würdige Aufgabe für die von manchen Seiten geforderte Familienwissenschaft (Textor 1984; Nave-Herz 1989), die meines Erachtens nur integrativ arbeiten könnte. Bis zur Entwicklung einer integrativen Theorie kann nur davor gewarnt werden, eine der erwähnten Theorien zu verabsolutieren und sich in der praktischen Sozialarbeit auf diese zu beschränken.
Es wird deshalb in Teil 2 und 3 dieses Buches zur Analyse von Familien in der Gegenwart auf verschiedene (insbesondere psychologische und soziologische) Theorien zurückgegriffen, die jedoch nur zum Teil kurz skizziert werden können.
Zentrale Begriffe
Kommunikation und Interaktion
Das Familienleben ist in erster Linie Kommunikation und Interaktion, das heißt Austausch von Botschaften, Aufeinander-Reagieren und Miteinander-Handeln. So lässt sich Familie auch als Einheit kommunizierender und interagierender Personen in einem bestimmten Kontext definieren. Ferner kommen die meisten Veränderungen im Familiensystem durch Kommunikation, Aktion und Reaktion zustande. Zudem wirken sich über kommunikative Prozesse ökonomische, soziale, kulturelle, ökologische und andere Faktoren auf das einzelne Individuum und seine Sozialisation aus.
Somit kommt bei der Untersuchung von Familienprozessen der Kommunikationstheorie eine große Bedeutung zu. Generell werden bei Kommunikationsprozessen folgende drei Ebenen unterschieden: (1) Auf der verbalen Ebene werden Botschaften in der Form von Wörtern oder anderen Lautäußerungen zwischen zwei oder mehreren Personen ausgetauscht und mit Hilfe von Erfahrungen, Wissen, Erwartungen usw. verarbeitet. Die Gesprächsinhalte können von innerhalb oder außerhalb der Familie kommen. (2) Auf der nonverbalen Ebene werden Botschaften durch Lautstärke, Tonfall, Mimik, Gestik und Körperbewegungen übermittelt. Jede Verhaltensweise eines Familienmitgliedes in Anwesenheit einer anderen Person hat einen potentiellen kommunikativen Wert, da ihr zum Beispiel Hinweise auf dessen Stimmung, Ansprechbereitschaft, Position und Intention entnommen werden kann: Es kann nicht nicht kommunizieren. (3) Jede Botschaft muss auch im Kontext anderer Botschaften und der Beziehung zum Gesprächspartner sowie in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation gesehen werden. So reagieren Eltern zum Beispiel anders, wenn ein Kleinkind daheim oder im Familiengottesdienst während der Predigt zu singen beginnt.
Diskutieren Familienmitglieder darüber, weshalb sie bestimmte Botschaften gesendet haben, welchen Sinn eine Geste hatte oder welche Bedeutung einer Verhaltensweise zuzusprechen ist, betreiben sie Metakommunikation. Aus der Sicht des Symbolischen Interaktionismus spielen in Kommunikationsprozessen die Bedeutungen eine große Rolle, die Dingen oder Personen gegeben werden. "Diese Bedeutungen sind das Produkt sozialer Interaktionen, sie werden in einem Interpretationsprozess modifiziert, der auf dem Verständnis von gemeinsam verfügbaren (sprachlichen) Symbolen basiert. Interaktionen wiederum werden durch Symbole vermittelt" (Stein 1983: 190).
Familienmitglieder handeln somit auf der Grundlage von Bedeutungen, die im Austausch mit anderen definiert werden. Sie gehen auf das Handeln ihres Gegenübers aufgrund der ihm zugesprochenen Bedeutung ein: Interaktion muss also als ein interpretativer Prozess aufgefasst werden; das Verstehen von verbalen und nonverbalen Kommunikationsinhalten ist von größter Wichtigkeit. Zugleich werden durch die Wahrnehmung von zugeschriebenen Bedeutungen und durch sprachliche Typisierungen die Identität des einzelnen Familienmitgliedes geprägt: Es erfährt sich im Spiegel durch andere. Aber auch Rollen, Familienstrukturen usw. können als Ergebnis von Interpretations- und Deutungshandlungen verstanden werden.
In Familien ist ein unterschiedliches Ausmaß an Kommunikation festzustellen, wobei sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig problematisch sein können. Aber auch in den einzelnen Teilsystemen der Familie, also zum Beispiel in der Ehebeziehung oder im Eltern-Kind-Verhältnis, ist die Intensität der Kommunikation verschieden. Dasselbe gilt natürlich auch für die Gesprächsinhalte. Diese sind zudem abhängig von der Art der Berufstätigkeit und Freizeitgestaltung, den Sozialkontakten und Umweltbeziehungen, den jeweiligen Interessen und Einstellungen der Familie, aber auch von der erreichten Phase im Familienzyklus. Es wurde ermittelt, dass generell Themen wie Kinder, Verwandte, Konsumentscheidungen und Freizeitgestaltung im Mittelpunkt der Familienkommunikation stehen. Im Gespräch mit Kindern sind Schule, Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten und Freunde wichtige Themen. Dabei werden ihnen Informationen über die Beschaffenheit der dinglichen und sozialen Welt sowie über die Bedeutung ihrer Bestandteile vermittelt.
So lernen Kinder, welche Dinge wichtig und unwichtig sind, welche Lerninhalte mehr und welche weniger Berücksichtigung finden sollten, welche Interessen, Werte und Einstellungen akzeptabel sind. Zugleich werden die Art ihrer Wahrnehmung, ihr Bild von der Ordnung der Umwelt und ihre Zeitperspektive im Familiengespräch geprägt, übernehmen sie die für die jeweilige Familie typischen Kommunikationsinhalte und -stile.
Auf verbale Botschaften eines Individuums - aber auch auf dessen Verhaltensweisen - reagieren die anderen Familienmitglieder, wobei Erwartungen, Beziehungserfahrungen, Bedürfnisse, Emotionen, Werte und andere intrapsychische oder soziokulturelle Variablen eine vermittelnde Rolle spielen. Die auf solche Weise entstehenden Kommunikationssequenzen und Reaktionsabfolgen verlaufen normalerweise automatisch, gewohnheitsmäßig, regelhaft und voraussagbar ab - es lassen sich bestimmte Interaktionsmuster identifizieren. So ist zum Beispiel in vielen Familien die Kommunikation mutterzentriert, erfolgen Konflikte immer nach demselben Schema. Diesen Interaktionsmustern lassen sich bestimmte Beziehungsdefinitionen entnehmen, aus denen beispielsweise hervorgeht, welche Gesprächsinhalte und Verhaltensweisen in der jeweiligen Beziehung erlaubt sind und wer in ihr die meiste Macht besitzt.
Aus Interaktionsmustern lassen sich auch die mehr oder minder bewussten Familienregeln erschließen, die den Umgang der Familienmitglieder miteinander und mit anderen Personen bestimmen und die durch Sanktionen beziehungsweise deren Androhung aufrechterhalten werden. Sie legen zum Beispiel die Aufgabenteilung, die den Kindern erlaubten Verhaltensweisen und den Weg der Entscheidungsfindung fest. Meist werden sie immer wieder modifiziert und an die Entwicklung der Familie und ihrer Mitglieder angepasst. Viele Regeln werden durch Familienwerte, soziokulturelle Normen und religiöse Gebote geprägt.
Rollen
In der Rollentheorie wird als Rolle ein Bündel normativer Verhaltenserwartungen bezeichnet, die an den Inhaber einer mit bestimmten Funktionen, Rechten und Pflichten verbundenen Position gestellt werden. Diese Vorschriften sind von einem unterschiedlich hohen Grad der Verbindlichkeit und müssen zumeist aufgrund der sozialen Kontrolle befolgt werden. Sie werden von der jeweiligen Person internalisiert und zu eigenen Verhaltensmaßstäben gemacht. Die Ausübung einer Rolle zeigt sich in bestimmten Verhaltensweisen, die den an den Rollenträger gestellten Erwartungen entsprechen. Generell werden Primärrollen wie Geschlechts-, Alters- und Familienrollen von Sekundärrollen wie die des Schülers, Arztes oder Mitgliedes eines Sportvereins unterschieden. So vereinigt jedes Individuum in sich eine Vielzahl von Rollen. Diese können miteinander in Konflikt geraten, zum Beispiel wenn eine Frau nach der Geburt eines Kindes sowohl die Berufs- als auch die Mutterrolle ausüben will, oder das Familienmitglied überfordern (Rollenstress). Zudem kommt es manchmal zu Problemen, wenn unterschiedliche Erwartungen an den Träger einer Rolle gestellt werden, also beispielsweise Großeltern von einer Frau und Mutter ein anderes Erziehungsverhalten fordern als deren Mann. Das Familienmitglied kann sich aber auch von seinen Rollen distanzieren, sie verändern und in sie eigene Persönlichkeitscharakteristika einbringen. Deshalb üben nie zwei Personen dieselbe Rolle auf gleiche Weise aus. Somit erlaubt der Rollenbegriff die Überbrückung der Kluft zwischen der psychischen und der gesellschaftlichen Sphäre.
Für den Strukturfunktionalismus gelten Geschlecht und Generationszugehörigkeit als Bezugspunkte der familialen Strukturbildung: Je nach Alter und Geschlecht übernehmen Familienmitglieder bestimmte Familienrollen wie die des Ehepartners, der Mutter, des Kindes, des älteren Bruders oder des Onkels, die teilweise einander entsprechen sowie mit Befriedigungen und Belohnungen verknüpft sind. Diesen Rollen sind unterschiedliche Funktionen, Aufgaben, Rechte und Pflichten zu Eigen, die sich vielfach mit dem Alter und den Bedürfnissen der Betroffenen ändern (die Art und Weise der Rollenausübung wird in späteren Kapiteln behandelt). Manche Familienrollen, zum Beispiel die der Tochter oder des Sohnes, werden direkt nach der Geburt erlernt, andere erst nach dem Eintritt in eine bestimmte Phase des Familienzyklus, etwa die des Vaters oder der Mutter. Generell erfolgt die Übernahme einer Rolle durch Nachahmung, Identifikation, Verstärkung und andere Lernprozesse sowie im Rollenspiel.
Nach dem traditionellen Geschlechtsrollenleitbild, das vor allem der Strukturfunktionalismus betonte, wurden der Frau in erster Linie die Rollen der Ehepartnerin, Hausfrau und Mutter zugeordnet. Sie sollte expressive Funktionen verkörpern und galt als eher passiv, erduldend, sensibel, offen, emotional und hilfsbedürftig. Im Mittelpunkt ihres Lebens sollte das Umsorgen anderer Menschen und das Aufgehen in persönlichen Beziehungen stehen. Der Mann wurde hingegen überwiegend in seiner Berufsrolle und als "Herr im Hause" gesehen. Er sollte instrumentelle Funktionen verkörpern, aggressiv, hart, dominant, leistungsbereit, rational und tatkräftig sein sowie die Familie nach außen hin vertreten. Zumeist wurde das männliche Geschlecht höher bewertet als das weibliche.
Dieses traditionelle Geschlechtsrollenleitbild wurde vor allem in den 60er- und 70er-Jahren von der Studenten- und der Frauenbewegung in Frage gestellt. Heute wird es nur noch von wenigen jüngeren Menschen vertreten. So ergab eine repräsentative Befragung (SINUS 1983) von 15- bis 30-jährigen Bundesbürgern, dass nur noch wenige Eigenschaften und Fähigkeiten einem Geschlecht zugewiesen werden; Zärtlichkeit, Kinderliebe, Empfindsamkeit usw. werden als gleich wichtig für Männer und Frauen genannt. Nur die Beschützerrolle wird eindeutig dem Mann zugeordnet.
Aber noch immer wirkt das traditionelle Geschlechtsrollenleitbild nach, erschwert Frauen die Entfaltung instrumenteller und Männern die Entwicklung expressiver Fähigkeiten. Auch führt es im Beruf zu unterschiedlichen Aufstiegsmöglichkeiten und lässt manche noch an der Leistungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Begabung von Frauen zweifeln. So ergab eine im Jahr 1983 von INFRATEST durchgeführte repräsentative Befragung, dass 64% der Interviewten der Meinung waren, dass Männer bevorzugt werden. Nur 14% glaubten, dass Frauen die gleichen Chancen wie Männer hätten (nach Schmidtchen 1984). 11 Jahre zuvor wurden nahezu dieselben Befragungsergebnisse ermittelt.
Eine Umfrage bei 637 Paaren zwischen 18 und 33 Jahren (Erler/Jaeckel/Pettinger/Sass 1988) ergab, dass von Frauen ein starker Emanzipationsdruck ausgeht - insbesondere bei höherer Bildung, Berufstätigkeit und Kinderlosigkeit. Sie orientieren sich an einem emanzipativen Geschlechtsrollenleitbild, wollen partnerschaftlichere Männer. Für Letztere gilt hingehen: "Die Männer sehen sich leicht fortschrittlicher, als sie von ihren Partnerinnen beurteilt werden. Insgesamt fällt ihre Selbsteinschätzung aber sehr moderat aus: Die meisten ordnen sich um die Mitte unserer Skala zwischen 'traditionellem Mann'' und 'neuem Mann'' ein" (a.a.O.: 47). Sie wünschen sich weniger emanzipierte Frauen - während diese noch emanzipierter werden möchten und dementsprechend große Veränderungswünsche an ihre Partner richten. So sind Konflikte vorprogrammiert.
System
Aus systemtheoretischer Sicht wird die Familie als ein System konzeptualisiert, das heißt als ein Komplex von mehreren kleineren und größeren Einheiten. Diese Einheiten werden als Subsysteme bezeichnet und umfassen zum einen die einzelnen Familienmitglieder, zum anderen die Partner-, die Eltern-Kind- und die Geschwisterbeziehungen. Die Subsysteme grenzen sich voneinander ab; so weiß zum Beispiel ein Familienmitglied letztlich nie, was ein anderes denkt, fühlt und plant, wissen die Kinder nicht alles, was die Ehepartner miteinander besprechen, haben Geschwister ihre Geheimnisse gegenüber den Eltern. Jedes Subsystem kann am besten im Kontext des Gesamtsystems verstanden werden; das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile.
In allen größeren Subsystemen gibt es unterschiedliche Interaktionsmuster, Rollenerwartungen, Beziehungsdefinitionen, Regeln usw. So wird sich ein Erwachsener gegenüber seiner Tochter anders verhalten und mit ihr über andere Themen sprechen als mit seinem Ehepartner, macht ein Kind in dem Eltern-Kind-Subsystem andere Erfahrungen als im Geschwistersubsystem. Die Subsysteme sind voneinander abhängig, interagieren miteinander und erfüllen füreinander verschiedene Funktionen. Dementsprechend hat auch ein Ereignis in irgendeinem Subsystem Auswirkungen auf die anderen Subsysteme und das Gesamtsystem - ja es hat zumeist mehrere Folgen, die einander verstärken oder abschwächen können und die wiederum auf das Subsystem zurückwirken, in dem das diese Reaktionskette auslösende Ereignis auftrat (zirkuläre Interaktionen). Aufgrund dieser Rückkoppelung mögen wieder neue Veränderungen hervorgerufen werden - bei Systemprozessen und Interaktionsabläufen ist also letztendlich eine Unterscheidung von Ursache und Wirkung nicht möglich, sind die Markierungen von Anfang und Ende willkürlich.
Subsysteme und Familiensystem sind selbstregulierend. Sie versuchen, in ihrem Inneren ein bestimmtes Gleichgewicht (Homöostase, Äquilibrium) aufrechtzuerhalten. So werden Beziehungen hinsichtlich der Art und Intensität von Gefühlen, der Aufteilung von Aufgaben und des Austausches von Gütern ausbalanciert, werden nur bestimmte Verhaltensweisen zugelassen, wird die Bandbreite von Abweichungen festgelegt. Jedes Subsystem überwacht die anderen und achtet darauf, dass die Regeln, Interaktionsmuster, Beziehungsdefinitionen usw. eingehalten werden. Entsteht durch ein Ereignis in der Familie beziehungsweise in ihren Subsystemen (zum Beispiel durch einen Verstoß gegen eine bestimmte Regel, durch Erkrankung eines Familienmitgliedes oder durch die Geburt eines Kindes) oder durch eine Einwirkung von außen (beispielsweise durch den Verlust des Arbeitsplatzes des Vaters) ein Ungleichgewicht, versucht die Familie, entweder das alte Gleichgewicht wieder herzustellen oder ein neues zu finden. Familien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Strukturflexibilität und Wandlungsfähigkeit, wobei sich sowohl ein zu starres Gleichgewicht als auch fortwährende Veränderungen (wenn die Familienmitglieder nie zur Ruhe kommen) negativ auswirken können.
Das Familiensystem ist in größere Systeme wie die Arbeitswelt, den Stadtteil oder das Netzwerk aus Bekannten und Verwandten eingebettet und wird von ihnen beeinflusst. Es grenzt sich ihnen gegenüber ab, wobei diese Grenzen zumeist weniger durchlässig sind als die zwischen den familialen Subsystemen, aber die für die Familie lebensnotwendigen Austauschprozesse zulassen. Sie sind nicht nur als räumliche Grenzen (Wohnung) zu sehen, sondern auch als kognitive (Familienidentität, "eigene Welt"), emotionale (innere Verbundenheit, Liebe, Familienloyalität) und handlungsbezogene (bestimmtes Verhalten gegenüber Außenstehenden). Diese Grenzen dienen der Abschirmung gegenüber externer sozialer Kontrolle und Einmischung, garantieren die relative Autonomie und Privatheit der Familie.
Generell unterscheiden sich Familien hinsichtlich des Grades der Umweltoffenheit. So fördern offene Familiensysteme den Kontakt mit anderen Systemen, nehmen mehr Einflüsse auf, sind anpassungsfähiger und haben zumeist ein flexibleres Gleichgewicht. Ihre Mitglieder haben ein positives Weltbild und verhandeln oft miteinander über neue Regeln und Beziehungsdefinitionen, mögen aber auch viele Probleme aus anderen Systemen in die Familie hineintragen. Geschlossene Familiensysteme lassen hingegen weniger Austauschprozesse zu, setzen Veränderungsbestrebungen viel Widerstand entgegen und besitzen ein eher starres Gleichgewicht. Ihre Mitglieder sehen die Welt als gefährlich an, sind weniger kontaktfreudig und betonen Werte wie Beständigkeit, Gewissheit und Treue.
Die Ehe ist die Achse, um die herum alle anderen Familienbeziehungen gebildet werden. Die Ehegatten sind die "Architekten" der Familie (Satir 1967: 1). Ehemann und Ehefrau bilden eine Einheit, die sich durch einen intensiven verbalen, emotionalen und physischen Austausch, durch komplementäre Bedürfnisse, gegenseitige Unterstützung und Gefühle der Zuneigung, des Vertrauens und der Zusammengehörigkeit auszeichnet.
Der besondere Charakter der Ehebeziehung zeigt sich vor allem in der Liebe. Zunächst herrscht sie in ihrer mehr leidenschaftlichen Form vor: Die Partner sehnen sich nach der Nähe des anderen, lassen ihre Gedanken fortwährend um ihn kreisen, sind beschwingt und euphorisch. Ihre Stimmung ist vom Verhalten des anderen abhängig; ihre Angst vor Zurückweisung ist noch relativ stark ausgeprägt. Mit der Zeit kann ihre Liebe immer reifer, tiefer und intimer (aber auch routinierter, langweiliger und uninteressanter) werden: Die Kommunikation wird offener, bedeutungsvoller und sinnhafter; die Sensibilität für die Bedürfnisse und Wünsche des anderen wächst; die Bereitschaft zum Verzicht und Miteinanderteilen nimmt zu.
Die Sexualität spielt eine große Rolle in der Ehebeziehung, ist aber für das allgemeine Lebensglück weniger von Bedeutung als zum Beispiel Freundschaft, Liebe und Arbeit. 76% der Männer und 50% der Frauen halten die Sexualität für wichtig in ihrem Leben, 93 beziehungsweise 70% macht sie uneingeschränkt Spaß (Stern, 14.05. und 22.05.1980). Ehefrauen wünschen Geschlechtsverkehr generell seltener als Männer und messen ihm nicht die gleiche Bedeutung zu. Hingegen ist er für manche Männer die einzige legitime Möglichkeit des Gefühlsausdrucks. Diese initiieren zumeist sexuelle Interaktionen, obwohl die Zufriedenheit mit der Geschlechtsbeziehung bei einer größeren Aktivität der Frauen höher ist. Generell hat gegenüber früher die Häufigkeit von Geschlechtsverkehr zugenommen, ist gleichzeitig das Sexualleben vielfältiger geworden. Auch wird heute allgemein akzeptiert, dass beide Partner einen Orgasmus erleben sollten. Wird dieses jedoch von jeder sexuellen Interaktion erwartet oder rechnen beide Partner sogar immer mit einem gleichzeitigen Orgasmus, so mag der daraus resultierende psychische Druck zu sexuellen Störungen, dem Vortäuschen eines Orgasmus seitens der Frau oder anderen Problemen führen. Sexualwissenschaftliche Forschungsergebnisse zeigen nämlich, dass Frauen in der Regel nur gelegentlich einen Orgasmus erleben und dieser keine zwingende Voraussetzung für ihre Zufriedenheit mit der sexuellen Beziehung ist. Generell bewerteten bei einer Befragung (Stern, 14.05.1980) circa 20% der Interviewten ihr eigenes Sexualleben auf nicht positive Weise, was aber auch von der allgemeinen Qualität der jeweiligen Beziehung abhängig sein kann. In solchen Fällen tendieren beide Partner dazu, der Frau die Schuld zuzuschreiben.
Viele Prozesse innerhalb der Ehebeziehung können im Sinne der Sozialen Austauschtheorien als Ergebnis rationalen Handelns verstanden werden: Die Partner fällen unzählige Entscheidungen, um den aus ihrem Verhältnis gezogenen Nutzen zu maximieren und die Kosten zu reduzieren beziehungsweise um den größtmöglichen Gewinn oder den geringsten Verlust zu erzielen. Sie bevorzugen diejenigen Handlungsalternativen, bei denen das Produkt von erzielbarem Gewinn und der Wahrscheinlichkeit, ihn zu erreichen, am größten ist. In Interaktionen werden die Nutzenerwartungen immer wieder verändert. Bei als gleich, fair oder gerecht erlebten Austauschbeziehungen sind die Ehepartner zumeist zufrieden - sofern alternative Beziehungen nicht attraktiver wirken. Gewinnt aber ein Ehegatte den Eindruck, dass der andere mehr Nutzen aus ihrem Verhältnis zieht, so mag er mit Ärger und Wut reagieren. Im entgegengesetzten Fall wird er Schuldgefühle entwickeln.
Als ein umfassenderes Konzept gilt der "Ehevertrag". In ihm sind die Rechte und Pflichten des jeweiligen Partners, der Austausch von Leistungen und deren Wert festgelegt. Zumeist wird aber nur ein kleiner Teil dieser Vereinbarungen in Gesprächen beziehungsweise Verhandlungen getroffen; die anderen sind vorbewusst - weil zum Beispiel ihre Verbalisierung Angst oder Schamgefühle hervorrufen würde - oder unbewusst. So mögen die Partner vorbewusst übereingekommen sein, dass zum Beispiel die sexuelle Unerfahrenheit des Mannes nicht angesprochen wird, oder weisen einander unbewusst eine Mutter- beziehungsweise Kindesrolle zu. Generell werden viele Erwartungen des Partners nicht bewusst wahrgenommen - wie eine Person in der Regel auch nicht merkt, dass sie für eine erbrachte Leistung eine Gegenleistung erwartet. Im Grunde "führt" aber jedes Individuum "Buch" über die eigenen Leistungen (Verdienste) und Leistungsrückstände (Schulden) sowie über die des Partners. Wohl ist es bereit, für einen bestimmten Zeitraum (wenn beispielsweise der Partner längere Zeit krank ist) mehr zu geben als zu nehmen, erwartet aber auf Dauer einen gerechten Ausgleich.
Im Gegensatz zu früher steht heute der aus einer Ehebeziehung gezogene Nutzen in stärkerer Konkurrenz zu anderen "Glücksquellen". Zum einen wird für viele Frauen der Beruf immer wichtiger, ist er für sie eine bedeutende Quelle von Selbstwertgefühlen, bringt er soziale Anerkennung mit sich und ermöglicht Selbstbestätigung durch eigene Leistung. So müssen zwei Karrieren aufeinander abgestimmt werden, was eine größere Komplexität der Lebensgestaltung bedingt und oft mit Belastungen für die Partnerbeziehung verbunden ist. Zum anderen wird beiden Geschlechtern außerhalb der Ehe eine Vielzahl von Möglichkeiten zur aktiven Selbstverwirklichung, zum Lebensgenuss und zur sexuellen Befriedigung geboten. Vor allem Letzteres wird für viele Paare zum Problem, da es den Partnern immer schwerer fällt, die entgegengesetzten Bestrebungen nach Bezogensein und Vereinigung einerseits sowie nach Selbstabgrenzung und Individuation andererseits in einer Art fortwährender Pendelbewegung miteinander zu vereinbaren. Sie sind immer weniger bereit, persönliche Freiheiten und die eigene Selbständigkeit einzuschränken, auf mögliche neue Erfahrungen und Genüsse zu verzichten sowie für die Beziehung "Opfer zu erbringen". Zugleich werden aber immer höhere Erwartungen an die Ehebeziehung gestellt.
Dennoch sind die meisten Erwachsenen mit ihrer Ehe beziehungsweise Partnerschaft sehr zufrieden: So stuften sie bei einer Befragung im Rahmen des Wohlfahrtssurveys 1984 (Statistisches Bundesamt 1985) ihre Beziehung im Durchschnitt mit 8,8 auf einer Zufriedenheitsskala von O bis 10 ein, wobei 44% der Befragten sogar den höchstmöglichen Wert wählten. Damit wurde dieser Lebensbereich besser bewertet als alle anderen (wie Familienleben, Haushaltsführung, Arbeitsplatz, Wohnung, Freizeit usw.). Zudem waren 43% der Interviewten der Meinung, dass ihr Partner sie "sehr gut" verstehe, während 51% mit "ziemlich gut" antworteten.
Offensichtlich ist, dass nicht beide Partner in gleichem Maße mit ihrer Beziehung zufrieden sein müssen. So sind Männer meist glücklicher in der Ehe, fühlen sich besser verstanden und beklagen sich weniger (reichen auch seltener die Scheidung ein). Zudem sind verheiratete Männer gesünder als unverheiratete, leben länger, trinken weniger Alkohol und sind zufriedener mit dem Leben (Schenk 1984). Ferner nimmt in der Regel das Eheglück in den ersten Jahren nach der Heirat ab. Bei Frauen ist es relativ niedrig, wenn sie Kleinkinder oder Schulkinder aufziehen, während Männer häufig einen Tiefpunkt nach den ersten sieben Ehejahren und kurz vor dem Ruhestand erleben. Wenn die Kinder das Elternhaus verlassen und die durch sie bedingten Belastungen abnehmen, steigt oft die Zufriedenheit mit der Ehe wieder an.
Äußere Faktoren wie soziale Herkunft, Konfession oder große Altersunterschiede wirken sich nach wissenschaftlichen Befunden weder positiv noch negativ auf das Eheglück aus. Jedoch ist die Ehezufriedenheit zumeist größer, wenn die Partner relativ spät geheiratet haben und lange verlobt waren. Positiv kann sich ferner auswirken, wenn sie aus Familien stammen, in denen die Eltern glücklich verheiratet waren. Stimmen sie mit diesen weltanschaulich überein, so berichten sie auch von mehr Gemeinsamkeiten mit ihrem Ehepartner (Institut für Demoskopie Allensbach 1985a). Die Zufriedenheit mit der Ehe ist in der Regel umso größer, je ähnlicher sich die Gatten hinsichtlich Persönlichkeitsfaktoren, Einstellungen, Werten, Interessen, Erwartungen usw. sind, je mehr die Rollenanforderungen mit ihren persönlichen Eigenarten übereinstimmen und je ausgewogener die Beziehung ist. So wurde festgestellt, dass eine weltanschauliche Übereinstimmung mit einem größeren Ausmaß an Kommunikation zwischen den Partnern, intensiveren Gesprächen und einer größeren Anzahl von Themen verbunden ist - Indikatoren für Eheglück. Selbstverständlich ist die Zufriedenheit mit der Ehe auch von Persönlichkeitsfaktoren abhängig. So wirken sich persönliche Reife, emotionale Stabilität, Einfühlungsvermögen und Warmherzigkeit positiv aus. Die Berufstätigkeit der Frau ist zumeist nur dann mit einer größeren Ehezufriedenheit verbunden, wenn diese im Alter von unter 30 beziehungsweise über 40 Jahren ist. Die Doppelbelastung der erwerbstätigen Frau in der Phase mit Kleinkindern oder Schulkindern wirkt sich jedoch eher negativ auf das Eheglück aus.
Das Eltern-Kind-Subsystem steht in den meisten Familien im Mittelpunkt des Geschehens, solange die Kinder noch recht klein sind. Später verliert es dann an Bedeutung. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist durch intensive Emotionen, eine große Kommunikationsdichte und viele unbewusste Prozesse gekennzeichnet. In ihr erfährt das Kind eine starke Prägung, die an anderer Stelle unter dem Titel "Sozialisation und Erziehung" abgehandelt wird. Aber auch die Eltern verändern sich durch den Einfluss ihrer Kinder. So stellten 41% der im Auftrag des Jugendwerks der Deutschen Shell (1985b) befragten Eltern Änderungen an sich selbst fest (zum Beispiel im Verhältnis zur jungen Generation, von Persönlichkeit, Weltanschauung, Selbstbild, Geschmack, Umgangsformen usw.). Auch sind viele Eltern bereit, mit ihren Kindern persönliche Probleme zu besprechen. So können 41% der befragten Eltern mit ihren Kindern über alle und 42% über die meisten Sorgen und Nöte reden.
Trotz vieler negativer Berichte wird die Eltern-Kind-Beziehung von den meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen positiv gesehen. So bezeichneten bei einer repräsentativen Befragung (SINUS-Institut 1985) 44% der männlichen 15- bis 17-jährigen das Verhältnis zu den Eltern als "sehr gut", 45% als "gut" und nur 11% als "es geht", während gleichaltrige Mädchen zu 39%, 45% und 14% diese Bewertungen wählten; weitere 2% bezeichneten die Beziehung als "schlecht". 18- bis 25-jährige Frauen bewerteten das Verhältnis zu den Eltern ähnlich wie die weiblichen Jugendlichen, während gleichaltrige Männer die Beziehung negativer sahen (so bezeichneten zum Beispiel nur noch 30% der 18- bis 21-jährigen die Beziehung als "sehr gut", hingegen 13% als "es geht", 2% als "schlecht" und 1% als "sehr schlecht"). Bei einer anderen Befragung (Allerbeck/Hoag 1985) wurde ermittelt, dass der Anteil der 16- bis 18-jährigen, die ein gutes Verhältnis zu Vater beziehungsweise Mutter haben, zwischen 1962 und 1983 um 17,5% beziehungsweise 15% abnahm, aber immer noch sehr hoch ist. Generell ist die Beziehung zur Mutter besser als zum Vater, obwohl der Abstand geringer geworden ist. Etwa jeder zehnte Jugendliche hat eine bessere Beziehung zum Vater als zur Mutter.
Diese positive Bewertung der Eltern-Kind-Beziehung bedeutet aber nicht, dass Generationenkonflikte oder Auseinandersetzungen nonexistent sind; so berichtet etwa ein Drittel aller Jugendlichen von gelegentlichen oder häufigen Meinungsverschiedenheiten mit den Eltern (Allerbeck/Hoag 1985), besteht im internationalen Vergleich besonders geringer weltanschaulicher Konsens zwischen den Generationen in der Bundesrepublik (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b). Sicherlich werden viele konfliktträchtige Themen von Eltern und Jugendlichen im gemeinsamen Gespräch vermieden, was mit einer qualitativen Schwächung der Kommunikation und einem geringeren Austausch persönlicher Informationen verbunden sein dürfte.
Erwähnenswert ist noch, dass die Bedeutung der Mutter als Bezugsperson und Gesprächspartner der Kinder in der Regel kaum abzunehmen scheint, wenn sie erwerbstätig ist. So ergab eine in Baden-Württemberg durchgeführte Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a), dass Kinder unter 14 Jahren, die mit jemanden reden wollen oder ein Problem haben, in erster Linie zur Mutter gehen - und zwar zu 83%, wenn diese nicht berufstätig ist, und zu 87%, wenn diese ganztags erwerbstätig ist. 14- bis 18-jährige suchen hingegen zu 80% eine nichtberufstätige und nur zu 73% eine ganztags erwerbstätige Mutter auf. Bei Kindern rangieren dann die Väter weit abgeschlagen auf dem zweiten (30%) und Freunde auf dem dritten Platz (24%; die Großmutter spielt mit 11% der Nennungen noch eine größere Rolle). Bei Jugendlichen ist dieses Verhältnis umgekehrt (57% suchen einen Freund und 36% den Vater auf; sie wenden sich auch häufig an Geschwister). Allerdings finden 42% der Kinder und 23% der Jugendlichen mit einer ganztags berufstätigen Mutter, dass diese für sie zu wenig Zeit habe - dasselbe gilt aber nur für 10% beziehungsweise 8% bei nichtberufstätigen Müttern. Zudem sind 42% der Kinder und Jugendlichen der Meinung, dass der Vater für sie zu wenig Zeit habe. Während es wenig überrascht, dass sich 57% der ganztags berufstätigen (aber auch 23% der nichterwerbstätigen) Mütter mehr Zeit für ihre Kinder wünschen, sind es immerhin auch rund 50% der Väter - wobei jedoch nur jede vierte Frau ein intensiveres Engagement ihres Mannes wünscht.
Die Etablierung des Geschwistersubsystems ist ein langandauernder und oft mühsamer Prozess. Ein engerer Kontakt zwischen einem älteren und einem jüngeren Kind kann zumeist erst dann entstehen, wenn sich Letzteres fortbewegen oder sprechen kann. Viele Annäherungsversuche des jüngeren Geschwisterteils treffen jedoch zunächst auf negative Reaktionen, da sie zum Beispiel Verhaltensregeln widersprechen. So kommt es relativ häufig zu Auseinandersetzungen, wobei jüngere Kinder eher mit Weinen, Rückzug oder Unterwerfung und ältere Brüder eher mit physischer beziehungsweise Schwestern eher mit verbaler Aggression reagieren. Mit der Zeit nehmen aber in der Regel positive Interaktionen zu, schwindet der Machtunterschied zwischen Geschwistern. Auch entstehen fortdauernde Interaktionsmuster.
Geschwister halten ihre Beziehung zumeist das ganze Leben hindurch aufrecht, sodass diese länger als alle anderen Familienbeziehungen dauert. Zwischen älteren Geschwistern besteht zumeist ein egalitäres Verhältnis, das von unterschiedlicher Intensität sein kann. Oft ist es enger als die Beziehung zu Vätern, wobei es in der Regel am intensivsten zwischen Schwestern ist (auch über den gesamten Lebenszyklus hinweg). Zwischen den meisten Geschwistern bestehen lebenslang Bindungen; sie empfinden Zuneigung und Liebe füreinander, haben Vertrauen zueinander. Manchmal kommt es auch zu sexuellen Kontakten, die bis zum Geschlechtsverkehr führen. Diese können in Einzelfällen länger als zehn Jahre dauern. Sofern beide Geschwister mit ihnen einverstanden sind, treten negative Folgen relativ selten auf.
Manche Geschwister empfinden nur wenig füreinander und suchen Distanz. Andere haben ein eher feindseliges Verhältnis. In diesem Zusammenhang muss auf die in unterschiedlicher Stärke und Häufigkeit auftretende Geschwisterrivalität eingegangen werden, die besonders intensiv zwischen erst- und zweitgeborenen Kindern ist: Geschwister wetteifern miteinander um Liebe, Anerkennung, Lob usw. und sind oft aufeinander neidisch. Geschwisterrivalität tritt besonders häufig auf, wenn ein weiteres Kind geboren wurde, wenn ein Geschwister in einem bestimmten Lebensbereich hervorragende Leistungen erbringt oder wenn es von den Eltern bevorzugt behandelt wird. Aber auch erwachsene Geschwister - insbesondere Brüder - wetteifern vielfach noch miteinander, messen zum Beispiel den eigenen beruflichen oder Lebenserfolg an dem der anderen. Dann werden jedoch seltener feindselige Gefühle empfunden oder gezeigt, wobei generell in Geschwisterbeziehungen eher negative Emotionen und Urteile artikuliert werden können als in anderen Familienbeziehungen.
In der Familienforschung ist noch unklar, welchen Einfluss die Eltern auf die Beziehungen im Geschwistersubsystem haben. Dieses kann auf jeden Fall ein Gegengewicht bilden: Es macht es den Kindern leichter, sich von den Eltern abzugrenzen und deren emotionalen und psychischen Ansprüchen zu entgehen. Auch können Geschwister einander gegenüber den Eltern unterstützen, als Vermittler bei Konflikten auftreten oder versuchen, das Verhalten oder die Gefühle eines Geschwisterteils den Eltern zu erklären. Zugleich können diese ihre Ehebeziehung besser vor den Kindern schützen, sodass in Familien mit einer größeren Geschwistergruppe meistens die Generationengrenzen deutlicher ausgeprägt sind.
Geschwister dienen in der Regel auch als Spielkameraden - insbesondere wenn es in der Nachbarschaft wenig Gleichaltrige gibt. Kinder machen viele Lernerfahrungen im Geschwistersubsystem: Sie lernen, mit Beziehungen zwischen Gleichgestellten zu experimentieren, zu verhandeln, zu kooperieren, zu teilen und wettzueifern. Ältere Geschwister wirken als Vorbilder und Rollenmodelle; vor allem ältere Schwestern sind auch gute "Lehrerinnen". Erhalten sie von den jüngeren Rückmeldung und Bestätigung, so kann dieses zur Entwicklung eines positiven Selbstbildes beitragen. Ferner helfen Geschwister einander bei Problemen (auch als Erwachsene) und können erzieherische Defizite ihrer Eltern zum Teil ausgleichen.
Trotz vieler Studien liegen noch keine konsistenten Ergebnisse aus der Geschwisterpositionsforschung vor. Es ist nicht gelungen, "die unterschiedliche Entwicklung der Geschwister über ihre Stellung in der Geschwisterreihe, selbst wenn Geschlecht, Geschlechterfolge und Altersabstand hinzugenommen werden, zu erklären" (Schütze 1989: 312).
Abschließend soll noch darauf verwiesen werden, dass es in immer mehr Familien kein Geschwistersubsystem gibt: Fast jedes zweite Kind wächst als Einzelkind auf. Während in der Gesellschaft noch viele Vorurteile gegenüber Einzelkindern vorhanden sind, hat die Familienforschung (Kasten 1986) nur wenige und schwach ausgeprägte Unterschiede zu Kindern mit Geschwistern festgestellt: So weisen sie eine stärkere internale und eine schwächere externale Handlungskontrolle auf und sind eher selbstzentriert (vor allem weibliche Einzelkinder). Zudem gelten sie als extrovertierter und sozial umgänglicher, nehmen häufiger Führungspositionen im Freundeskreis ein. Ferner erreichen sie eine geringfügig bessere Schulbildung (insbesondere männliche Einzelkinder) und einen höheren beruflichen Status als Kinder aus größeren Familien - was an der intensiveren Förderung durch die Eltern liegen kann, deren ungeteilte Aufmerksamkeit und Unterstützung sie erfahren. Oft werden sie aber auch verwöhnt und überbehütet.
Struktur
Jede Familie ist durch eine gewisse "innere Ordnung" gekennzeichnet. Diese zeigt sich in verschiedenen Strukturen wie zum Beispiel der Altersstruktur, der Rollenzuordnung, der Aufgliederung in Subsysteme und der Arbeitsteilung. An dieser Stelle sollen nun die Machtstrukturen (Hierarchie) genauer betrachtet werden. Laut der Ressourcentheorie (Blood, Wolfe, Rodman) ist die Macht eines Ehepartners umso größer, je höher seine externen (zum Beispiel Geld) oder innerfamilialen (zum Beispiel Liebe, Dienstleistungen, sexuelle Gratifikationen) Ressourcen sind und je mehr potentielle Alternativen zur gegenwärtigen Ehe für ihn bestehen. Das Ausmaß der von einem Familienmitglied beanspruchten Macht ist aber auch von soziokulturellen Normen und Erwartungen, von seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Einstellungen abhängig.
Heute sind bereits mehr als zwei Drittel aller Ehen partnerschaftlich strukturiert, bezeichnen Ehegatten mehrheitlich das Kräfteverhältnis in ihrer Beziehung als ausgewogen. Allerdings ist das Autoritätsgefälle normalerweise in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich, gibt es geschlechtsspezifische Akzente. So mag sich zum Beispiel eine Frau in Erziehungsfragen gegenüber dem Mann durchsetzen können und bei Entscheidungen über die Freizeitgestaltung gleichberechtigt mitbestimmen, bei teueren Konsumausgaben wie dem Kauf eines Autos sich aber der Meinung des Mannes unterordnen müssen. Generell wird jedoch immer mehr die Gleichrangigkeit der Ehepartner betont, werden strittige Punkte ausdiskutiert und Entscheidungen gemeinsam gefällt, wobei beide Seiten sich von Vernunft und Einsicht leiten lassen. Auch werden unterschiedliche Meinungen eher toleriert als früher. Ursachen für die größere Gleichberechtigung der Frau in der Ehebeziehung liegen unter anderem in der zunehmenden Demokratisierung der Gesellschaft, den Erfolgen der Frauenbewegung und ihrer zunehmenden Unabhängigkeit aufgrund der eigenen Erwerbstätigkeit.
So verliert das Phänomen der statusunterlegenen Frau an Bedeutung: Laut einer Untersuchung über 2.620 Frauen zwischen 18 und 30 Jahren (Simm 1989), die in vier ausgewählten Regionen Nordrhein-Westfalens leben, ist etwa jede fünfte älter als ihr Partner, über die Hälfte hat das gleiche Bildungsniveau, ein Drittel hat eine vergleichbare Berufsposition erreicht. Bei etwa einem Viertel der Partnerschaften hat die Frau sogar einen höheren Status. Auch suchen Männer vermehrt eine Sinngebung ihres Lebens in der Familie und verbringen aufgrund der gesunkenen Wochen- und Jahresarbeitszeit mehr Zeit in ihr - sie geraten also immer mehr in den "Herrschaftsbereich" der Frauen.
Im Vergleich zu früher ist auch ein Verlust an elterlicher Autorität und Macht festzustellen. So lassen Eltern ihren Kindern mehr Freiheiten, verlangen weniger Ehrerbietung, setzen sich weniger mit Hilfe von Strafen durch und beteiligen ihre Kinder mehr an Entscheidungen. Sie empfinden es immer häufiger als notwendig, ihre eigenen Handlungen gegenüber den Kindern zu begründen, über den Sinn bestimmter Verhaltensregeln mit ihnen zu diskutieren und bei Auseinandersetzungen kompromissbereit zu sein. Auch wird Kindern immer mehr die eigene Macht bewusst. So ergab eine repräsentative Befragung von 16- bis 18-jährigen, dass 26,8% viel Einfluss und nur 9,4% keinen Einfluss auf Familienentscheidungen als Kinder hatten (Allerbeck/Hoag 1985). Ursachen für diese Entwicklung liegen unter anderem in der zunehmenden Kindzentriertheit und affektiven Abhängigkeit vieler Eltern. Sie erleben ihre Kinder als Mittelpunkt und Sinn ihres Lebens, kämpfen um ihre Liebe und benötigen sie als Vertraute und Ersatzpartner. Während es früher Kinder als schwierig empfanden, sich von ihren Eltern abzulösen, sind es heute häufig die Eltern, die ihre Kinder nicht gehen lassen können. Andere Ursachen für den Autoritätsverlust liegen in der Konkurrenz von Eltern mit der öffentlichen Erziehung und dem Einfluss von Medien, Gleichaltrigen, Jugendkultur, Werbung usw. Auch haben Eltern an pädagogischer Kompetenz verloren, werden ihr Wissen und ihre Erfahrungen aufgrund des rasanten Entwicklungstempos unserer Zeit immer schneller entwertet. Nur noch für 3% aller Jugendlichen sind die Eltern Vorbilder (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985b).
Funktionen der Familie
Familien erfüllen eine Vielzahl wichtiger Funktionen für ihre Mitglieder und für die Gesellschaft. Diese Funktionen beziehen sich auf individuelle, familiale und gesellschaftliche Ebenen. Sie bestimmen zum Teil die Struktur der Familie (funktionale Binnendifferenzierung).
Es ist offensichtlich, dass einzelne Funktionen auf bestimmte Phasen des Familienzyklus beschränkt beziehungsweise in ihnen verschieden stark ausgeprägt sind, dass sie das einzelne Familienmitglied in unterschiedlichem Ausmaße in Anspruch nehmen und auf vielerlei Weise erfüllt werden können. Das tägliche Leben der Familienmitglieder wird durch die Ausführung der aus diesen Funktionen resultierenden Aufgaben geprägt. Manche familienpolitische Darstellungen wie beispielsweise diejenige von Bethusy-Huc (1987) orientieren sich an den Funktionen der Familie und behandeln, wie deren Erfüllung durch bestimmte Maßnahmen und Hilfsangebote erleichtert und verbessert werden kann.
Haushaltsführung
Vor allem die Familien- und Haushaltsökonomik untersucht die familiale Haushaltsfunktion: "Die Familie ist Entscheidungsinstanz für die 'Allokation'' (den planmäßigen Einsatz) von Zeit und Gütern zum Zweck des Haushaltskonsums und der Haushaltsproduktion" (Krüsselberg/Auge/Hilzenbecher 1986: 23). Aus dieser Sicht lassen sich Familien als produzierende und konsumierende wirtschaftliche Einheiten definieren, in denen familiales Handeln durch ökonomische Faktoren bestimmt wird. Auch besitzen Haus- und Familienarbeit einen Wert, der mit wirtschaftswissenschaftlichen Methoden bestimmt werden kann.
So hat jeder Familienhaushalt sowohl einen Input, zum Beispiel Einkommen, staatliche Leistungen, erworbene Güter, als auch einen Output: Er produziert Güter und Dienstleistungen mit einem hohen qualitativen Wert, die das Handlungspotential der Familie aufrechterhalten, der Befriedigung wichtiger Bedürfnisse dienen und einen großen Teil der Lebensqualität für den Einzelnen ausmachen. Zudem sind diese Leistungen für die Lebens- und Gesunderhaltung der Familienmitglieder von großer Bedeutung; sie garantieren einen akzeptablen Lebensstandard und gewährleisten ein bestimmtes kulturelles Niveau.
Die Familienmitglieder müssen fortwährend über Haushaltsinput und -output entscheiden, also über Einkommensbeschaffung, Ersparnis, Vermögensbildung, Markteinkauf, Vorratshaltung, Kauf von Freizeitgütern, Wohnungsausstattung usw. Dabei müssen jedem erworbenen oder selbst produzierten Gut und jeder Dienstleistung sowohl der jeweilige Geldpreis als auch die Zeitkosten für Erwerb und Verbrauch beziehungsweise Durchführung zugeordnet werden. Dabei werden die Zeitkosten unter anderem auch durch die technologische Ausstattung des Haushaltes sowie die Effizienz und Effektivität des Handelns der Familienmitglieder mitbestimmt. Jedes erstrebenswerte Gut und jede wünschenswerte Dienstleistung steht nahezu immer in Konkurrenz zu anderen, da die materiellen Ressourcen und die verfügbare Zeit beschränkt sind. So müssen Familienmitglieder beispielsweise entscheiden, ob sie zum Beispiel lieber ein neues Auto kaufen oder eine längere Urlaubsreise machen wollen, ob sie die Fenster putzen oder spazieren gehen wollen.
Offensichtlich ist, dass jede Familie ihre Haushaltsfunktion auf andere Weise erfüllt - je nachdem, wie hoch ihr Haushaltseinkommen ist, wie viele Mitglieder sie umfasst, wie viel Zeit diesen zur Verfügung steht, welche Entscheidungen sie hinsichtlich von Input und Output fällen. Ihr Handlungspotential ist aber auch abhängig von dem Arbeitsvermögen (Alter, Geschicklichkeit, Kraft usw.), dem Vitalvermögen (Gesundheit, Bildung, Alltagswissen usw.) und dem Besitz der Familienmitglieder sowie von Leistungen, die von außen (zum Beispiel Netzwerk, Staat, Wohlfahrtsverbänden) kommen.
Trotz der großen Bedeutung der Haushaltsfunktion für die Daseinsfürsorge, den Lebensstandard und das Wohlbefinden der Familienmitglieder werden die mit ihr verbundenen Aufgaben von der Gesellschaft unterbewertet, da sie in erster Linie der Frau zugeschrieben werden, keine großen Berufsqualifikationen verlangen und nicht bezahlt werden. Hier wirken sich traditionelle Geschlechtsrollenleitbilder, soziokulturelle Normen und Vorstellungen über geschlechtstypische Fähigkeiten negativ aus.
Befunde zur Arbeitsteilung im Haushalt lauten: Laut einer Umfrage in Baden-Württemberg (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) wird nur in 8% der Partnerschaften die Hausarbeit zu gleichen Teilen von Mann und Frau erledigt und nur in 1% der Fälle vorwiegend vom Mann übernommen. Rund 19% der Männer helfen ihren Partnerinnen überhaupt nicht bei der Hausarbeit (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b); weitere 58% beteiligen sich nur an drei oder weniger Wochentagen - so ist es kein Wunder, dass sich 92% der verheirateten Männer durch Hausarbeit kaum belastet fühlen (Brigitte/Metz-Göckel/Müller 1985).
Generell helfen die Männer mehr im Haushalt, so lange die Ehe kinderlos ist. Nach der Geburt von Kindern sind sich beide Partner in der Regel schon vorher einig, dass der Mann die "Versorgerrolle" übernehmen soll - da er zum Beispiel die besseren beruflichen Chancen hat (55%) oder mehr verdient (42%) (Erler/Jaeckel/Pettinger/Sass 1988). So nimmt die Mitwirkung der Männer bei der Hausarbeit nach der Geburt von Kindern ab. Sie arbeiten vor allem dann weniger im Haushalt mit, wenn die Frauen nicht oder nur für wenige Stunden pro Woche erwerbstätig sind, wenn mehrere Kinder zu versorgen sind, wenn die Kinder bereits älter sind oder das Haus schon verlassen haben, wenn die Familie in einer Großstadt wohnt oder wenn das Haushaltsnettoeinkommen entweder sehr niedrig oder sehr hoch ist. Aber auch erwerbstätige Mütter von Kleinkindern werden wenig entlastet - ja viele junge Väter reduzieren die Mitarbeit im Haushalt auch aus dem Grund, um sich mehr ihren Kindern widmen zu können. Rentner beteiligen sich zumeist mehr an der Hausarbeit als berufstätige Männer. Normalerweise steigt die Mithilfe am Wochenende erheblich an.
Da nur jede vierte Frau häufig von ihrem Partner bei der Hausarbeit unterstützt wird, ist es nicht verwunderlich, dass viele Frauen mit der Aufgabenverteilung im Haushalt unzufrieden sind. So sehen 27% der Frauen den größeren Nutzen der Ehe bei den Männern, gibt es in einem Viertel aller Ehen Meinungsverschiedenheiten wegen der Arbeitsteilung (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b). Auch erfahren sie kaum Entlastung durch ihre Kinder, da diese trotz ihrer Ablehnung der traditionellen Arbeitsteilung nur selten bereit sind, regelmäßig und intensiv im Haushalt mitzuhelfen - ihre Mitwirkung ist noch geringer als die des Ehemannes. Bei größeren Familien und bei zunehmender Länge der Erwerbstätigkeit der Mütter beteiligen sie sich jedoch mehr an der Hausarbeit, wobei sich Mädchen in der Regel stärker engagieren (müssen) als Jungen. Einen noch größeren Einfluss hat aber das Vorbild des Vaters. So arbeiten 46% der Jugendlichen, deren Vater häufig im Haushalt hilft, gerne zu Hause mit - aber nur 18% der Jugendlichen, deren Vater nie hilft (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a).
Freizeit
Die Freizeitfunktion der Familie ist im Verlauf der vergangenen Jahre immer wichtiger geworden. Zum einen steht mehr Zeit für Freizeitaktivitäten zur Verfügung, weil die Wochen- und die Lebensarbeitszeit gekürzt wurden, der Jahresurlaub verlängert wurde und die Lebenserwartung gestiegen ist. Zum anderen wird heute die eigene Selbstverwirklichung vermehrt in der Freizeit gesucht, da in diesem Bereich mehr Selbstbestimmung möglich ist (als im Beruf) und das Leben abwechslungsreicher, befriedigender und erlebnisvoller gestaltet werden kann. Zudem spielen aufgrund der großen beruflichen Belastung und der oft recht einseitigen Beanspruchung die eigene Gesunderhaltung, Erholung und Entspannung sowie die Regeneration der Arbeitskraft eine große Rolle.
Generell wird heute die Freizeit aktiver gestaltet als in den 50er- und 60er-Jahren. So werden häufiger Freunde, Bekannte und Nachbarn besucht, Wochenendfahrten, Wanderungen und Reisen unternommen, Spaziergänge gemacht, Sport- und Vereinsveranstaltungen aufgesucht und Feste gefeiert. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist regelmäßig oder gelegentlich sportlich aktiv; knapp 60% sind Mitglieder in Vereinen und Verbänden (Institut für Demoskopie Allensbach 1983b); 15% treffen sich häufig mit Gleichgesinnten am Stammtisch oder im Kaffeekränzchen; 20% engagieren sich in der Nachbarschaftshilfe (Schmidtchen 1984). Weitere beliebte Freizeitbeschäftigungen sind Fernsehen, Lesen, Handarbeiten, Basteln, Musizieren, Musikhören sowie Konzert- und Theaterbesuche.
Kinder verbringen den überwiegenden Teil ihrer Freizeit zu Hause. Laut einer im Jahr 1988 durchgeführten Befragung von 3.935 bayerischen Schülern im Alter von 13 bis 18 Jahren (Lukesch 1989) hatten die Kinder im Durchschnitt zwischen vier und sechs Stunden Freizeit, von denen sie mehr als die Hälfte vor dem Bildschirm verbrachten. Am häufigsten sahen sie Videoclip-, Action- und Unterhaltungssendungen im Fernsehen an. Rund 21% betrachteten täglich oder mehrmals pro Woche Videofilme und weitere 28% etwa einmal pro Woche. Erschreckend ist das Befragungsergebnis, dass 32% der Schüler indizierte und 10% beschlagnahmte Videofilme (vor allem Action- und Horrorvideos) unter ihren Lieblingstiteln auflisteten. Auch gestatteten 18% der Eltern - und weiter 36% manchmal - ihren minderjährigen Kindern den Konsum von Filmen, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind. Da nur 16% der Schüler mit ihren Eltern über Videofilme sprechen, müssen sie die Filminhalte entweder alleine oder im Freundeskreis verarbeiten. Aber auch das Lesen ist weiterhin eine beliebte Freizeitbeschäftigung. So besaßen nur 36% der Schüler weniger als 20 Bücher (ohne Schulbücher), jedoch 31% zwischen 21 und 50 sowie 32% über 50 Bücher. Bereits 24% der Schüler besaßen einen Heimcomputer und 20% ein Gerät für Videospiele. Laut einer Befragung von 1.056 Kindern und 1.056 Eltern aus München, Erzhausen, Gräfenhausen und Mücke (Herzberg/Ledig 1990) geben fast 80% der Eltern in der Großstadt und mehr als 50% der Eltern im ländlichen Raum an, dass ihre Kinder auf der Straße vor dem Haus gefährdet sind. Viele sprechen Spielverbote für bestimmte Orte (zum Beispiel Straße 45%, Wald 32%, Bach beziehungsweise Fluss 10%) aus, weil sie Angst vor Unfällen oder sexueller Belästigung haben. So treffen sich Kinder in der Regel mit Freunden in der elterlichen Wohnung, wobei die meisten Verabredungen in der Schule (fast 90% im ländlichen und 63% im städtischen Bereich) getroffen werden. Vor allem Stadtkinder beklagen sich, dass sie zu wenig Möglichkeiten haben, draußen in der Wohnumgebung zu spielen. Kinder nutzen auch intensiv institutionelle Freizeitangebote: Sie sind Mitglieder in Sportvereinen oder Clubs, in Kindergruppen oder Verbänden, besuchen Musikschulen oder (schulische, kirchliche) Veranstaltungen. Nur 18% der befragten Kinder (Herzberg/Ledig 1990) nehmen kein derartiges Angebot wahr; der Durchschnitt liegt bei zwei terminlich gebundenen Aktivitäten, wobei die Zahl mit zunehmendem Alter der Kinder ansteigt. Zu den Freizeitaktivitäten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehören auch Ausflüge, Verwandtenbesuche, Einkaufsbummel, Mitarbeit in Vereinen und Verbänden, Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sowie der Besuch von Gaststätten, Cafes und Diskotheken.
Es ist offensichtlich, dass viele der genannten Freizeitaktivitäten auch im Familienverband durchgeführt werden können. So unterscheiden sich Familien danach, wie viel Freizeit sie gemeinsam verbringen. Dieses sagt jedoch selbstverständlich nichts über die Qualität des Familienlebens aus. Verbringen die Familienmitglieder die meisten Abende und Wochenenden mit Fernsehen, so mögen sie sich durchaus isoliert, einsam und mit ihrem Zusammenleben unzufrieden fühlen. Natürlich ist das Ausmaß der miteinander verbrachten Freizeit auch von dem Alter der Familienmitglieder abhängig. Beispielsweise werden Rentner oder Ehepaare mit kleineren Kindern sehr viel mehr gemeinsam unternehmen.
Reproduktion
Eine weitere bedeutende Funktion der Familie ist die Reproduktion, das heißt die Zeugung neuer Familien- und Gesellschaftsmitglieder. Laut einer Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) sind 23% der Befragten der Meinung, dass die Frau für ein erfülltes Leben Kinder benötige, halten 42% Ehen mit Kindern für glücklicher, beginnt für 71% die Familie erst mit Kindern. Aufgrund der unbeschränkten Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln können sich heute Ehepartner bewusst für oder gegen (weitere) Kinder entscheiden - wobei diese Entscheidung von einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Faktoren abhängt. Beispielsweise wird die Zeugung von Kindern von vielen als Bestimmung des Menschen verstanden, soll die Liebe zwischen den Partnern besiegeln oder wird als Beweis für die eigene Männlichkeit beziehungsweise Weiblichkeit gesehen. Zudem möchten manche erleben, was Schwangerschaft und Geburt bedeuten. Ferner suchen einige nach einem Objekt, das sie lieben und von dem sie geliebt werden möchten, das ihnen einen Lebenssinn gibt oder dem sie ihren Besitz vermachen können. Andere wollen sich in der Erziehung als Mensch und Partner bewähren - und diese Liste möglicher Motive ließe sich noch seitenlang fortsetzen.
Natürlich werden aber auch heute noch viele Kinder ungewollt gezeugt wie zum Beispiel aufgrund von Verhütungspannen oder aus unbewussten Beweggründen heraus. So mag zum Beispiel eine Frau versuchen, auf diese Weise eine konflikthafte Ehe zu retten. Im Jahr 1985 gab es rund 27.700 voreheliche Konzeptionen unter den Geburten (Statistisches Bundesamt 1987c).
Während bei einer repräsentativen Umfrage in Baden-Württemberg (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) 58% der Befragten generell die Entscheidung für ein Kind als schwer bezeichneten, traf dieses überraschenderweise nur auf 7% der Befragten mit Kindern persönlich zu - 53% fiel die Entscheidung für das eigene Kind gar nicht schwer, wobei diese für Frauen leichter als für Männer war. Generell wünschen sich Befragte jedoch mehr Kinder, als sie zeugen. So wollten bei der bereits erwähnten Umfrage nur 10% ein Kind, jedoch 52% zwei Kinder, 20% drei Kinder und 8% vier und mehr Kinder haben.
Die gewünschte Kinderzahl liegt bei Frauen höher als bei Männern und bei nichterwerbstätigen Frauen höher als bei berufstätigen. Der Kinderwunsch ist auch bei sehr religiösen Menschen größer. Bei Personen, die als Einzelkinder aufgewachsen sind, liegt er hingegen unter dem Durchschnitt. Jedoch ist dieser Wunsch nur bei wenigen Menschen sehr stark ausgeprägt: So denken 17% der Befragten (unter 45 Jahren) ohne Kinder oft und 52% manchmal daran, ob sie Kinder haben wollen. Anzumerken ist noch, dass der Kinderwunsch seit Mitte der 60er-Jahre zurückgegangen ist, ab Mitte der 80er-Jahre aber wieder ansteigt.
In der Regel bleibt heute jedoch die reale Familiengröße hinter der idealen zurück. So gab es 1988 laut Berechnung des Statistischen Bundesamtes (1989) 3.062.000 Ehepaare mit einem Kind, 2.200.000 Ehepaare mit zwei Kindern, 555.000 Ehepaare mit drei Kindern und 140.000 Ehepaare mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren.
Ehepaare verzichten häufig auf die (vollständige) Erfüllung ihres Kinderwunsches, weil ihnen beispielsweise die Aufwendungen oder Zeitkosten für (mehrere) Kinder zu hoch erscheinen, da sie sich noch andere Wünsche erfüllen wollen, weil Frauen nach einer eigenen beruflichen Karriere streben und darin durch mehrere Kinder behindert würden (Mehrfachbelastung) oder weil andere Gründe (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnsituation, Kinderfeindlichkeit der Gesellschaft) dagegen sprechen.
Das generative Verhalten steht in Beziehung zu einer Vielzahl sozialstruktureller Faktoren: Generell nimmt die Familiengröße mit zunehmender Erwerbstätigkeit der Frau ab. Dabei haben Arbeit suchende Frauen eine Zwischenstellung inne. Sie scheinen die Kinderzahl relativ klein zu halten, um für den Arbeitsmarkt besser verfügbar zu sein. Zudem nimmt die Familiengröße mit zunehmender Höhe des Ausbildungsabschlusses der Frau ab. Auch haben Frauen, die nach dem 26. Lebensjahr heiraten, im Durchschnitt weniger Kinder. Die Familiengröße ist in Niedersachsen und im Freistaat Bayern am höchsten und in Stadtstaaten (insbesondere in Berlin) am niedrigsten. Ferner sind Familien auf dem Land in der Regel größer als in der Stadt (insbesondere in der Großstadt). Obwohl in den vergangenen Jahren die Geburtenrate in ökonomisch schlechter gestellten Familien und in denen mit mittlerem Einkommen stark gesunken ist, sind Familien von Landwirten und Arbeitern im Durchschnitt immer noch größer als die von Angestellten, wobei Beamtenfamilien eine Zwischenposition einnehmen. Schließlich ist die Kinderzahl von Ausländern, religiös gesinnten Eheleuten und Haus- beziehungsweise Wohnungsbesitzern größer.
Sozialisation und Erziehung
Menschliche Neugeborene, aber auch kleinere Kinder, können allein nicht überleben. Sie sind erziehungsbedürftig und benötigen die Pflege, Fürsorge, Zuwendung und Unterstützung ihrer Eltern. Diese stimulieren, beeinflussen und lenken die motorische, sprachliche, kognitive, affektive und soziale Entwicklung der Kinder, prägen ihre Persönlichkeitsstruktur und bestimmen ihre interpersonalen Beziehungen. Die hier angedeuteten familialen Funktionen werden vor allem von der Sozialisationsforschung untersucht.
Als Sozialisation bezeichnet man den Prozess, durch den Kinder zu vollwertigen und handlungsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft werden. Aufgrund direkter und indirekter Einflüsse, die von den Eltern, anderen Menschen und der Umwelt ausgehen, erlernen Kinder sozial relevante Verhaltensweisen, übernehmen verschiedene Rollen, bilden eine Geschlechtsidentität aus und entwickeln Kommunikationsfertigkeiten, Kooperationsbereitschaft, Frustrationstoleranz usw. Die Sozialisation gilt als lebenslanger Prozess, erfährt aber ihre Grundlegung in der Familie (primäre Sozialisation). Später gewinnen andere Sozialisationsinstanzen wie Kindergarten, Schule, Freundeskreis, Arbeitswelt oder Medien an Bedeutung (sekundäre, tertiäre Sozialisation), während die Familie mehr und mehr zurücktritt. Jedoch werden zukünftige Erfahrungen und Einwirkungen auf der Grundlage der in der Familie gelernten Muster wahrgenommen, verstanden, verarbeitet und in Handlungen umgesetzt.
Eine weitere familiale Funktion wird als Enkulturation bezeichnet. Damit ist die Prägung der Kinder durch die von den Eltern repräsentierten Kultur, Schicht und Religion gemeint. So übernehmen die Kinder von ihnen Werte, Normen, Weltanschauungen und moralische Einstellungen, erlernen kulturspezifische Denkweisen und den Umgang mit Sprache, Schrift und Technik. Zugleich eignen sie sich wichtige kulturspezifische Kenntnisse im Gespräch mit den Eltern an.
Ferner übt die Familie eine Platzierungsfunktion aus, das heißt, sie ist an der Zuweisung sozialer Positionen in Schule, Arbeitswelt, Politik usw. entscheidend beteiligt. Beispielsweise hat man in den 60er-Jahren nachgewiesen, dass Kinder in den meisten Fällen die gleiche Schulbildung wie ihre Eltern erhalten - also ein Kind, dessen Vater die Volksschule absolvierte, in der Regel die Hauptschule besucht, während ein Kind, dessen Vater das Abitur erwarb, normalerweise in das Gymnasium geht. Dieses gilt auch heute noch, allerdings mit größeren Einschränkungen. Da Bildungsabschlüsse zumeist eine karriereentscheidende Bedeutung haben, wird auf die beschriebene Weise der soziale Status des Vaters "vererbt".
Die familiale Platzierungsfunktion wird vor allem über die Beeinflussung der Schullaufbahn von Kindern ausgeübt. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Bildungswünsche der Eltern in Hinblick auf ihre Kinder, die von den eigenen Bildungs- und Berufserfahrungen, aber auch von der öffentlichen Meinung und den Medien beeinflusst werden. Von ihnen hängt ab, in welchem Ausmaß die Schullaufbahn der Kinder gefördert und in welche Schulformen sie platziert werden.
Positiv wirkt sich aus, wenn Eltern Lernmotivation und Leistungsbereitschaft wecken, Selbständigkeit und Ausdauer stimulieren, entwicklungsfördernde Angebote machen, kontinuierliche Unterstützung bieten, Interesse an schulischem Lernen zeigen, Hausaufgaben überwachen und den Kontakt zu den Lehrern pflegen. Negativ sind hingegen Überbehütung, der Zwang zu Unterordnung und Konformität, Inkonsistenz, Über- und Unterforderung usw. Aber auch das Vorbild der Eltern - ihre Gesprächsthemen, ihre Lektüre, ihre kulturellen Aktivitäten, ihr Interesse an Fort- und Weiterbildung - spielt eine große Rolle. Somit führt die unterschiedliche Qualität der familialen Sozialisation und Enkulturation dazu, dass sich schon kleine Kinder hinsichtlich ihrer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten unterscheiden und dass sie ihre Schullaufbahn von verschiedenen Ausgangspositionen aus beginnen.
Die Familie beeinflusst auch die Persönlichkeitsentwicklung und Individuation von Kindern - ein Prozess, der als Personalisation bezeichnet wird. Sie prägt zu einem großen Teil Persönlichkeitsstruktur, Selbstbild und Ich-Identität, Selbstwertgefühle, Durchsetzungskraft, Leistungsmotivation, Problemlösefertigkeiten usw. Auch bestimmt sie die Art und Weise des Umgangs mit Trieben, Bedürfnissen und Emotionen. So ermöglicht ihnen die Familie, einzigartige Individuen zu werden.
Bei all diesen Funktionen ist aber immer zu beachten, dass einerseits neben der Familie noch andere Kräfte auf Kinder einwirken und andererseits diese als selbsttätige Wesen Einflüsse von außen selektiv wahrnehmen und auf die ihnen eigene Weise verarbeiten. Auch können sie ihnen Widerstände entgegensetzen, ihnen ausweichen und auf höchst unterschiedliche Weise auf sie reagieren. Zudem können sie durch ihr Verhalten ihre Umwelt mitgestalten und gewünschte Reaktionen hervorrufen. Selbstverständlich sind auch die Erbanlagen von Bedeutung, die zur Entfaltung drängen und manchmal äußere Einflüsse wirkungslos verpuffen lassen.
Soziale Handlungen, durch die Eltern versuchen, das Verhalten, das Erleben und die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder zu beeinflussen, werden unter dem Begriff der Erziehung zusammengefasst. Diese ist immer an bestimmten Zielen, Idealen, Leitbildern und Normen ausgerichtet. Auch ist sie an eine Eltern-Kind-Beziehung gebunden, die in der Regel durch Intensität, Intimität, Personalität und Wechselseitigkeit gekennzeichnet und zumeist durch gegenseitige Liebe, Vertrauen und Achtung geprägt ist. Jedoch handelt es sich um ein recht ungleichgewichtiges Verhältnis, da die Eltern in nahezu jeder Hinsicht ihren Kindern überlegen sind, eine Machtposition besitzen und eine größere Autorität beanspruchen.
Sozialisation, Enkulturation, Personalisation und Erziehung ereignen sich immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum. So müssen Eltern einerseits die Anpassung ihrer Kinder an die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse fördern und die gesellschaftlichen Erwartungen, Normen und Anforderungen vertreten. Andererseits müssen sie die Individualität, die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kinder berücksichtigen. Sie sollten ihnen helfen, sich als Person in Interaktionen einzubringen, eigene Vorstellungen durchzusetzen, Rollendistanz zu erlernen und eine gewisse Verhaltensautonomie zu erlangen. Nur so kann auch erreicht werden, dass gesellschaftliche Strukturen weiterentwickelt und verbessert werden oder totalitäre Bestrebungen erfolglos bleiben.
Die Qualität von Sozialisation, Enkulturation und Erziehung ist abhängig von der erzieherischen Kompetenz, dem Erziehungsstil, den Leitbildern und dem Erziehungswissen der Eltern. Es wurde festgestellt, dass sich neun von zehn Erwachsenen bei der Erziehung an Gefühl und Intuition orientieren, knapp ein Drittel vom Vorbild der eigenen Eltern ausgeht, 10% sich an den Rat ihrer Verwandten halten und knapp 30% relevante Informationen aus Rundfunk, Fernsehen, Elternzeitschriften und Büchern berücksichtigen (Fauser 1982). In den letzten Jahrzehnten sind auch wissenschaftliche Erkenntnisse von Psychologen, Psychoanalytiker, Pädagogen, Kinderärzten usw. von den Medien weit verbreitet worden und finden seitens der Eltern immer mehr Beachtung.
Die meisten Eltern sehen sich heute bewusst als Erzieher und denken häufig über Erziehung nach. Jedoch ist der Reflexionsgrad höchst unterschiedlich ausgeprägt, wobei Mütter sich in der Regel intensiver mit Erziehungsfragen beschäftigen als die Väter - wenngleich auch für letztere Elternschaft in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Vor allem wenn ihre Kinder noch im Kleinkindalter sind, setzen sich viele Väter mit Erziehung auseinander und beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit ihren Kindern. Zu dieser Entwicklung in Richtung einer aktiveren Elternschaft hat beigetragen, dass Erziehung immer mehr als Ausgleich zur technisierten, effizienzorientierten und gefühlsdistanzierten Arbeitswelt sowie als Möglichkeit der Selbstentfaltung und eigenen Weiterentwicklung gesehen wird. Kinder werden von immer mehr Eltern als persönlichkeitsbereichernde Herausforderung begriffen, die neue Lebensdimensionen und Wachstumsmöglichkeiten eröffnet.
Laut einer im Freistaat Bayern durchgeführten nichtrepräsentativen Befragung von 280 Eltern (Dietrich 1985) enthalten die Erziehungstheorien von Eltern Kausal- und Finalannahmen, also Aussagen über die Bedingungen, Ziele und Mittel der Erziehung. Meist wird eine Vielzahl von relevanten Faktoren berücksichtigt: So wissen Eltern um die Bedeutung der Familie für die Entwicklung der Kinder, schätzen aber auch den Einfluss von Kindergarten, Schule, Freundeskreis, Klassenkameraden und Medien hoch ein. Sie sehen in der Eltern-Kind-Beziehung das Fundament der Erziehung - wobei die Mütter als wichtigste Bezugspersonen und Haupterzieher gelten, die zumeist ein engeres Verhältnis zu den Kindern haben und eine größere Erziehungsfähigkeit besitzen würden. Der Einfluss der Väter wird entweder dem der Mütter gleichgesetzt, als geringer bewertet oder als qualitativ anders (zum Beispiel mehr Autorität, kameradschaftlicheres Verhalten) beurteilt. Auch sind sich die meisten Eltern darüber im Klaren, wie wichtig eine harmonische Ehebeziehung und Einigkeit in Erziehungsfragen für die Entwicklung der Kinder sind. Zudem sind sie sich bewusst, dass Kinder keine leicht zu beeinflussende Wesen sind und dass sie nicht ausschließlich vom Erbgut oder von der Umwelt geprägt werden. Sie sehen in ihnen eigenwillige, aktive und einzigartige Persönlichkeiten, die Erziehungseinflüssen aufgeschlossen oder ablehnend begegnen und auf sie entweder mit positiven, negativen oder ambivalenten Gefühlen reagieren.
Eltern sehen Erziehung in erster Linie als Lernhilfe an, der Eigenaktivität und Initiative der Kinder entgegenkommen. Dabei betonen sie vor allem die Bedeutung des Vorbildes und des Nachahmungslernens. So sehen sie sich selbst, ihre Persönlichkeit, ihre Verhaltensmuster, ihr kulturelles Niveau, ihre Einstellungen usw. als zentrale Bedingungen des Erziehungserfolges an. Zumeist haben sie ein gutes Verständnis wünschenswerter erzieherischer Verhaltensweisen, betonen also zum Beispiel die Wichtigkeit "gesunder" Autorität, des Erklärens und Begründens, des Eingehens auf kindliche Bedürfnisse, der Empathie und Geduld. Auch streben sie danach, kameradschaftlich, liebevoll, offen, warm und verständnisvoll zu sein.
Eine (nichtrepräsentative) Befragung von 144 bayerischen Eltern (Dietrich 1985) hat ergeben, dass mehr als die Hälfte die Erziehung für ein schwieriges Geschäft hält. Etwa 50% dieser Eltern stoßen bei der Erziehung ihrer Kinder auf Grenzen, für 40% ist sie (teilweise) eine Belastung. Für die erlebten Schwierigkeiten machen sie in erster Linie sich selbst (die eigene Unbeherrschtheit, Launenhaftigkeit, Ungeduld, Nachgiebigkeit, Überlastung usw.) und die eigenen Lebensumstände sowie das Kind (dessen Persönlichkeit, Individualität, Lernunwilligkeit, Trotz, Unausgeglichenheit usw.) verantwortlich. Daneben sehen sie aber noch eine Vielzahl weiterer Ursachen wie negative Umwelteinflüsse, das schlechte Vorbild von Gleichaltrigen oder die Ablenkung durch Medien. Dennoch sind 58% der befragten Eltern mit dem Erfolg ihrer Erziehung ganz und weitere 36% teilweise zufrieden; mehr als 60% können ihre Kinder erzieherisch wirksam beeinflussen. Dabei können sie ihrer Meinung nach mehr bei kleineren Kindern und Töchtern als bei Jugendlichen und Söhnen erreichen. Auch glauben mehr als 60% der Eltern, dass sie als Erzieher im Großen und Ganzen so bleiben können, wie sie sind.
Eine nichtrepräsentative Umfrage (Stein 1983) bei 155 Elternpaaren mit mindestens einem Kind im Alter von drei bis vier Jahren brachte ähnliche Ergebnisse. So bezeichneten mehr als 50% der Befragten sich selbst und den Partner spontan als gute Eltern, wobei die Urteile über die Mütter in der Regel etwas positiver ausfielen als die über die Väter. Nur in weniger als 5% der Fälle war das Selbst- oder Partnerurteil negativ. Etwa 10% der Eltern berichteten, dass sie manchmal die Erziehung nicht im Griff haben, große Schwierigkeiten erleben oder unsicher sind.
Eine Befragung von 2.638 Erwachsenen (Wahl/Stich/Seidenspinner 1989) ergab, dass sich acht von zehn Eltern über die Erziehung ihrer Kinder gut einigen. Neun von zehn Vätern, aber nur sieben von zehn Müttern waren mit der Zeit zufrieden, die ihr Partner mit den Kindern verbringt. Dementsprechend meinten 57% der Männer, jedoch nur 30% der Frauen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. Etwa 26% der Mütter und 16% der Väter fühlten sich oft durch ihre Kinder überbeansprucht und dabei von ihren Partnern alleingelassen.
Bei der Erziehung ihrer Kinder richten sich Eltern nach einer Vielzahl von Zielen, Idealen und Leitbildern, die sie zu höchst unterschiedlichen Kombinationen miteinander verbinden. Diese Vielfalt spiegelt den Wertepluralismus in unserer Gesellschaft wider. Zumeist folgen Eltern mehreren Zielen, denen sie einen unterschiedlichen Wert beimessen.
Die einzelnen Erziehungsziele lassen sich zumeist folgenden Kategorien zuordnen: (1) Persönlichkeitsentfaltung und Individuation: Selbstverwirklichung, Reife, Selbständigkeit, stabiles Selbstbild, positive Selbstwertgefühle, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Eigenwille; (2) Zufriedenheit: Lebensbejahung, allgemeines Wohlbefinden, Ausgeglichenheit, Glück; (3) Lebens-, Schul- und Berufstüchtigkeit: Entwicklung intellektueller Fähigkeiten, Lernmotivation, Leistungsbereitschaft, Kompetenz, Kritikfähigkeit; (4) Gehorsam und Unterordnung: Anpassungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Einordnung, Unterwerfung; (5) soziale Fähigkeiten: Kommunikationsfertigkeiten, Mündigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Empathie, Kooperationsfähigkeit, Solidarität, Fähigkeit zur produktiven Konfliktbewältigung, Kontaktfreude; (6) Ordnungsliebe: Ordentlichkeit, Fleiß, Sauberkeit; (7) Gewissensbildung: moralische Orientierung, Sittlichkeit, Anständigkeit, Glaube.
In Verbindung mit dem viel beschriebenen Wertewandel hat sich auch die Bedeutung von Erziehungszielen im Verlauf der letzten Jahrzehnte geändert. So wurde bei repräsentativen Befragungen festgestellt, dass Erziehungsziele wie Gehorsam, Unterordnung, Fleiß, Höflichkeit und Ordnungsliebe heute für weniger wichtig gehalten werden als vor 10 oder 20 Jahren. Hingegen haben Ziele wie Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein, Verständnis für andere, Selbständigkeit, Toleranz, Durchsetzungsfähigkeit und Menschenkenntnis an Bedeutung gewonnen. Auch das erzieherische Verhalten hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte verändert; so hat gut die Hälfte aller Erwachsenen mit der Erziehungstradition ihrer Eltern gebrochen (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985b). Generell ist das Elternverhalten lockerer und informeller geworden, ist das Eltern-Kind-Verhältnis durch mehr Gleichberechtigung und Partnerschaftlichkeit gekennzeichnet, wird die kindliche Persönlichkeit eher in ihrer Einzigartigkeit anerkannt, wird der Individualität des Kindes mehr Raum zugestanden. Auch scheinen Eltern (jüngeren) Kindern mehr Zeit zu widmen, sich intensiver mit ihnen zu beschäftigen und sie stärker zu fördern. Sie bemühen sich mehr, sie zu verstehen und ihnen altersgemäße Aktivitäten und Kontakte anzubieten. Eltern behandeln ihre Kinder zumeist gleich, bevorzugen (erstgeborene) Söhne nicht mehr und erwarten nur noch selten, dass ältere auf jüngere Geschwister aufpassen.
Zugleich sind Eltern in ihrem erzieherischen Verhalten unsicherer geworden. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurden sie mit unterschiedlichen Leitbildern, entgegengesetzten pädagogischen Strömungen, konkurrierenden Erziehungsrezepten und einer Vielzahl von Warnungen vor Erziehungsfehlern konfrontiert. Sie mussten lernen, dass ihr Erziehungsstil große Auswirkungen auf die kognitive, soziale, emotionale und psychische Entwicklung ihrer Kinder hat. Auch sind sie sich bewusst geworden, dass Erziehungsmaßnahmen verschiedene (auch ungewollte) Wirkungen haben können -und eine gewünschte Wirkung durch unterschiedliche Mittel hervorgerufen werden kann. So orientieren sie sich beim Einsatz erzieherischer Techniken vermehrt an den Reaktionen der Kinder und an ihren früher gemachten Erfahrungen, beachten aber auch ihre Erziehungsziele, den Kontext der jeweiligen Situation, die Motive der Kinder und viele andere Faktoren -kurz: sie denken also intensiv nach, bevor sie handeln.
Eltern verfügen über ein mehr oder minder großes Repertoire an Erziehungsmitteln. So ergab eine nichtrepräsentative Befragung (Dietrich 1985) von 203 Elternteilen im Freistaat Bayern, dass sie bevorzugt folgende erzieherischen Maßnahmen verwenden: (1) Beispiel, Vorbild sein; (2) Ideal der Mitte, ausgewogene Erziehung; (3) verständnisvolle Beziehungsgestaltung; (4) Erklären, Argumentieren, Beraten; (5) gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern beziehungsweise Anregung der Kinder zu Aktivitäten; (6) Konsequenz, Festigkeit, Stetigkeit, Ruhe; (7) Bestätigen; (8) Härte, Strenge, Strafe.
Obwohl die meisten der befragten Eltern lieber belohnen als strafen, bejahen 95% die Notwendigkeit von Strafen. Eine Befragung von 2.638 Erwachsenen (Wahl/Stich/Seidenspinner 1989) ergab, dass 70% dem Kind ein paar Mal "einen Klaps gegeben oder es ein bisschen geschüttelt" haben, während 9% dies häufig taten. Rund die Hälfte hat das Kind ein paar Mal geschlagen; 3% haben häufig so gehandelt. Generell lehnen Eltern heute aber körperliche Züchtigung, Liebesentzug und das Erzeugen von Schuldgefühlen als erzieherische Maßnahmen ab, sprechen sich gegen zu große Strenge, Härte und Zwang aus, beurteilen einen stark kontrollierenden, einschränkenden oder autoritären Erziehungsstil negativ. Die meisten Eltern sind sich aber auch bewusst, dass Verwöhnung, Überbehütung und zu große Nachgiebigkeit sowie ein inkonsistenter oder antiautoritärer Erziehungsstil unerwünschte Auswirkungen haben. So suchen sie immer wieder nach dem rechten Verhältnis zwischen Strenge und Milde, Führen und Wachsenlassen.
Eine im Jahr 1984 durchgeführte repräsentative Befragung (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985b) von 15- bis 24-jährigen ergab, dass 3% ihre Erziehung als sehr streng, 32% als streng, 60% als gütig-milde und 4% als zu milde beurteilten. Knapp 30 Jahre zuvor wurde von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gleichen Alters die elterliche Erziehung nur geringfügig häufiger als sehr streng (9%) oder streng (36%) bewertet. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine auf Baden-Württemberg beschränkte Befragung von Jugendlichen Institut für Demoskopie Allensbach 1983a), bei der auch Folgendes festgestellt wurde: "Selbst Jugendliche, deren Mütter der Überzeugung sind, ihre Kinder streng zu erziehen, beurteilen ihre Mütter mit großer Mehrheit als nicht besonders oder überhaupt nicht streng; die vom Vater vertretenen Prinzipien und die Einschätzung ihrer Realisierung durch die Jugendlichen stimmen zwar besser überein, doch auch jeder zweite Jugendliche, dessen Vater Strenge als Erziehungsprinzip vertritt, empfindet den Vater als nicht besonders oder überhaupt nicht streng" (S. 73).
Interessant ist auch die Frage, ob Jugendliche und junge Erwachsene eigene Kinder genauso erziehen würden, wie sie selbst von ihren Eltern erzogen wurden. Hier ergab die oben erwähnte Befragung von 15- bis 24-jährigen, dass nur 12% ihre Kinder genauso und 41% ungefähr so erziehen würden, wie sie selbst erzogen wurden, während 48% (ganz) anders vorgehen würden - die letztgenannte Antwort wurde vor allem von Personen gegeben, die ihrer Meinung nach (sehr) streng (oder zu milde) erzogen wurden. Sie wollen zum Beispiel ihren Kindern mehr Freiheiten lassen (18%), weniger streng mit ihnen sein (16%), ihnen mehr Selbständigkeit zugestehen (15%), mehr Verständnis zeigen (9%), sich mehr Zeit für sie nehmen (6%) oder die Elternautorität stärken (5%).
Kinder und Jugendliche übernehmen vor allem im Verlauf der familialen Sozialisation ihre Geschlechtsrollen. Im Vergleich zu früher ist heute die elterliche Erziehung nicht mehr so stark geschlechtsspezifisch orientiert. Vielmehr wird ein den traditionellen Geschlechtsrollenleitbildern entsprechendes erzieherisches Verhalten nur noch relativ selten beobachtet. Bis zum fünften Lebensjahr ihrer Kinder werden bei Eltern wenig Unterschiede in der Behandlung von Jungen und Mädchen festgestellt. Dennoch fühlen sich Eltern wohler, wenn ihre Kinder geschlechtstypische Verhaltensweisen zeigen. Sie unterstützen aber auch vermehrt geschlechtsuntypische Reaktionen, da sie diese als Zeichen der Individualität ihrer Kinder werten. Ferner ist zu beobachten, dass wohl Eltern einerseits geschlechtsspezifische Verhaltensnormen zu vermitteln versuchen und insbesondere vor Dritten auf deren Befolgung achten, andererseits ihren Kindern aber daheim einen großen Freiraum für geschlechtsuntypisches Verhalten zugestehen. Generell drängen Väter deutlicher und absichtsvoller als Mütter auf ein geschlechtstypisches Verhalten und verstärken es mehr.
Männliche Kleinkinder erfahren zunächst etwas mehr, dann aber weniger Körperkontakt seitens der Eltern als weibliche Kinder, denen generell eine größere Bandbreite von Gefühlen gezeigt wird. Ferner fördern Mütter die psychische Abtrennung von Söhnen stärker als von Töchtern, die sich weniger abgrenzen müssen und mehr Zeit für die Individuation haben. Etwa vom dritten Lebensjahr an kaufen Eltern unterschiedliches Spielzeug für Jungen und Mädchen, wobei aber auch deren Wünsche berücksichtigt werden (vermehrt mit zunehmendem Alter). Kinder werden sich mit circa vier Jahren bewusst, dass Spielsachen nach Geschlecht verteilt werden. Etwa zur gleichen Zeit haben sie auch schon recht genaue Vorstellungen über geschlechtsspezifisches Verhalten und übernehmen es von sich aus. Sie betonen geschlechtsspezifische Unterschiede, verinnerlichen auf Geschlechtsrollen bezogene Erwartungen und Normen, ahmen das von gleichgeschlechtlichen Erwachsenen gezeigte Verhalten nach.
Mädchen werden generell von ihren Eltern liebesorientierter, fürsorglicher und beschützender erzogen. Zudem dürfen sie länger den Trost, den Schutz und die Bestätigung ihrer Mütter in Anspruch nehmen und sind deshalb vielleicht ausgeglichener und psychisch stabiler als Jungen. Allerdings sind sie aus diesem Grunde auch abhängiger von ihren Müttern, haben größere Schwierigkeiten mit der Ablösung. Sie lernen im Umgang mit ihren Müttern, andere Menschen (intuitiv) zu verstehen sowie über Gefühle und andere psychische Vorgänge zu sprechen. Auch werden sie ermutigt, sich um andere zu kümmern. So entwickeln sie mehr soziale Fertigkeiten und haben dementsprechend später größere Netzwerke als Jungen. Mit zunehmendem Alter werden Mädchen dann vor allem aus Angst vor Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch von ihren Eltern anders behandelt als Jungen. Sie müssen mehr daheim, in der Nähe ihrer Eltern oder unter Aufsicht von Erwachsenen bleiben und müssen sagen, wohin sie gehen und wann sie zurückkehren werden. So erforschen sie ihre Umgebung weniger und erleben die Welt als bedrohlicher. Jungen müssen bereits recht früh ihre engen Bindungen an die Mütter unterdrücken und sich ihren Vätern zwecks Gewinnung von Geschlechtsidentität zuwenden. So sind für sie Beziehungen schon in der Kindheit problematischer als für Mädchen. In der Regel können sie sich der Aufsicht ihrer Eltern leichter entziehen und haben mehr Bewegungsfreiheit. So halten sie sich häufiger in größeren Gruppen Gleichaltriger auf, die einen großen Einfluss auf ihre Entwicklung ausüben. Beispielsweise drängen sie auf geschlechtsspezifisches Verhalten, ziehen einander gnadenlos wegen untypischer Reaktionen auf. So erfolgt die inhaltliche Ausgestaltung der Männlichkeit vor allem in der Gleichaltrigengruppe. Aufgrund dieser Sozialisationsbedingungen sind Jungen auch selbständiger und unabhängiger als Mädchen, lösen sich leichter von ihren Eltern ab, haben mehr Zutrauen zu sich selbst, sind aggressiver und kooperationsbereiter. In den Augen ihrer Eltern gelten sie generell als schwieriger zu erziehen. Auch werden sie häufiger körperlich gestraft als Mädchen.
Die Sexualisierung des weiblichen Geschlechts geht vor allem vom Vater und von männlichen Jugendlichen aus. So erleben Mädchen, dass sie zu einem sexuellen Objekt werden, wenn sie zum Beispiel körperliche Übergriffe von Jungen abwehren müssen. Zugleich drängen sie aber auch ab der Pubertät auf die Realisierung ihres Geschlechts: Sie wollen sexuell attraktiv sein, sich weiblich kleiden und schminken. In diesem Alter erfolgt also die endgültige Ausdifferenzierung der Geschlechtsrollen und -identität. Zugleich kommt es zu den ersten Experimenten mit sexuellen Verhaltensweisen. Hier spielt die Sexualaufklärung eine große Rolle, die nach den Aussagen von jeweils jedem zweiten Befragten (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985b) entweder (in erster Linie) durch die Eltern - insbesondere die Mütter -oder die Schule erfolgte. Von sehr viel geringerer Bedeutung waren Freunde und Medien - Letztere haben aber generell einen großen Einfluss auf die geschlechtsspezifische Sozialisation.
Andere Funktionen
Neben den genannten Funktionen gibt es weitere, die jedoch an dieser Stelle nur angedeutet werden sollen. So muss die Familie sich selbst als Einheit erhalten. Dies bedeutet, dass die Familienmitglieder befriedigende Beziehungen aufbauen, sich auf eine bestimmte Verteilung von Aufgaben, Rechten, Pflichten und Entscheidungsbereichen einigen, von allen akzeptierte Regeln setzen, Grenzen nach außen hin aufrechterhalten und ein effektives Funktionieren im Inneren der Familie sicherstellen. Auch empfinden sie normalerweise Gefühle der Zusammengehörigkeit, Loyalität und existentiellen Verbundenheit, bringen sie einander positive Emotionen entgegen. Eng damit verbunden ist die Funktion der familialen Solidarität. So bieten Familienmitglieder einander Sicherheit, Schutz und Geborgenheit, teilen ihren Besitz miteinander und helfen einander bei Krankheit, im Alter und bei der Bewältigung von Krisen.
Eine weitere Funktion wird als familialer Spannungsausgleich bezeichnet. Zum einen unterstützen Familienmitglieder einander bei der Verarbeitung von außen kommender Belastungen, beim Ertragen von Entfremdung und beim Abbau von Stress. So leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der psychischen Gesundheit und Integrität des einzelnen. Zum anderen bemühen sie sich um die Lösung der aus ihrem Zusammenleben resultierenden Probleme und Konflikte, um die Schlichtung von Streitigkeiten und den Ausgleich entgegengesetzter Interessen.
Eine andere Funktion der Familie ist die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse, zum Beispiel nach dauerhafter Bindung, Verlässlichkeit, Sicherheit, Vertrauen, Anerkennung und Zuwendung. Ferner ermöglicht sie dialogische Beziehungen, die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Selbstaktualisierung und das Ausdrücken intensiver Gefühle. Die große Wertschätzung, welche die Familie genießt, beruht zum Teil auch auf ihrer großen Bedeutung für das Wohlbefinden des einzelnen.
Schließlich ist noch die religiöse Funktion der Familie zu erwähnen, die allerdings im Verlauf der letzten Jahrzehnte an Bedeutung verloren hat. So wird nur noch in wenigen Familien gemeinsam gebetet, die Bibel ausgelegt oder der Gottesdienst besucht. Beispielsweise gingen 1983 nur noch 9% der Protestanten und 39% der Katholiken (fast) jeden Sonntag in die Kirche, 63% der Protestanten und 38% der Katholiken jedoch selten oder nie. Aber noch immer bezeichnen sich 35% der Bevölkerung als gläubige Mitglieder ihrer Kirche und vertreten deren Lehre; weitere 13% stehen zur Kirche, erwarten aber von dieser größere Veränderungen. 38% fühlen sich als Christen, halten jedoch nicht viel von der Kirche, während 10% der Kirche gleichgültig gegenüberstehen (Schmidtchen 1984).
Der Familienzyklus
Wie die menschliche Entwicklung verläuft auch die Familienentwicklung in Phasen, die durch unterschiedliche Funktionen und Aufgaben sowie die Auseinandersetzung mit unvermeidbaren Schwierigkeiten und bestimmten Problemen geprägt sind. Offensichtlich ist, dass nicht alle Familien diesen Zyklus durchlaufen - Ehepaare ohne Kinder, Alleinerziehende, Scheidungsfamilien, Stieffamilien usw. erleben eine andere Abfolge von Phasen. In diesem Kapitel soll die Beschreibung des idealtypischen Familienzyklus im Mittelpunkt stehen; auf einige abweichende Fälle werden wir in Teil 3 näher eingehen.
Der Wechsel von einer Phase des Familienzyklus in die Nächste wird durch physische, psychische und Verhaltensänderungen eines oder mehrerer Familienmitglieder, die Entstehung oder Auflösung von Subsystemen und außerfamiliale Einflüsse wie Einschulung oder Pensionierung bedingt. Vielfach werden diese Übergänge als Krisen erlebt, da das Familiensystem aus dem Gleichgewicht gerät und große Veränderungen notwendig werden. So müssen neue Rollen und Aufgaben übernommen und alte modifiziert, andere Funktionen erfüllt und erstmalig auftretende Bedürfnisse befriedigt werden. Auch sind Beziehungsdefinitionen, Interaktionsmuster, Regeln, Familienstrukturen, Arbeitsteilung, Zeitverwendungsmuster und Freizeitverhalten zu ändern. Zu pathologischen Entwicklungen kann es kommen, wenn Familienmitglieder die Übergänge von einer Phase in die Nächste nicht meistern oder an phasenspezifischen Aufgaben scheitern.
Im Familienzyklus wechseln Phasen der Entlastung und der Belastung einander ab. Dabei ist innerhalb des Systems der Generationen ein gewisser Ausgleich möglich. Befinden sich zum Beispiel junge Erwachsene nach der Geburt von Kindern in einer Phase besonders hoher Belastung, können sie zumeist Güter und Dienstleistungen von ihren Eltern abrufen, die sich nun in einer Phase der Unterauslastung befinden: So haben Letztere in der Regel keine Kinder mehr zu versorgen, suchen (insbesondere nichterwerbstätige Frauen) nach neuen Aufgaben, haben die Zeit des höchsten Erwerbseinkommens erreicht. Dementsprechend übernehmen sie oft die Betreuung ihrer Enkel (ermöglichen auf diese Weise vielfach erst die Berufstätigkeit der Mütter), helfen finanziell bei Engpässen aus oder kaufen Kinderkleidung und Spielzeug. In vielen Fällen müssen sie nun aber auch ihre eigenen Eltern (vierte Generation) unterstützen, die jetzt ebenfalls eine Phase hoher Belastung erreicht haben, in der sie bestimmte Verrichtungen nicht mehr selbst erledigen können oder pflegebedürftig werden.
Partnersuche und Heirat
Bevor Erwachsene eine Beziehung eingehen, die zu Ehe und Familiengründung führt, haben sie heute in der Regel bereits viele Erfahrungen mit verschiedenen Partnern gesammelt. So ist in den vergangenen Jahrzehnten das Alter immer mehr gesunken, in dem junge Menschen ihr erstes sexuelles Erlebnis haben. Zugleich ist die Zahl der Sexualpartner vor der Ehe stark angestiegen. Bei der Partnersuche lassen sie sich von einer Vielzahl bewusster und unbewusster Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche leiten. So glauben circa zwei von drei Frauen und jeder zweite Mann an die "große Liebe" (Schmidtchen 1984). Auch waren bei einer repräsentativen Umfrage (EMNID-Institut 1985a) drei von vier Befragten der Meinung, dass es einen "idealen" Männer- beziehungsweise Frauentyp gäbe. Männer beschrieben die "ideale" Frau als attraktiv, charmant, häuslich, gefühlsbetont, freundlich, intelligent, gebildet, tolerant und als gute Hausfrau, während Frauen den "idealen" Mann als groß, schlank, kräftig, treu, zuverlässig, fleißig, sportlich und attraktiv schilderten.
Die Partnersuche erfolgt in verschiedenen kleinen, voneinander abgegrenzten Partnermärkten, zu denen Individuen in unterschiedlichem Maße Zugang haben. In dem jeweiligen "Markt" treffen sich in der Regel nur Personen mit ähnlichen sozialen Merkmalen, die also derselben Altersgruppe und Schicht angehören, eine vergleichbare Schul- und Berufsausbildung genossen haben und hinsichtlich ihrer Werte, Einstellungen, Interessen und Hobbys weitgehend übereinstimmen. Dementsprechend treffen in der Phase des Kennenlernens zumeist zwei Personen aufeinander, die sich hinsichtlich ihrer sozialen Merkmale ähneln. Sie bewerten Aussehen, Kleidung, Geschmack, Umgangsformen, Lebensstil und Freizeitverhalten, stellen viele Übereinstimmungen fest, finden einander sympathisch und fühlen sich zueinander hingezogen.
In der Phase der ersten Paarbeziehung beginnen die Verliebten, eine enge Beziehung aufzubauen, Partnerrollen zu übernehmen und eine Paaridentität zu entwickeln. Sie öffnen sich selbst immer mehr und lernen einander immer besser kennen. Auch erleben sie, dass Gespräche leichter und intensiver werden. So wachsen Liebe, Zuneigung und Zufriedenheit, passen sich die Partner mehr und mehr einander an, stimmen sie Einstellungen, Werte, Interessen und Verhaltensweisen ab. Zumeist verklären sie den Partner und zeigen einander bloß ihre besten Seiten. Dieses wird auch dadurch erleichtert, dass sie in der Regel nur ihre Freizeit gemeinsam verbringen und so einander nicht im Alltag erleben. Entwickelt sich die Beziehung nicht so positiv, kann sie in dieser Phase relativ leicht abgebrochen werden, da die Partner noch nicht viel "in sie investiert" haben. Auch haben Außenstehende wie Freunde, Bekannte und Eltern noch größere Einflussmöglichkeiten und mögen durch mehr oder weniger subtile Taktiken den Kontakt fördern oder schwächen. Passen die Partner hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften zusammen, ergänzen sie sich bezüglich ihrer Bedürfnisse und Erwartungen und haben sie starke Bindungen und intensive Gefühle der Liebe, Zuneigung und Zusammengehörigkeit entwickelt, so treten sie in die Phase der gefestigten Paarbeziehung ein. Oft verloben sie sich nun oder ziehen zusammen und bilden eine nichteheliche Lebensgemeinschaft. Sie stimmen Beziehungsdefinitionen, Rollenvorstellungen, Interaktionsmuster und Erwartungen immer besser ab, entwickeln gemeinsame Positionen und klären unterschiedliche ab. So passen sie sich immer mehr einander an, "investieren" zunehmend in ihre Beziehung und binden sich auf Dauer. Sie treten jetzt als Paar nicht mehr nur in ihrem Freundeskreis auf, sondern auch in der erweiterten Familie. Problematisch ist, dass die Erwartungen an den Partner und die Beziehung oft weiter zunehmen: So soll der andere alle Sehnsüchte und Bedürfnisse befriedigen, einen glücklich und zufrieden machen, Geborgenheit, Sicherheit und Unterstützung bieten, die eigene Weiterentwicklung und Selbstentfaltung fördern, offen und verständnisvoll sein, sich hingeben und die eigene Gleichrangigkeit akzeptieren. Viele unrealistische Erwartungen werden auch durch die Medien geschürt.
Aufgrund der sinkenden Heiratsneigung und der zunehmenden Akzeptanz nichtehelicher Lebensgemeinschaften entscheiden sich viele Paare erst dann für eine Ehe, wenn sie sich ein Kind wünschen - während einerseits eine "Ehe auf Probe" durchaus die Zustimmung der Öffentlichkeit erfährt, sind andererseits jedoch über 80% der Bevölkerung der Meinung, dass die Eltern eines Kindes verheiratet sein sollten (Schmidtchen 1984). Dieser Auffassung scheinen sich auch nahezu alle Paare mit Kinderwunsch anzuschließen. In vielen Fällen ist die Frau zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits schwanger. Allerdings findet bei jüngeren Personen schon jede fünfte Erstgeburt vor der Eheschließung statt. Hier wird deutlich, dass die Ehe einen Bedeutungs- und Motivationswandel erfahren hat: Während sie in der Vergangenheit in erster Linie das Zusammenleben von zwei Menschen legitimieren sollte, wird sie heute vor allem aus kindorientierten Gründen eingegangen. Natürlich spielen aber auch weiterhin Motive wie der Wunsch eine Rolle, durch die Eheschließung die wechselseitige Liebe und Zuneigung zu besiegeln und die Dauerhaftigkeit der Bindung zu bestätigen. Durch den Ehebund wird die Beziehung zwischen den beiden Partnern legalisiert und institutionalisiert, also Gesetzen, Normen und bestimmten Verhaltenserwartungen unterworfen. Auch werden ihr Ausschließlichkeitscharakter und ihre Dauerhaftigkeit betont. Die Ehezeremonie symbolisiert für die Partner einen Statuswechsel und bedeutet für deren Verwandte die Vereinigung von zwei Familiensystemen. Generell geht die Zahl kirchlicher Trauungen zurück, wobei diese Tendenz bei gemischtkonfessionellen Eheschließungen besonders stark ausgeprägt ist. Im Jahr 1988 fanden 397.595 Eheschließungen in der Bundesrepublik Deutschland statt, etwas mehr als in den Jahren zuvor. Das durchschnittliche Heiratsalter für zuvor ledige Männer betrug 27,7 Jahre und bei vorher ledigen Frauen 25,2 Jahre - nur in rund 3.000 Fällen wurden Ehen mit mindestens einem minderjährigen Partner geschlossen (Statistisches Bundesamt 1989). So wird in der Regel mit der Heirat gewartet, bis zumindest eine Person beruflich selbständig ist; die Erwerbsdauer vor der Eheschließung tendiert bei Männern im Durchschnitt auf mehr als sieben Jahre, bei Frauen auf mehr als fünf Jahre. Generell steigt das Heiratsalter an, weil mehr Zeit für die eigene Ausbildung und den Aufbau der beruflichen Existenz benötigt wird. Insbesondere hoch qualifizierte Personen heiraten relativ spät - gut ausgebildete Frauen bleiben übrigens auch häufiger ledig. Ein anderer Grund für das Ansteigen des Heiratsalters liegt darin, dass viele Partner zunächst in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben, anstatt wie früher sofort zu heiraten.
Die ersten Ehejahre
Wie in den anderen Phasen des Familienzyklus variieren auch in den ersten Ehejahren Verhaltensweisen und Erfahrungen von Paar zu Paar. Haben die Partner zum Beispiel vor der Hochzeit in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gewohnt, dürften für sie die ersten Ehejahre wenig Veränderungen bringen. Haben sie geheiratet, weil die Frau schwanger war oder weil sie unverzüglich ihren Kinderwunsch realisieren wollen, schrumpft diese Phase des Familienzyklus auf wenige Monate zusammen und ist vor allem durch die Vorbereitung auf das Kind gekennzeichnet. Da wir hier nicht alle diese Variationen berücksichtigen können, werden wir uns im Folgenden vor allem auf Fälle beschränken, bei denen die Partner erst nach der Hochzeit zusammenziehen und nicht sofort Kinder zeugen.
Im Mittelpunkt dieser Phase des Familienzyklus stehen die Ausbildung des Ehesubsystems, die Entwicklung einer Identität als verheiratetes Paar, die Festigung der Partnerrollen und die Regelung der Rollenausübung. So müssen die Ehepartner festlegen, wer welche Rechte, Pflichten und Entscheidungsbefugnisse hat, wie die Macht in der Ehebeziehung verteilt wird und wer welche Aufgaben im Haushalt übernimmt. Während generell Arbeitsteilung und Autoritätsstruktur schwächer ausgeprägt sind als in den nachfolgenden Phasen, so lässt sich schon jetzt eine zunehmende Tendenz hin zum Traditionellen erkennen: Die Frau richtet die Wohnung ein, kocht und pflegt die Wäsche, während der Mann Reparaturen durchführt und sich um das Auto kümmert - selbst wenn sich beide Partner intellektuell von geschlechtsspezifischen Leitbildern distanzieren. Ferner entwickeln die Ehegatten Regeln über die Art des Umgangs miteinander, das wechselseitige Geben und Nehmen, die üblichen Kommunikationsinhalte, die Zeitplanung und das Freizeitverhalten. Sie gleichen die in der Herkunftsfamilie oder in anderen Systemen erlernten Interaktionsmuster, Kommunikationsstile, Denkweisen, Werte und Einstellungen einander an. Dabei lassen sie sich entweder vom Vorbild der Ehebeziehung ihrer Eltern leiten (falls sie diese positiv erlebten) oder versuchen, die eigene Ehe ganz anders zu gestalten als die eines oder beider Elternpaare. Auch lernen sie den Umgang mit Konflikten, wobei Nachgeben, Verzichten und Kompromissbereitschaft durch die zwischen ihnen bestehende Liebe gefördert werden.
Die Ehebeziehung ist in dieser Phase des Familienzyklus durch intensive positive Gefühle, starke sexuelle Empfindungen und ein hohes Maß an gegenseitiger Bedürfnisbefriedigung gekennzeichnet. Jedoch kommt es oft zu einer gewissen Desillusionierung: So erlebt ein Partner nun den anderen im Alltag, entdeckt weniger wünschenswerte Züge an ihm und stellt fest, dass viele (übersteigerte oder unrealistische) Erwartungen nicht erfüllt werden. Auch steht er jetzt im Gegensatz zur "Werbungsphase" weniger im Mittelpunkt des Lebens seines Partners, sondern muss mit dessen Beruf, Hobbys, Freunden und Eltern konkurrieren. Zugleich verliert er an Autonomie und an Befriedigungen im Netzwerk, da sich zum Beispiel die Ehedyade von der Herkunftsfamilie abgrenzt und Kontakte zu unverheirateten (insbesondere gegengeschlechtlichen) Freunden abnehmen. Nach der Heirat verändert sich das Verhalten der Partner in verschiedenen (außerfamilialen) Lebensbereichen, reagieren Verwandte, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen anders auf sie. So müssen extrafamiliale Rollen modifiziert und mit der Partnerrolle in Einklang gebracht werden.
Zumeist sind in den ersten Ehejahren beide Partner berufstätig. Sie stehen am Anfang ihrer Karriere, sodass sie viel Energie in die Existenzgründung und berufliche Weiterbildung investieren. Zudem müssen sie einen großen Teil ihres Einkommens und ihrer Ersparnisse für ein gemeinsames Heim und die eigene Wohnungseinrichtung ausgeben, wozu sie sich oft auch verschulden. Je nachdem, wie viel Wert sie auf Hausbesitz, Konsum, Karriere und Kinderwunsch legen, unterscheidet Oppitz (1985) auf der Grundlage einer nichtrepräsentativen Untersuchung von 93 bayerischen Paaren folgende fünf Typen von jungen Ehen:
(l) "Otto-Normalverbraucher": Diese Ehepaare erreichen in ihrer Bewertung von Wohlstand, Freizeit und Karriere durchschnittliche Werte. Auch in Wohnungseinrichtung, Autokauf, Urlaubsreisen usw. fallen sie nicht aus dem Rahmen. Sie wünschen sich ein, zwei Kinder, die sie bald zeugen wollen.
(2) "Kleinbürgerliche Häuslebauer": Diesen Ehepartnern ist Wohlstand wichtiger als Freizeit, wobei sie vor allem nach Haus und Wohnungseigentum streben. Um ihre Ziele verwirklichen zu können, sind sie oft zu Überstunden bereit oder übernehmen Schwarzarbeit. Da sie Autos als Statussymbole betrachten, schaffen sie sich große Wagen an, die sie aber in der Regel gebraucht kaufen. Sie haben nur einen geringen Kinderwunsch, den sie aber bald verwirklichen wollen. Zumeist fallen in diese Kategorie Ehepartner, die eine weniger qualifizierte Berufsausbildung absolviert haben, aber ein hohes Haushaltsnettoeinkommen erzielen (zum Beispiel Facharbeiter).
(3) "Familienorientierte Alternative": Relativ wenige Ehepaare sehen sowohl Wohlstand als auch Freizeit als unwichtig an und orientieren sich mehr an postmateriellen Werten, am "Sein" (Fromm). Sie geben nur wenig Geld für Wohnungseinrichtung, Auto (kleine Gebrauchtwagen), Reisen und Sport aus, bevorzugen zum Beispiel preiswerte Freizeitbeschäftigungen wie Wandern oder Radfahren. Für diese Ehepartner sind Kinder wichtiger als Konsum. Dementsprechend wünschen sie sich die meisten Kinder (2,5), die sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt zeugen möchten. Sie haben die beste Schul- und Berufsausbildung von allen untersuchten Paaren, erzielen aber nur ein relativ niedriges Haushaltsnettoeinkommen.
(4) "Prestigebewusste Konsumierer": Für viele Ehepaare sind Wohlstand und Freizeit sehr wichtig; sie richten sich an materiellen Werten, am "Haben" (Fromm), aus. Dementsprechend haben sie sehr hohe Ausgaben für Wohnen, Autokauf, Freizeitgestaltung und Urlaub. Kinder werden als hinderlich für die Verwirklichung der eigenen Lebensziele betrachtet, sodass sich die Partner in der Regel nur ein Kind wünschen und dessen Zeugung immer wieder hinausschieben. Ihr Haushaltsnettoeinkommen ist in der Regel recht hoch, obwohl sie nicht die besten Schul- und Berufsabschlüsse erreicht haben.
(5) "Dynamische Weltenbummler": Für diese Ehepaare ist Freizeit wichtiger als Wohlstand. Sie haben den absolut geringsten Kinderwunsch, da Kinder als besonders hinderlich für die Freizeitgestaltung angesehen werden. Aufgrund ihrer qualifizierten Schul- und Berufsausbildung, der Ausübung sozial anerkannter Berufe und des hohen Haushaltsnettoeinkommens können sie sich lange und teure Urlaubsreisen, kostspielige Hobbys, ausgefallene Sportgeräte, große Autos und eine schöne Wohnungseinrichtung leisten.
Hier wird deutlich, dass diese Phase des Familienzyklus von Fall zu Fall unterschiedlich lang ist. Während einige Ehepaare sie sehr schnell durchschreiten und eine Familie gründen, bleiben andere zehn Jahre und länger in ihr verhaftet, bevor sie ein oder zwei Kinder zeugen.
Viele Ehepaare verzichten aber auch auf Kinder - sie durchleben die nächsten drei Phasen des Familienzyklus nicht, aber auch die Übrigen gestalten sich für sie anders: So schrumpft zum Beispiel ihr Netzwerk im Alter stärker zusammen. Sie können keine Großelternrolle übernehmen und sind bei Pflegebedürftigkeit eher auf Heime angewiesen als Ehepaare mit Kindern. In dieser Phase kommt es häufig zu Problemen, wenn die Ehepartner von ihren Herkunftsfamilien her sehr unterschiedliche Interaktionsmuster, Regeln, Werte und Arten der Rollenausübung gewöhnt sind. Dann mag es zu Machtkämpfen, Verunsicherung, Missverständnissen und Enttäuschungen kommen, wobei die eigentlichen Ursachen oft unklar und unbewusst bleiben. Ähnliches gilt für den Fall, wenn ein Partner eine eher traditionelle und der andere eine egalitäre Arbeitsteilung im Haushalt durchsetzen möchte. Enttäuschungen können aber auch aus Diskrepanzen zwischen dem idealen Bild von sich selbst beziehungsweise dem Partner und der Realität resultieren, insbesondere wenn das Wunschbild sehr übersteigert ist. Andere Schwierigkeiten können sich aus Rollenzuschreibung, Kommunikationsstörungen, mangelnder wechselseitiger Anpassung, unzureichenden Problem- und Konfliktlösungsfähigkeiten oder fehlender Kompromissbereitschaft ergeben. Manchmal wird auch ein Partner von dem Anderen überfordert, unterdrückt, ausgebeutet oder in symbiotische Beziehungen verstrickt.
Familie mit Kleinkindern
Die dritte Phase des Familienzyklus beginnt mit der ersten Schwangerschaft und endet mit der Einschulung des letzten Kindes. Bei Familien mit zwei und mehr Kindern überschneiden sich also dritte und vierte Phase - bei Familien mit vier und mehr Kindern, bei einem großen Geburtenabstand oder bei Stieffamilien, bei denen die Partner ältere Kinder mit in die Ehe bringen und dann ein gemeinsames Kind zeugen, können sich auch dritte, vierte und fünfte Phase des Familienzyklus überschneiden. Im Jahr 1988 wurde das erste Kind nach durchschnittlich 2,4 Ehejahren geboren (1980 waren es noch 2,7 Ehejahre), das zweite Kind folgte nach 3,2 Jahren. Die Mütter waren bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt 26,6 Jahre alt.
Im Verlauf der Schwangerschaft unterscheidet Gloger-Tippelt (1985) fünf Phasen:
(l) Sie beginnt mit einer Verunsicherungsphase, die etwa bis zur 12. Schwangerschaftswoche dauert.
(2) Es folgt die Anpassungsphase, die bis zur 20. Woche dauert. Sie ist in der Regel relativ konflikt- und belastungsfrei. Zumindest bei der ersten Schwangerschaft beginnen jetzt die Eltern, sich intensiv auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten: Sie besuchen zum Beispiel Kurse über Säuglingspflege, Kindererziehung und Methoden einer sanften Geburt oder lesen relevante Bücher.
(3) In der Konkretisierungsphase, die etwa bis zur 32. Woche dauert, wird das sich nun schon bewegende Kind als eigenständiges Wesen wahrgenommen. Die Ehepartner beginnen, sich als Eltern zu erleben und die entsprechenden Rollen zu übernehmen.
(4) Die Phase der Antizipation des Kindes und der Vorbereitung auf die Geburt ist eine Zeit großer physischer und psychischer Belastungen für die werdende Mutter. Sie leidet oft unter körperlichen Beschwerden und ermüdet leicht, hat Angst vor der Entbindung, zieht sich unter Umständen in sich zurück oder ist zeitweise depressiv. Ihr Mann ist jedoch in dieser Phase zumeist psychisch stabil und kann sie stützen.
(5) Mit der Geburtsphase endet die Schwangerschaft. Heute ist der Ehemann oft bei der Geburt im Kreißsaal anwesend, kann seine Frau unterstützen und bei der Versorgung des Neugeborenen helfen. Dieser Frühkontakt gilt als wichtig für den Aufbau einer positiven Eltern-Kind-Beziehung.
Nach einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) erinnerten 69% der befragten Mütter die Schwangerschaft als eine ausgesprochen schöne Zeit; nur 12% erlebten sie als überwiegend belastend. Hier ist auch von Bedeutung, inwieweit sie während der Schwangerschaft die emotionale Unterstützung ihrer Partner erfuhren.
Nach der Geburt des ersten Kindes müssen die Ehepartner die Vater- beziehungsweise Mutterrolle übernehmen. Aufgrund ihrer Unerfahrenheit sind sie bei der Pflege des Säuglings in der Regel unsicher und übervorsichtig. Sie müssen eine Vielzahl neuer Verhaltensweisen erlernen und Empathie für die Reaktionen des Kindes entwickeln. So wird es zum "Sozialisator" seiner Eltern, die sich ihm anpassen müssen. Sein Aussehen und Verhalten bestimmen die Reaktionen und das Erleben der Eltern mit. Beispielsweise ist es ein großer Unterschied, ob der Säugling ruhig ist und viel schläft oder ob er ein schwer voraussagbares Verhalten zeigt und kaum zu beruhigen ist. Vor allem untröstbar schreiende Säuglinge, die so genannten "cry-babys", werden für ihre Eltern oft zum Problem. Sie machen zwischen 10 und 15% aller Babys aus und leiden oft unter Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten. Aufgrund ihres untröstbaren Schreiens fühlen sich ihre Mütter ohnmächtig und hilflos, entwickeln unter Umständen sogar Depressionen.
Der Säugling steht nun im Mittelpunkt des Familienlebens und verlangt ein Höchstmaß an Arbeits- und Zeitaufwand, an Aufmerksamkeit und liebevoller Zuwendung, an taktiler, visueller und akustischer Stimulation. Zunächst lebt er in Symbiose mit seiner Mutter und ist von ihr total abhängig. Diese ist vor allem auf ihre "Instinkte" angewiesen, um die Signale des Kindes zu verstehen. Im Gegensatz zu früher beteiligen sich heute bereits viele Väter an der Säuglingspflege - sie können ihr Kind genauso gut wie ihre Frauen versorgen. Sie freuen sich an ihrer zunehmenden Kompetenz im Umgang mit dem Baby, entdecken neue Befriedigungen und erleben eine beglückende emotionale Beziehung zum Kind. So leisten sie von Anfang an einen eigenständigen Beitrag zur Entwicklung des Kindes, bewerten die Familientätigkeit positiv und sind eher motiviert, sich auch in Zukunft an der Erziehung zu beteiligen.
Die Geburt des ersten Kindes bringt eine Vielzahl von radikalen Veränderungen mit sich. So wandelt sich die Familienstruktur, entsteht nun ein mehrgenerationales System mit zwei Subsystemen. Auch kommt es zu einer großen Umstellung im Lebensstil der erwachsenen Familienmitglieder: Sie müssen immer sofort auf die Bedürfnisse des Säuglings reagieren, was zu einer Zerstückelung des Tagesablaufs führt und ein ungestörtes Arbeiten daheim unmöglich macht. Dieses bedeutet auch eine drastische Einschränkung persönlicher Freiheitsräume, den Verzicht auf die Befriedigung vieler Bedürfnisse, ein Zurückstellen eigener Interessen und die Behinderung des Strebens nach Selbstverwirklichung. Vielfach nehmen das subjektive Wohlbefinden und die eigene Leistungsfähigkeit ab, da die fortwährende nächtliche Ruhestörung Schlafmangel, ständige Müdigkeit und Nervosität bewirkt. Auch führen die Belastungen der Säuglingspflege und die hormonelle Umstellung bei der Frau leicht zu körperlicher und psychischer Erschöpfung. Diese Situation kann noch dadurch verschärft werden, dass den Eltern zunächst die Anpassung an die Bedürfnisse des Kindes misslingt, weil sie zum Beispiel unzureichend auf die Elternrolle vorbereitet sind. Ähnliches gilt für den Fall, dass der Säugling krank oder behindert ist. Größere Belastungen sind natürlich auch bei Zwillingen, Drillingen oder gar Vierlingen zu bewältigen - so gab es zum Beispiel im Jahr 1985 12.765 Mehrlingsgeburten, das heißt 21,7 auf 1.000 Geburten (Statistisches Bundesamt 1987c).
Die durch die Erfordernisse der Säuglingspflege bedingte ständige Anwesenheitspflicht bringt eine große Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Eltern mit sich. Es bleibt weniger Zeit für Freunde und Bekannte, muss auf viele Arten der außerhäuslichen Freizeitgestaltung verzichtet werden und kommen viele Urlaubsziele nicht mehr in Frage. Diese Situation kann vor allem für solche Mütter zum Problem werden, die nach der Geburt des Kindes auf eine weitere Berufsausübung verzichten. Sie verlieren viele berufsbedingte Kontakte - die Aufnahme von Beziehungen zu Frauen in derselben Lage gelingt in der Regel erst dann, wenn sie diese auf dem Spielplatz oder im Kindergarten kennen lernen, also wenn das Kind schon älter ist. So fühlen sie sich oft isoliert und einsam, vermissen die Befriedigungen des Berufslebens, sind kognitiv unausgelastet und leiden unter dem geringen Ansehen der Mutterrolle. Hinzu kommt, dass sich in diesen Fällen auch die finanzielle Situation der Familie sehr stark verschlechtert, da einerseits das Einkommen der Frau wegfällt und nur zum Teil durch das Erziehungsgeld wettgemacht wird und weil andererseits das Kind Ausgaben zwischen 400 und 460DM im Monat verursacht (Zentralstelle für rationales Haushalten 1990). Dies gilt vor allem für Familien, in denen der Mann noch recht wenig verdient, da er erst am Anfang seiner beruflichen Karriere steht.
Bleibt die Frau jedoch berufstätig, so ist die Familie in der Regel auf die Hilfe von Verwandten angewiesen, da es nur wenige Einrichtungen der öffentlichen Kleinstkinderbetreuung gibt. Beispielsweise sind nur für rund 4% aller Kleinstkinder Krippenplätze vorhanden; daneben gibt es noch die Möglichkeit der öffentlich oder privat organisierten Tagespflege. Bei einer Betreuung durch Verwandte leiden die Eltern oft unter Schuldgefühlen oder erleben es als problematisch, diesen gegenüber zu Dank verpflichtet zu sein. Häufig wagen sie auch nicht, Verwandte auf Erziehungsfehler hinzuweisen, weil sie deren Hilfe zu verlieren befürchten. Ferner kann es trotz der Entlastung durch Dritte zu einer Überforderung der berufstätigen Mutter kommen, wenn sie nach der Arbeitszeit die Säuglingspflege übernehmen und mehr oder minder alleine den Haushalt versorgen muss.
Der Übergang zur Elternschaft wird also oft als Krise erlebt. Das Auftreten oder Ausbleiben des "Erst-Kind-Schocks" ist von einer Vielzahl verschiedener Variablen abhängig. Zumeist ist er weniger stark ausgeprägt, wenn das Kind ein Wunschkind ist sowie wenn die Partner länger als drei Jahre vor der Geburt zusammenlebten, eine gute Ehebeziehung aufgebaut haben und Techniken für die Lösung von Problemen beziehungsweise die Bewältigung kritischer Familienereignisse besitzen. Ferner ist von Bedeutung, ob die Ehepartner Vorerfahrungen im Umgang mit Kleinstkindern haben, inwieweit sie sich auf das Kind vorbereitet haben und wie viel Unterstützung sie durch Dritte erfahren. In der Regel bewältigen Eltern aber die meisten Anforderungen, Veränderungen und Probleme innerhalb von drei Monaten nach der Geburt ihres Kindes.
Natürlich ist der Übergang zur Elternschaft nicht nur mit Schwierigkeiten verknüpft, sondern hat auch viele positive Seiten. So berichten nach der Geburt eines Kindes viele Eltern von zunehmender Reife sowie von mehr Verantwortungsbewusstsein, Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie erleben einen Zugewinn an Lebensinhalt, Freude, Glück und Zufriedenheit. Auch sprechen sie der Familie einen größeren Wert zu, werden häuslicher und fühlen sich einander noch mehr zugehörig. Oft berichten sie von einem persönlichen Wachstumsschub, da sie eine Vielzahl neuer Anforderungen und Aufgaben erfolgreich bewältigten. Zudem erfahren sie in der Regel positive Reaktionen von Verwandten und Freunden. Meistens stehen den überdurchschnittlichen Belastungen also überdurchschnittlich viele emotionale Gratifikationen gegenüber.
Nach der Geburt des ersten Kindes wandeln sich zumeist auch die Machtstruktur und Arbeitsteilung in der Familie in Richtung auf traditionelle Geschlechtsrollenbilder. Während die meisten Männer nach der Geburt des Kindes wohl ihre Frauen zu entlasten versuchen und ihnen helfen, ziehen sie sich mit der Zeit immer mehr aus den Bereichen der Hausarbeit und Kindererziehung zurück. Die Geburt des ersten Kindes führt ferner zu einem Wandel und einer Neuinterpretation der Ehebeziehung. Oft verliert diese an Bedeutung, da die Partner aufgrund der aus der Säuglingspflege resultierenden Belastungen weniger gemeinsam unternehmen und häufiger alleine ausgehen. Auch wird vielfach der Mann für die Frau weniger wichtig und muss deren Liebe und Zuneigung mit dem Kind teilen. Oft wendet er sich dann mehr dem Beruf, seinem Freundeskreis oder seinen Hobbys zu, was zur Entfremdung der Partner führen kann. Während direkt nach der Geburt in der Regel ein Anstieg der ehelichen Zufriedenheit und eine große Harmonie im sexuellen Bereich erlebt werden ("Baby-Flitterwochen"), kommt es dann aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen häufig zu einer Verschlechterung der Ehequalität. Vielfach werden Spannungen, eine erhebliche Beeinträchtigung der partnerschaftlichen Interaktion sowie ein im Gegensatz zu früher nicht mehr so zärtlicher Umgang miteinander erlebt.
Wird ein zweites Kind geboren, nimmt die Komplexität des Familiensystems weiter zu. So gibt es bei einem Kind nur drei Beziehungen (zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind sowie Ehemann und Ehefrau), während bei zwei Kindern sechs und bei drei Kindern zehn Beziehungen zu unterscheiden sind. Auch bildet sich das Geschwistersystem als drittes Subsystem der Familie aus. Ferner wird es für die Erwachsenen immer schwerer, den Bedürfnissen aller Familienmitglieder zu entsprechen: Mit der Zahl der Kinder wachsen also die Belastungen, sind größere Anstrengungen nötig, fällt mehr Arbeit an. Zumeist ist aber auch eine Zunahme positiver und beglückender Aspekte des Familienlebens zu verzeichnen. Hinzu kommt, dass sich die Geschwister mit zunehmendem Alter immer mehr miteinander beschäftigen, sodass der Betreuungsaufwand bald nicht mehr sehr viel größer als bei Einzelkindern ist.
Während der Schwangerschaft und nach der Geburt des zweiten Kindes sind die Eltern weniger unsicher und ängstlich als beim Erstgeborenen. Sie gehen routinierter und gelassener mit ihm um, beschäftigen sich zumeist weniger intensiv mit ihm und schenken ihm weniger Aufmerksamkeit und Zuwendung. Das zweitgeborene Kind macht also andere Erfahrungen mit seinen Eltern, da es von ihnen anders als das erstgeborene behandelt wird. Zudem findet es eine unterschiedliche Situation vor, da sich in der Zwischenzeit die Familiencharakteristika verändert haben. Hinzu kommt die Stimulation durch ein nur wenig älteres Geschwisterteil.
Vor allem wenn die Geburten sehr schnell aufeinander folgten, fällt es Eltern oft schwer, den Bedürfnissen beider Kinder gerecht zu werden. So fühlen sie sich häufig überfordert, sind erschöpft und erleben ein weiteres Absinken der Ehezufriedenheit. In der Regel ändert sich auch ihr Verhalten dem erstgeborenen Kind gegenüber: Sie beschäftigen sich plötzlich sehr viel weniger mit ihm, machen häufiger von Anweisungen Gebrauch und schränken seinen Bewegungsraum mehr durch Verbote ein. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass etwa die Hälfte der Kinder auf die Geburt eines Geschwisterteils mit negativen Verhaltensänderungen reagiert, wobei Jungen sich eher zurückziehen, während Mädchen eher ein abhängiges Verhalten zeigen (Schütze 1989). Vieles hängt aber davon ab, wie die Eltern das erstgeborene Kind an das Zweite heranführen. Sobald sich Letzteres selbständig fortbewegen kann, greift es jedoch häufig ausgesprochen störend in die Sphäre des Geschwisters ein. Dieses reagiert dann (wieder) negativ -und muss erfahren, dass die Eltern das jüngere Kind ihm gegenüber in Schutz nehmen.
Aber nicht nur bei der Geburt eines zweiten (oder weiteren) Kindes kommt es zu neuen Veränderungen, sondern auch mit zunehmendem Alter der Kinder. So wird die Familie wieder umgeformt, wenn die Kinder zu laufen oder zu sprechen beginnen. Sie trennen ihr Selbst zunehmend von dem ihrer Eltern ab, bauen Ich-Grenzen auf und entwickeln einen eigenen Willen. Auch werden sie selbständiger und nehmen von sich aus Kontakt zu anderen Erwachsenen und Kindern auf. In diesem Zeitraum lernen sie außerordentlich viel, wobei sie hohe Anforderungen an die erzieherischen und bildenden Fähigkeiten ihrer Eltern, an deren Vorbild und Geduld stellen. So möchten sie über die Natur, die Technik, die Kultur und die Mitmenschen belehrt werden. Auch müssen sie Kulturfertigkeiten und Techniken des Problemlösens lernen sowie ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten ausbilden.
Einen weiteren Einschnitt in diese Phase des Familienzyklus bringt der Kindergarteneintritt mit sich. Im Bundesdurchschnitt besuchen rund 70% aller Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr den Kindergarten. So machen fast alle Kleinkinder die Erfahrung des Kindergartenbesuchs, wobei sich vor allem die Integration in eine größere altersgemischte Gruppe, die dort erworbenen sozialen Kompetenzen, die Sprachförderung und die Vielzahl kognitiver und emotionaler Lernerfahrungen auf die kindliche Entwicklung positiv auswirken. Auch können sich ihre Gestaltungsfreude und ihr Bewegungsdrang im Kindergarten besser als in der Familie entfalten, können die Kinder ihre Kräfte an denen der Gleichaltrigen messen, werden sie auf die Schule vorbereitet.
Der Eintritt in den Kindergarten und die damit verbundene längerfristige Trennung mag zunächst sowohl den Kindern als auch den (nichtberufstätigen) Müttern schwer fallen. Beide Seiten müssen lernen, sich voneinander abzulösen und autonomer zu werden. Nun treten die Erzieherinnen als neue Autoritäten und Vorbilder in das Leben der Kinder ein und werden manchmal von den Eltern als Konkurrenz erlebt. Dies macht es erforderlich, dass Erziehungsziele und -stile zwischen Eltern und Erzieherinnen abgestimmt werden und diese zur Partnerschaft finden, damit innere Konflikte beim Kind vermieden und seine Entwicklungsbedürfnisse auf einheitliche Weise befriedigt werden. Die Eltern bleiben weiterhin die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder und unterstützen sie bei den nun anstehenden Entwicklungsaufgaben, also zum Beispiel bei der Übernahme der Geschlechtsrolle, der Identitätsfindung, der Ausbildung eines Gewissens und der Internalisierung von Normen.
Laut einer nichtrepräsentativen Befragung von 155 Elternpaaren mit mindestens einem Kind im Kindergartenalter (Stein 1983) erlebten nur 44% der Mütter und 59% der Väter keine nennenswerten Schwierigkeiten im Umgang mit ihrem Kind; 52 beziehungsweise 40% gaben hingegen an, öfters Probleme zu haben. Auch müssen sie sich mit der Kinderfeindlichkeit ihrer sozialen Umwelt auseinander setzen. So beklagten junge Eltern bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) die mangelnde Rücksichtnahme auf Kinder im Verkehr (47%), das Umrennen von Kleinkindern im Gedränge (33%), Probleme beim Einkaufen mit dem Kinderwagen (26%), verdreckte Kinderspielplätze (25%), die negative Haltung von Gastwirten Kindern gegenüber (23%), Beschwerden der Nachbarn über Kinderlärm (21%), fehlende Kinderspielplätze (17%), Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche (16%) usw.
Familie mit Schulkindern
Mit der Einschulung des erstgeborenen Kindes beginnt eine neue Phase des Familienzyklus, die zwischen acht und zwölf Jahren lang ist. Die Kinder werden unausweichlich mit gesellschaftlichen Leistungsanforderungen und der Bewertung ihrer Kenntnisse, ihres Verhaltens und ihrer Fähigkeiten konfrontiert. Sie müssen sich bestimmten Regeln unterwerfen, vorab definierte Beziehungen zu Lehrern eingehen und sich in eine Gruppe Gleichaltriger integrieren. Auf jedem dieser Gebiete können sie versagen, wenn sie zum Beispiel zu früh eingeschult wurden, in ihrer kognitiven Entwicklung (noch) nicht den Stand ihrer Mitschüler erreicht haben, andere Erziehungsstile gewohnt sind oder aufgrund unzureichender interpersonaler Fertigkeiten nicht mit ihren Klassenkameraden zurechtkommen. Ferner kann es zu einem Bruch in der Entwicklung der Kinder kommen, wenn am Ende der Grundschulzeit falsche Entscheidungen bezüglich des weiteren Bildungsweges getroffen werden - wenn beispielsweise begabte Kinder in der Hauptschule unter Unterforderung oder zu wenig intelligente Kinder im Gymnasium unter Überforderung leiden und mit Verhaltensauffälligkeiten, Indifferenz und anderen Problemen reagieren. Aber auch später können aufgrund der Unüberschaubarkeit des Bildungswesens noch Fehler bei der weiteren Planung der Schullaufbahn gemacht werden. So stehen Eltern in der Regel mehrmals während der Schulzeit ihrer Kinder unter einem großen Entscheidungsdruck.
Kinder verbringen etwa ein Drittel des Tages in der Schule, die einen großen Einfluss auf ihre kognitive, emotionale und soziale Entwicklung ausübt. Sie eignen sich in ihr eine Unmenge von Kenntnissen an und entwickeln eine Vielzahl von Fertigkeiten. Dabei stehen sie unter einem gewissen Qualifikationsdruck, müssen bestimmte Leistungen erbringen und miteinander konkurrieren (Schulstress). In der Schule werden Kinder aus der realen Welt ausgegliedert und dieser in mancherlei Hinsicht entfremdet. So wurden die ihnen vermittelten Kenntnisse über Natur, Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zuvor gefiltert, werden sie vielfach zerstückelt und zusammenhanglos dargeboten, sind sie oft wirklichkeitsfremd und wenig nützlich. Zudem haben Schüler wenig Kontakt zu Andersaltrigen, da sie in der Klasse immer nur mit einer Altersgruppe zusammen sind. Auch reagieren Lehrer selten auf sie als Person, werden kaum erzieherisch tätig und lassen wenig Raum für Spontaneität und Kreativität. Sie fördern kaum die Integration in Gleichaltrigengruppen und den Erwerb sozialer Fertigkeiten wie Empathie, Metakommunikation, Fähigkeit zur verbalen Konfliktlösung oder Vermittlung. Laut einer Umfrage bei mehr als 2.000 Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren (Allerbeck/Hoag 1985) ging der Anteil der Schüler, die gern oder sehr gern zur Schule gehen, im Vergleich zu einer Befragung von 1962 um 32% zurück: Von 75% auf 43%. Auch sind nur noch 14% der Schüler der Meinung, dass Lehrer gerecht seien.
Es ist offensichtlich, dass Kinder ihre Unzufriedenheit mit der Schule, ihre negativen Erfahrungen mit Lehrern und ihre Leistungsprobleme mit in die Familie hineinnehmen und dass diese eine Vielzahl elterlicher Verhaltensweisen bestimmen. So steht die Schule oft im Mittelpunkt der familialen Interaktion. Die Eltern werden unmittelbar mit Schulschwierigkeiten konfrontiert und müssen helfend eingreifen, also zum Beispiel Kontakt mit Lehrern aufnehmen oder die Leistungsmotivation ihrer Kinder fördern. Vielfach erzeugen oder verstärken sie aber auch Probleme, wenn sie zum Beispiel einen starken Leistungsdruck ausüben - was besonders für hoch qualifizierte Eltern gilt - und so ihre Kinder überfordern. Sie bewerten oft Leistung und Erfolg zu hoch, sehen im Schulversagen eine Schande und bestrafen schlechte Noten schwer. So mögen sie die Schulprobleme ihrer Kinder nur noch verstärken, was zum Beispiel zu Leistungsverweigerung, Angst, Schulphobien, Nervosität und anderen Verhaltensauffälligkeiten führen kann.
Andere Eltern fördern hingegen ihre Kinder zu wenig. So wünschten sich laut einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) rund 20% aller Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, die ihre Hausaufgaben alleine machen, die Hilfe ihrer Eltern. Generell erledigten 67% der Kinder in dieser Altersgruppe die Hausaufgaben selbst; bei 33% half jemand, und zwar zumeist die Mutter. Berufstätige Mütter engagierten sich allerdings weniger in der Hausaufgabenbetreuung.
In dieser Phase des Familienzyklus stehen Kinder nicht mehr so sehr im Zentrum des Familienlebens wie früher. Sie lösen sich immer mehr von ihren Eltern ab, werden unabhängiger, eigenständiger und selbstbestimmter. Auch wenden sie sich mehr und mehr der Gleichaltrigengruppe zu. So verlieren die Eltern an Bedeutung, können sich wieder mehr ihrer Partnerbeziehung und ihren Hobbys widmen. Oft wird nun die Frau wieder berufstätig, was große Auswirkungen auf den Tagesrhythmus und Lebensstil der Familie hat. Die Eltern müssen ihr Erziehungsverhalten mit dem Heranwachsen der Kinder verändern und ihnen mit zunehmendem Alter immer mehr Rechte und Pflichten zusprechen. Auch ist wichtig, dass sie ihre Ablösung und Individuation fördern.
Familie mit Jugendlichen
Im Mittelpunkt der fünften Phase des Familienzyklus, die sechs bis acht Jahre lang dauert, steht die Ablösung des Kindes von seiner Familie. Dieser Zeitabschnitt endet in der Regel, wenn der Heranwachsende von zu Hause auszieht, seine erste Arbeitsstelle antritt oder ein Studium beginnt. So dominieren noch die Schule beziehungsweise die Ausbildung im Leben des Jugendlichen, bestimmen einen großen Teil seines Tagesablaufs und spielen auch eine wichtige Rolle in der Familieninteraktion - mit dem Unterschied, dass im Gegensatz zur vierten Phase der Schüler immer mehr Verantwortung für seine Schulleistungen übernehmen muss und immer weniger auf die Hilfe seiner Eltern bei den Hausaufgaben zählen kann. Für knapp zwei Millionen Heranwachsende fällt in diesen Zeitabschnitt auch die betriebliche Berufsausbildung.
Die fünfte Phase des Familienzyklus beginnt mit der Pubertät des erstgeborenen Kindes. Dieses erlebt nun große Veränderungen im körperlichen, seelischen und intellektuellen Bereich. Es spürt das Erwachen des Sexualtriebes, übernimmt endgültig seine Geschlechtsrolle und beginnt, intensive Beziehungen mit gegengeschlechtlichen Partnern einzugehen. So hatten laut einer repräsentativen Umfrage (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985a) bereits 8% der befragten Jugendlichen mit 14 Jahren, rund 35% mit 15 Jahren, etwa 60% mit 16 Jahren und circa 77% mit 17 Jahren erste sexuelle Erfahrungen gesammelt. Problematisch ist, wenn Heranwachsende Angst vor dem anderen Geschlecht haben und keine heterosexuellen Beziehungen eingehen, da hierdurch ihre weitere Entwicklung gestört wird.
Jugendliche verspüren in der Regel einen starken Drang nach Selbstdifferenzierung, Autonomie und Selbständigkeit. Sie möchten immer mehr Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens übernehmen - und müssen das auch, da sie wichtige Entscheidungen zum Beispiel über ihren weiteren Bildungsweg (Besuch der Hochschule, Berufsfachschule, Fachschule usw.) zu fällen sowie einen ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechenden Beruf auszuwählen haben. Im Gegensatz zu früher werden ihnen sehr viel mehr Handlungskompetenzen zugesprochen. So waren laut einer repräsentativen Umfrage (EMNID-Institut 1986f) zum Beispiel knapp 65% der Befragten der Meinung, dass Jugendliche spätestens ab 14 Jahren selbständig und frei über den Kleidungskauf entscheiden und spätestens ab 16 Jahren eine eigene politische Meinung gegenüber Erwachsenen vertreten dürfen. Knapp 50% meinten, dass Jugendliche spätestens ab 16 Jahren sexuelle Beziehungen haben dürfen, und 57% hielten Jugendliche diesen Alters für fähig, alleine verreisen zu können. Jüngere Befragte sprachen Adoleszenten sehr viel früher diese Handlungskompetenzen zu.
Viele Jugendliche erfahren in dieser Phase des Familienzyklus eine Identitätskrise. Sie experimentieren mit extravaganter Kleidung und auffallenden Frisuren, sind empfindlich, sensibel und leicht zu verletzen, haben Schwierigkeiten im Umgang mit Autorität, Intimität und Abhängigkeit. Häufig suchen sie nach einer eigenen Wertorientierung, indem sie sich mit Philosophien, Religionsanschauungen und Ideologien auseinander setzen. Ferner zeigen sie vielfach ein großes Interesse an Bürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen und ähnlichen Verbänden, wobei sie sich aber nur selten in ihnen engagieren. Die Suche nach einer eigenen Identität, aber auch die Angst vor dem Erwachsenwerden, kann Jugendliche in Sekten und extreme Gruppierungen führen oder zum Experimentieren mit Drogen, Alkohol, Homosexualität u. Ä. verleiten. Oft leben Konflikte aus früheren Entwicklungsphasen wieder auf und lassen sich nun endgültig bearbeiten. Die meisten Jugendlichen werden im Verlauf der Zeit mit diesen Schwierigkeiten und mit Problemen im schulischen Bereich, in der Berufsausbildung und bei der Arbeitssuche fertig. Sie erleben diese Phase als eine Zeit der positiven Persönlichkeitsentwicklung und zunehmenden Reife.
Viele Jugendliche geraten nun in Gegensatz zur Welt der Erwachsenen. So waren bei einer repräsentativen Umfrage (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985a) 71% der befragten Adoleszenten der Überzeugung, dass Jugendliche und Erwachsene im Allgemeinen weniger gut oder überhaupt nicht gut miteinander auskommen. Für 60% waren Konflikte mit der älteren Generation ein großes oder sehr großes Problem. Nach einer anderen Umfrage (SINUS-Institut 1985) waren 72% der befragten Jugendlichen der Meinung, dass die wenigsten Erwachsenen die Probleme von Adoleszenten wirklich verstehen. 53% erlebten Jugendlichen- und Erwachsenenwelt als zwei getrennte Welten. Und 58% meinten, dass man von Gleichaltrigen mehr lernt und erfährt als von Erwachsenen. So engagieren sich Jugendliche in Gruppen Gleichaltriger, verbringen viel Zeit in ihnen und passen sich ihren Normen an. Durch das Befolgen bestimmter Modetrends symbolisieren sie die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Gruppe. Diese übt einen starken Einfluss auf sie aus und erleichtert ihnen die Ablösung von den Eltern, die Individuation und Selbstfindung.
Nahezu alle Jugendliche wohnen noch mit ihren Eltern zusammen: Laut einer repräsentativen Umfrage (Allerbeck/Hoag 1985) lebten nur 3,6% der befragten 16- bis 18-jährigen in anderen Wohnverhältnissen. Oft gestaltet sich das Zusammenleben in der Familie recht schwierig. So kommt es zu einer gewissen Entfremdung, hervorgerufen durch andere Lebensbezüge, Werte und Einstellungen. Auch tendieren Jugendliche dazu, die Unterschiede zwischen sich selbst und den Eltern zu betonen, während Letztere eher Ähnlichkeiten herausstellen. Immer wieder kommt es zu Konflikten. Laut einer repräsentativen Befragung von Adoleszenten (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985b) entzünden sich diese vor allem an Unordentlichkeit, schlechten Schulleistungen, Schwindeleien, der Dauer des abendlichen Ausgehens, der Kleidung, dem Fernsehkonsum, dem Umgang mit Geld, dem Schminken und den Esssitten (in dieser Reihenfolge). Jungen berichten häufiger von Konflikten aufgrund ihrer Schulleistungen, Umgangsformen und mangelnden Ordnung, während Mädchen sie in erster Linie wegen gegengeschlechtlicher Freundschaften und der Dauer abendlicher Aktivitäten erleben. Aufgrund der Vorverlagerung der Jugendphase kommt es immer früher zu derartigen Auseinandersetzungen (Jugendwerk der Deutschen Shell 1985a). Auch scheinen Konflikte bei einer nichtberufstätigen Mutter häufiger zu sein als bei einer erwerbstätigen (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a).
In dieser Phase des Familienzyklus nimmt der Einfluss der Eltern immer mehr ab. Sie gestehen ihren Kindern mehr und mehr Rechte zu, bis diese schließlich die Position eines nahezu gleichberechtigten jungen Erwachsenen erreichen. Schließlich bleibt den Eltern nur noch eine Beraterfunktion. Sie müssen die Ablösung der Jugendlichen und die daraus resultierenden Gefühle des Verlustes und der Trauer psychisch verarbeiten. So mögen sie manchmal die unbewusste Versuchung verspüren, diesen Ablösungsprozess zu behindern und die Kinder an sich zu binden. Vereinzelt beschleunigen sie ihn aber auch, indem sie die Jugendlichen zum Beispiel aus Angst vor Inzest aus der Familie ausstoßen.
Die Familie nach Ablösung der Kinder
Die nächste Phase des Familienzyklus, die etwa 15 Jahre dauert, ist zunächst noch durch die Anpassung der Ehepartner an die neue Familiensituation gekennzeichnet, die sich aus der Ablösung und dem Auszug ihrer Kinder aus dem gemeinsamen Haushalt ergibt. Nun bildet wieder das Ehesubsystem den Mittelpunkt der Familie. Diese Reduktion auf die Gattenbeziehung führt manchmal zum Ausbruch verdrängter, nicht bewältigter oder neuer Konflikte. Insbesondere wenn die Partner nur wegen der Kinder zusammengeblieben sind, droht jetzt erneut die Scheidung. Problematisch ist auch, wenn die Ehebeziehung in den vorausgegangenen Phasen des Familienzyklus auf die Elternschaft geschrumpft ist. Dann verspüren die Partner eine große Leere und einen Mangel an innerer Gemeinsamkeit und Bezogenheit. So muss die Ehebeziehung neu geregelt und belebt werden, müssen die Ehegatten gemeinsame Gesprächsthemen, Interessen und Freizeitaktivitäten finden. Viele übernehmen jetzt auch verstärkt öffentliche Verantwortung, indem sie sich ehrenamtlich in Kirchengemeinden, Verbänden, Vereinen oder Parteien engagieren.
Nichtberufstätige Frauen haben vielfach besonders große Schwierigkeiten, sich an ein Familienleben ohne Kinder zu gewöhnen. Sie sind noch vital und leistungsfähig - fühlen sich aber sinnvoller Aufgaben beraubt, sind unausgelastet und unzufrieden, leiden unter einem Identitätsverlust. Auch halten sie sich oft noch für zu jung, um eine Großmutterrolle zu übernehmen. Diese Problematik führt bisweilen zu einer Verschlechterung des subjektiven Gesundheitszustandes, zu Depressionen oder zu Spannungen mit dem Partner und den Kindern. Die Frauen können jetzt nur noch unter großen Schwierigkeiten in die Arbeitswelt zurückkehren.
Erwerbstätige Männer und Frauen erreichen in der ersten Hälfte dieser Phase des Familienzyklus zumeist den Höhepunkt ihrer Karriere. Sie gehen routiniert und selbstsicher mit den Anforderungen des Berufslebens um, übernehmen leicht die Initiative und zeichnen sich vielfach durch eine besondere Produktivität aus. Da sie nun einerseits ihr höchstes Erwerbseinkommen erzielen und andererseits nur noch geringe Ausgaben für ihre Kinder haben (sofern diese nicht noch studieren oder arbeitslos sind), ist ihr Lebensstandard recht hoch, können sie sich zum Beispiel eine neue Wohnungseinrichtung, große Autos und kostspielige Auslandsreisen leisten. Eine erneute Belastung der Ehebeziehung bringt oft die "Midlife-Crisis" mit sich, die vor allem bei Männern zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr auftritt. Die Betroffenen überdenken ihr bisheriges Leben kritisch und ziehen es häufig gefühlsmäßig in Zweifel. Auch müssen sie sich mit dem erreichten Grad ihres beruflichen Erfolges, ihrer abnehmenden Potenz und ihrer geringer werdenden Attraktivität abfinden, müssen Enttäuschungen und das Verfehlen bestimmter Lebensziele verarbeiten. In manchen Fällen führt dies zu Depressionen, oder es kommt zu außerehelichen Abenteuern, durch welche die Partner überprüfen wollen, ob sie auf Personen des anderen Geschlechts noch attraktiv wirken.
Für Frauen ist das Klimakterium besonders belastend, das zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr auftritt. Neben körperlichen Veränderungen kommt es vielfach auch zu einer Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens und der Leistungsfähigkeit, zu Schlaflosigkeit, Schwindelanfällen, Depressionen oder sogar psychotischen Zuständen. Auch hier sind manchmal negative Auswirkungen auf die Ehebeziehung festzustellen, muss eine neue Haltung zur Sexualität gefunden werden. In der zweiten Hälfte dieser Phase des Familienzyklus müssen sich die Partner mit dem Altern, mit den abnehmenden Kräften und der Verschlechterung ihrer Gesundheit auseinander setzen. Ihre berufliche Aktivität nimmt ab; sie erleben ein Gefühl der Vollendung oder geben höhere Ziele auf. Später gewinnen sie mehr und mehr Distanz zum Beruf und bereiten sich schon auf den Ruhestand vor.
Zu Beginn dieser Phase des Familienzyklus sind manche Kinder noch von ihren Eltern finanziell abhängig, obwohl sie sich schon von ihnen abgelöst haben und von daheim ausgezogen sind. Insbesondere während des Wehrdienstes oder Studiums sind sie auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, wobei diesen vor allem im letztgenannten Fall hohe Ausgaben entstehen: So wurden Ende der 80er-Jahre im Durchschnitt 433DM pro Monat gezahlt - an Studenten, die keine Förderung nach BAföG erhielten, sogar 622DM (BT-Drucksache 11/5106). Studenten und arbeitslose Akademiker durchleben nun die Phase der Postadoleszenz, die einerseits durch ökonomische Unselbständigkeit und andererseits durch eine hohe intellektuelle, politische und soziale Reife, durch Kritikfähigkeit, Offenheit, postmaterielle Werte und die Zugehörigkeit zu bestimmten informellen Gruppen gekennzeichnet ist. Treten die erwachsenen Kinder in die Phasen der jungen Ehe und der Familie mit Kleinkindern ein, müssen sich ihre Eltern an die Schwiegersöhne beziehungsweise -töchter gewöhnen. Lehnen sie diese ab, mag ihr Verhalten zu fortwährenden Konflikten, Entfremdung und eventuell sogar zu einem Beziehungsabbruch führen. Problematisch ist aber auch, wenn sie sich immer wieder in die junge Familie einmischen. Später müssen sich die Eltern an ihre Enkel anpassen und die Großelternrolle übernehmen. Nichterwerbstätige Frauen springen oft als Babysitter ein oder nehmen ihre Enkel kurzfristig zu sich, während berufstätige Frauen seltener als Großmütter verfügbar und oft auch zu derartigen Diensten nicht bereit sind. In vielen Fällen besteht ein reger Austausch zwischen Zeugungs- und Herkunftsfamilie.
In dieser Phase des Familienzyklus müssen viele Eltern ihren eigenen Eltern und vereinzelt sogar noch ihren Großeltern helfen, die aufgrund ihres hohen Alters, ihrer abnehmenden körperlichen Kräfte und ihrer Gebrechen viele Verrichtungen nicht mehr selbst ausführen können. Sie erledigen für sie Einkäufe und Behördengänge, fahren sie zum Arzt oder zum Altenclub, übernehmen Gardinenwäsche und Teppichpflege, führen kleinere Reparaturen durch oder halten den Garten in Ordnung. In manchen Fällen sind die jungen Erwachsenen weniger hilfsbereit, zum Beispiel wenn sie in ihren jungen Jahren keine echte Bindung an ihre Eltern (und Großeltern) entwickelt haben, wenn ihre Ablösung problematisch verlaufen ist oder wenn ihre Eltern gegen ihre Ehe waren und ihnen in den ersten Ehejahren keinerlei Unterstützung zukommen ließen. Im Extremfall mögen sie sogar jegliche Verantwortung für ihre Eltern ablehnen. Auch ist das Verhältnis zwischen den älteren Generationen durch ihre gesamte Biographie geprägt, also durch die Beziehungsqualität in Kindheit und Jugend, im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter. Je nachdem, ob die gemeinsame Vergangenheit mehr durch Zuneigung oder mehr durch Spannungen gekennzeichnet war, sind die gegenwärtigen Beziehungen nun eher harmonisch oder eher konfliktreich.
In manchen Fällen nehmen die Erwachsenen ein verwitwetes Elternteil in ihre Familie auf. Oft gelingt es ihnen, diese Person ohne größere Probleme zu integrieren; bisweilen kommt es aber auch zu Konflikten, zur Belastung der Partnerschaft und eventuell sogar zur Zerrüttung der eigenen Familie. Ist dieser Elternteil pflegebedürftig, dann können die großen körperlichen und physischen Anforderungen vielfach zu einer Überlastung der Familienmitglieder führen, die aufgrund ihres Alters, ihrer abnehmenden Kraft und gesundheitlichen Probleme nun häufiger an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. Dieses gilt insbesondere für solche Erwachsene, die zwei älteren Generationen und eventuell sogar noch ihren Kindern und deren Familien helfen müssen. Im Normalfall sind aber die Belastungen in dieser Phase des Familienzyklus am geringsten.
Familie im Alter
Die letzte Phase des Familienzyklus dauert etwa 10 Jahre. Sie beginnt mit der Pensionierung und endet mit dem Tod eines Ehepartners. Die meisten Arbeitnehmer setzen sich heute kurz nach ihrem 60. Lebensjahr zur Ruhe; schon 1982 arbeiteten nur noch etwa 10% der Arbeitnehmer bis zu ihrem 65. Lebensjahr (Familienwissenschaftliche Forschungsstelle 1985). Aus diesem Grunde, aber auch wegen der gestiegenen Lebenserwartung, wird die Phase des Ruhestandes immer länger.
Oft wird die Pensionierung als Schock erlebt: Vor allem Männer erfahren einen großen Verlust an Status und Autorität, entwickeln negative Selbstwertgefühle und halten sich für nutzlos und überflüssig. In vielen Fällen dauert es recht lange, bis sie die Rolle eines Rentners akzeptieren und in ihr Selbstbild integrieren. Da die Partner nun den größten Teil des Tages miteinander verbringen, gilt plötzlich der übliche Tagesablauf nicht mehr, werden eingespielte Interaktionsmuster, alte Beziehungsdefinitionen und eine seit langem praktizierte Arbeitsteilung in Frage gestellt. So müssen die Partner lernen, die gemeinsam verbrachte Zeit harmonisch, befriedigend und abwechslungsreich zu gestalten. Dazu müssen sie ihre Beziehung umdefinieren, einen gemeinsamen Lebenssinn finden, Rollen verändern und neue Aufgaben, Hobbys und Betätigungsfelder suchen.
Während in vielen Fällen die Frau weiterhin für die Haushaltsführung zuständig bleibt, kommt es in anderen zu einer Angleichung der Rollen und einer Umverteilung der im Haushalt anfallenden Arbeiten. Da die Männer nach der Pensionierung in den "Herrschaftsbereich" ihrer Frauen kommen, bildet sich in manchen Fällen ein "Altersmatriarchat" aus, während sie in anderen ihre Machtposition wahren können. Auch schreitet die durch gesellschaftliche, moralische und religiöse Normen bedingte Entsexualisierung der Ehebeziehung rasch fort, die schon in der vorausgegangenen Phase eingeleitet wurde. So wird alten Menschen unterstellt, dass sie kein sexuelles Interesse und keine Anziehungskraft mehr hätten, werden Zeichen der Zuneigung und Intimität von jüngeren Menschen oft missbilligt. Dementsprechend leiden manche Ehepartner an der fehlenden Möglichkeit, ihre (sexuellen) Empfindungen und Gefühle füreinander auf angemessene Weise auszudrücken.
Vielen alten Menschen gelingt es recht gut, ihren Tag auf interessante und zufrieden stellende Weise auszugestalten. Andere leiden hingegen stark unter Langeweile und der Ungegliedertheit des Tages- und Wochenablaufs. Sie verbringen viel Zeit vor dem Fernseher und zeigen nur wenig Interesse an anderen Aktivitäten. Die Ehepartner müssen sich auch mit dem sich rasch ändernden Erscheinungsbild und dem Verlust an körperlicher und geistiger Tüchtigkeit abfinden - mit einer Entwicklung, die von ihnen zumeist negativ bewertet wird, ihr Selbstwertempfinden verschlechtert und zu vielen Einschränkungen führt. Oft wird eine Person pflegebedürftig und ist auf die Versorgung durch ihren Partner oder andere Familienmitglieder angewiesen. Das Bewusstsein des nahenden Todes mag in solchen Fällen zu Angst und Verzweiflung führen, sofern er nicht gänzlich verdrängt und verleugnet wird.
Mit zunehmendem Alter und abnehmender Beweglichkeit sind die Ehegatten mehr und mehr an ihre Wohnung gebunden. Sie ziehen eine selbständige Haushaltsführung so lange wie möglich anderen Arrangements vor, da diese ihre Unabhängigkeit garantiert, ihr Selbstbewusstsein stärkt und ihre Kompetenzen erhält. Oft müssen sie einen Rückgang in ihrem Lebensstandard in Kauf nehmen, da ihr Einkommen sehr viel niedriger als in der vorausgegangenen Phase des Familienzyklus ist. So lag Anfang 1988 die durchschnittliche Rente in der Rentenversicherung der Arbeiter bei 1.314DM für Männer und 498DM für Frauen, während sie in der Angestelltenversicherung l.800DM für Männer und 864DM für Frauen betrug.
Besonders schlecht ist die finanzielle Lage verwitweter Frauen, die nicht erwerbstätig waren. So betrug die "große" Witwenrente Anfang 1988 1.050DM in der Angestelltenversicherung und 752DM in der Rentenversicherung der Arbeiter (Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1989). Aufgrund der niedrigen Rente sind viele alte Menschen auf Sozialhilfe angewiesen: Im Jahr 1987 hatten knapp 15% der Haushalte von Sozialhilfeempfängern einen Haushaltsvorstand im Alter von 65 Jahren und mehr (Statistisches Bundesamt 1989).
In der Regel nimmt die Zahl sozialer Kontakte mit zunehmendem Alter ab, da alte Menschen meistens weniger kontaktfreudig sind und im Verlauf der Zeit immer mehr gleichaltrige Freunde und Verwandte sterben. So fühlen sich laut dem Vierten Familienbericht (Bundesregierung 1986a) etwa 34% der Frauen und 19% der Männer im Alter einsam. Während ein Schwinden des Freundes- und Bekanntenkreises vielfach akzeptiert wird, ist es für alte Menschen besonders belastend, wenn ihre Kinder und Enkel sie zum Beispiel aufgrund weit entfernter Wohnorte nur selten besuchen oder nur wenig Zeit für sie haben. Ihr Wunsch nach engeren Verwandtschaftskontakten ist dann besonders stark, wenn sie in einer gestörten Partnerbeziehung leben, wenig Interessen haben, hilfsbedürftig sind oder wenig Freunde und Bekannte haben. In den meisten Fällen haben alte Menschen aber noch enge Beziehungen zu Verwandten und Freunden, stehen in intensiver Kommunikation mit ihnen und tauschen eine Vielzahl von Leistungen mit ihnen aus - wobei sie nur zum kleineren Teil die Empfangenden sind: Sie geben viel, indem sie zum Beispiel Enkel beaufsichtigen, Geld und Sachwerte schenken, bei Notlagen einspringen und eventuell sogar eine laufende Hilfe zum Unterhalt der Familien ihrer Kinder leisten. Generell haben etwa zwei Drittel der über 65-jährigen regelmäßigen Kontakt zu Verwandten (Familienwissenschaftliche Forschungsstelle 1985). Dabei ist die Beziehung zu den Familien der Töchter meist intensiver als die zu den Familien der Söhne, engagieren sich Großmütter mehr als Großväter. In der Regel wird von allen Seiten aber kein zu enger Kontakt gewünscht: "Intimität auf Abstand" gilt als beste Beziehungsdefinition. Alte Menschen fühlen sich besonders wohl, wenn zu harmonischen Verwandtschaftsbeziehungen viele Kontakte zu Freunden und Bekannten hinzukommen.
Spätestens in dieser Phase des Familienzyklus übernehmen alte Menschen die Großelternrolle. Diese ist nicht klar definiert und ist nicht mit konkreten Verhaltensanforderungen verknüpft. So kann sie auf vielerlei Weise ausgeübt werden: Manche Großeltern wollen mit ihren Enkelkindern zusammen sein, mit ihnen spielen und viel Spaß erleben, während andere sich von ihnen eher distanzieren. Einige fungieren als Ersatzeltern, während andere sich mit der Rolle des weisen Ratgebers zufrieden geben oder aber wenig Anteil an dem Leben ihrer Enkel nehmen. Ein knappes Drittel der älteren Frauen übernimmt oft ihre Betreuung (Bundesregierung 1986a) - wobei sich besonders solche Großmütter engagieren, die nur eine geringe Schulbildung erhielten, nicht erwerbstätig waren oder nur wenige Freunde und Bekannte haben. Manchmal verbünden sich Großeltern mit ihren Enkeln und vermitteln zum Beispiel bei Konflikten mit den Eltern. Meist nimmt die affektive Distanz zwischen Großeltern und Enkeln immer mehr zu, wenn Letztere älter werden. Hier wirkt sich aus, dass alle drei Generationen verschiedene Lebensstile, Interessen, Moralvorstellungen und Erfahrungen haben, dass sich die Großeltern zumeist den herrschenden Werten und Einstellungen entfremdet haben und ihr Wissen als veraltert gilt. Diese mögen aber weiterhin die Beziehung zu ihren Enkeln als persönliche Bereicherung erleben und auf deren schulische und berufliche Erfolge stolz sein.
Nach dem Tode des einen Ehepartners - zumeist des Mannes, da die Lebenserwartung der Frau rund sieben Jahre höher ist - muss der andere Gefühle der Trauer verarbeiten, sich umorientieren und lernen, alleine zu leben. Manchmal erweist er sich als unfähig, die vom Gatten ausgeführten Aufgaben zu übernehmen. Oft fühlt er sich einsam und isoliert, mangelt es ihm an Lebenssinn, wird er inaktiv. Vor allem Männer heiraten in dieser Situation wieder - generell wohnen noch 60% der über 75-jährigen Männer, aber nur 16% der gleichaltrigen Frauen in Zweipersonenhaushalten (Schwarz/Höhn 1985).
Viele alte Menschen ziehen nach dem Tod ihres Partners oder einige Zeit später zu ihren Kindern. So lebten zum Beispiel 1982 in Bayern knapp 20% der Personen über 65 Jahren bei ihren Kindern - und nur etwa 5% im Heim (Grunddaten zur Situation älterer Menschen in Bayern 1984). Generell umfassen aber nur noch 2% aller Haushalte drei oder mehr Generationen (Bundesregierung 1986a). Meist fühlen sich ältere Menschen, die bei ihren Töchtern wohnen, wohler als solche, die in der Familie ihrer Söhne leben. Oft haben sie einen positiven Einfluss auf deren Familienleben und entlasten ihre Kinder, indem sie sich zum Beispiel intensiv um ihre Enkel kümmern oder Aufgaben im Haus beziehungsweise Garten übernehmen. In anderen Fällen kann ihre Anwesenheit aber auch eine große Belastung sein und zu vielen Konflikten führen.
Die Umwelt der Familie
Die ökologische Sozialisationsforschung untersucht die individuelle Entwicklung in alltäglichen Umwelten, die sich sinnbildlich hinsichtlich der Stärke ihres Einflusses als konzentrische Kreise darstellen lassen. Dabei werden räumlich-dinghafte Gegebenheiten sowie Kontakte zu anderen Menschen und Institutionen (zum Beispiel Produktionsstätten, Dienstleistungsbetriebe, Schule, Verwaltung) berücksichtigt. Familien, aber auch die einzelnen Familienmitglieder, leben in verschiedenen Umwelten mit einer räumlich-zeitlichen Abgrenzung, in denen sie unterschiedliche Erfahrungen machen, sich aufgrund bestimmter Lebensbedingungen, Anforderungen, Erwartungen und Normen andersartig verhalten, besondere Kompetenzen entwickeln und charakteristische Beziehungen eingehen. Dieses wird deutlich, wenn wir uns zum Beispiel das Leben von Familienmitgliedern im brasilianischen Urwald oder in einem grönländischen Fischerdorf, in einer kleinen Gemeinde in der Eifel oder in einer Münchner Obdachlosensiedlung, in einer landwirtschaftlich geprägten oder in einer hoch industrialisierten Gesellschaft, in einer Diktatur oder in einer Demokratie vorstellen. Die ökologische Sozialisationsforschung verdeutlicht somit, dass der Lebenskontext als Erfahrungs- und Lernumfeld für die Entwicklung von Kindern und Erwachsenen sehr bedeutsam ist.
Jedoch reagieren Familienmitglieder nicht nur auf die jeweiligen Umweltbedingungen und passen sich ihnen an, sondern setzen sich auch mit ihnen auseinander und prägen sie. So nehmen sie nur bestimmte Umweltaspekte wahr (subjektive Perspektiven), verarbeiten sie entsprechend ihrer bisherigen Erfahrungen und Deutungsmuster, geben ihnen einen Sinn und einen symbolischen Bedeutungsgehalt. Letztlich konstituieren sie ihre Lebenswelt erst durch ihre Interpretationen, in der täglichen Auseinandersetzung mit ihr und in ihren Interaktionen - Überformen sie also sozial beziehungsweise soziokulturell. Dann handeln sie auf der Grundlage dieser Interpretationen, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit zu höchst unterschiedlichen Reaktionen unter gleichen "objektiven" Umweltbedingungen führen können. Als aktive Organismen wählen Familienmitglieder aber auch bestimmte Lebensfelder selbst aus, wobei sie die in ihnen wahrgenommenen Anforderungen und Möglichkeiten subjektiv gewichten und dadurch unterschiedlich große Spielräume für die eigene Lebens- und Umweltgestaltung gewinnen. So besitzen sie eine relative Autonomie gegenüber ihrer Lebenswelt.
Die Umwelt der Familie besteht aus unterschiedlich komplexen Systemen und Teilordnungen. Am umfassendsten sind die wirtschaftlichen, technischen, politischen, kulturellen und natürlichen Systeme. Ihre Bedeutung und ihr Einfluss wird den einzelnen Familienmitgliedern nur selten bewusst. Auffallend ist jedoch der Widerspruch zwischen der in diesen Systemen vorherrschenden Sachlichkeit und Rationalität sowie der Privatheit und Emotionalisierung der Familie. Weniger komplex sind die Institutionen, zu denen Bildungseinrichtungen, soziale Dienste, Unternehmungen, Geschäfte und Verwaltungen, Versicherungen und Banken, Gerichte, Krankenhäuser, Kirchen, usw. gehören. Diese Teilsysteme haben sich im Verlauf der historischen Entwicklung ausdifferenziert, bleiben aber miteinander verflochten und sind somit nur relativ autonom. Sie haben bestimmte Funktionen wie zum Beispiel die Bildung der jungen Generation oder den Schutz der sozialen und politischen Ordnung übernommen. Sie entlasten die Familienmitglieder, indem sie diese mit Gütern und Dienstleistungen versorgen, auf diese Weise grundlegende Bedürfnisse befriedigen und für sie die Welt überschaubar und voraussagbar machen. Zugleich prägen sie aber auch deren Denken und Verhalten, legen ihnen gewisse Zwänge auf, stellen an sie bestimmte Anforderungen. Dabei ist ihr Einfluss davon abhängig, wie stark die Grenzen der Familie sind und wie intensiv der Kontakt der Familienmitglieder mit ihnen ist. Besonders einflussreich sind natürlich Institutionen wie Kindergarten und Schule, in denen Personen viele Jahre lang leben und bestimmten Rollen, Interaktionsmustern, Beziehungsdefinitionen und Regeln unterliegen. Da Familienmitglieder zumeist in verschiedenen Institutionen tätig sind, werden sie unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen und Einflüssen ausgesetzt. Insofern sie ihre Erfahrungen in die Familie einbringen, lassen sie die anderen an ihnen teilhaben. Ansonsten besteht die Gefahr einer Auseinanderentwicklung.
Das Netzwerk
Als Netzwerk bezeichnet man das vollständige Beziehungsfeld eines Menschen. Es hat eine räumliche und zeitliche Ausdehnung und umfasst informelle und formelle Beziehungen zu Verwandten, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, Vertretern verschiedener Institutionen usw., wobei die Kontakte mehr oder weniger intensiv beziehungsweise persönlich sein können. Auch lassen sich nach der Art der Beziehungen ein Unterstützungsnetz, ein Netz der Alltagskontakte und ein Geselligkeitsnetz unterscheiden, wobei es zwischen diesen selbstverständlich Überschneidungen gibt. Netzwerke zeichnen sich durch einen hohen Informationsfluss und wenig Regeln aus. In ihnen werden Werte, Einstellungen, Interessen und Modelle zur Interpretation gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Vorgänge vermittelt. Auch hat das Netzwerk einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und das Selbstbild einer Person sowie auf die Funktionsfähigkeit und den Zusammenhalt einer Familie - je nachdem, wie viel Unterstützung, Bedürfnisbefriedigung, Bestätigung und Spielraum für die eigene Selbstverwirklichung es bietet. Meist sind die Beziehungen hinsichtlich von Geben und Nehmen ausgeglichen.
Eine im Jahr 1984 vom Deutschen Jugendinstitut (München) in Zusammenarbeit mit GETAS durchgeführte nichtrepräsentative Befragung (Marbach 1987; Marbach et al. 1987) von 2.638 Personen ergab folgendes Bild: Weniger als 1% der Befragten waren vollkommen isoliert, weitere 2,5% entweder ohne Unterstützung oder ohne tägliche Kontakte. In den übrigen Fällen war das Netzwerk gut ausgebaut und umfasste durchschnittlich 25 Personen, wobei auf einen Verwandten knapp sechs Nichtverwandte kamen. Etwa 11 Personen standen für gesellige Anlässe zur Verfügung, sieben würden im Notfall um Unterstützung gebeten.
Generell war das Netzwerk bei Personen aus unteren Schichten, bei Familien mit drei und mehr Kindern sowie bei Alleinerziehenden kleiner, während es bei finanziell gut gestellten Personen, bei Familien mit vielen Verwandten, bei berufstätigen Müttern und bei starker Belastung durch Krankheit oder Stress größer als im Durchschnitt war. Personen mit niedrigem Einkommen hatten in ihrem Kontaktnetz weniger Bekannte und in ihrem Unterstützungsnetz weniger private Helfer als Mittelschichtangehörige (aber mehr Verwandte und Mitarbeiter sozialer Dienste) und unterlagen einer stärkeren sozialen Kontrolle.
Eine wichtige Funktion von Netzwerkmitgliedern für Familien ist die Betreuung von Kindern. So hatten nach einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) 30% der Befragten mit Kindern unter acht Jahren jederzeit und weitere 43% meistens einen Betreuer für ihre Kinder, falls sie weggehen müssen. Nach anderen Umfragen (Fauser 1982) übernahmen in 42% der Fälle die Großeltern, in 17% Nachbarn oder Bekannte und in 9% Verwandte die Beaufsichtigung der Kinder bei einer kurzzeitigen Abwesenheit der Mutter; bei längerfristigen kann in 80% der Fälle auf die Hilfe von Verwandten zurückgegriffen werden. So überrascht nicht, dass Familien in der Regel mehr Verwandte in ihrem engeren sozialen Netz haben als Haushalte ohne Kinder.
Netzwerkmitglieder übernehmen aber noch andere Aufgaben. So hatten jeweils rund 30% der Befragten laut einer repräsentativen Umfrage (Statistisches Bundesamt 1985) in ihrem Netzwerk Personen, die ihnen entweder bei Reparaturen im Haushalt oder am Auto, bei Maurer- oder Schneiderarbeiten, in rechtlichen oder Steuerfragen helfen können. Mehr als die Hälfte dieser Personen hatten von den genannten Unterstützungsmöglichkeiten bereits Gebrauch gemacht. Auch hatten 76% der befragten Männer und 82% der Frauen in ihrem Netzwerk einen Vertrauten, mit dem sie alles besprechen und bei dem sie Rat holen können (Institut für Demoskopie Allensbach 1983b). Bei einer im Jahr 1984 durchgeführten repräsentativen Umfrage (Statistisches Bundesamt 1985) berichteten nur wenige Befragte, dass sie zu wenig Hilfe von Verwandten (circa 14%), Freunden und Bekannten (etwa 9%) oder Nachbarn (knapp 3%) erhalten.
Innerhalb des Netzwerks kommt dem aus Verwandten bestehenden Subsystem eine besondere Bedeutung zu. Es umfasst einerseits immer häufiger vier Generationen, andererseits aber immer weniger Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen. Nur für diesen Teil des Netzwerks gibt es gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel Eheverbote, Unterhaltspflichten und Erbrechte. Auch sind Verwandte vorgegeben - sie werden nicht aus freiem Willen oder aus Sympathie gewählt. Generell sind jedoch die Bindungen an Verwandte besonders stark und werden durch intensive Gefühle, gleiche Werte, ähnliche Rituale, gemeinsame Feste sowie die Zugehörigkeit zu derselben Subkultur und Schicht aufrechterhalten. Auch ist der Einfluss der Ursprungsfamilien und anderer Verwandten auf die Zeugungsfamilie sehr groß und bestimmt Kommunikationsinhalte, Rollenausübung, Funktionserfüllung, Einstellungen usw. mit.
Die Häufigkeit persönlicher Kontakte von Erwachsenen zu ihren Eltern wurde bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Befragung (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) erfasst: 17% der Erwachsenen, deren Eltern nicht im Haushalt leben, sahen sie täglich oder fast täglich, 29% ein- oder zweimal in der Woche, 23% ein- oder zweimal im Monat, 23% ein paar mal im Jahr und 8% seltener oder nie. 41% der Befragten hatten gleich viel Kontakt zu beiden Herkunftsfamilien, 36% einen größeren zur eigenen Familie und 17% zur Familie des Partners - wobei berufstätige Frauen einen intensiveren Kontakt zu ihren Ursprungsfamilien hatten, da sie häufiger auf deren Unterstützung (zum Beispiel bei der Kinderbetreuung) angewiesen waren. Generell nannten Erwachsene sehr viel seltener ihre Väter als ihre Mütter als bevorzugte Gesprächspartner, wobei diese Tendenz bei Frauen besonders stark ausgeprägt war (Institut für Demoskopie Allensbach 1983b). Ansonsten wurden Verwandte außerhalb der engeren Familie als Gesprächspartner bevorzugt, wenn sie dasselbe Geschlecht wie die Befragten hatten. Generell hatten junge Ehen und junge Familien, Unterschichtfamilien, Familien auf dem Land, Familien mit berufstätigen Müttern und (erwerbstätige) Alleinerziehende besonders viele Verwandtenkontakte. Bei älteren Menschen nahm zumeist die erweiterte Familie an Bedeutung zu; nur etwa 16% hatten kaum Kontakt zu Familienangehörigen (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b).
Die ältere Generation ist also nicht isoliert. Allerdings bedeuten die guten Verwandtschaftskontakte zum Beispiel nicht, dass Erwachsene mit ihren Eltern zusammenleben wollen - nur rund 4% der Befragten bevorzugten diese Wohnform. Die meisten zogen getrennte Wohnungen im gleichen Ort beziehungsweise Stadtteil (55%) oder in demselben Haus (28%) vor. Verheiratete und unverheiratete Erwachsene erfahren in vielfältiger Weise die Unterstützung ihrer Eltern. So nannten Befragte bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage viele unterschiedliche Hilfen, die sie von ihren Eltern oder Schwiegereltern erhalten haben. Deutlich wird, dass in verschiedenen Phasen des Lebens- beziehungsweise des Familienzyklus unterschiedliche Hilfsmaßnahmen der Elterngeneration im Vordergrund stehen. Natürlich unterstützt auch die mittlere Generation die ältere und hilft ihr bei Notlagen. Generell kann man also von einem intakten Verwandtschaftssystem sprechen, das eine Vielzahl von Funktionen für den Einzelnen übernimmt. Natürlich kann es auch einen negativen Einfluss auf eine Familie haben.
Eine große Rolle spielt das aus Freunden und Bekannten bestehende Subsystem des Netzwerks. So ist zum Beispiel die Lebenszufriedenheit auch von der Zahl der Freunde abhängig, da sie dialoghafte Aussprachen ermöglichen, Unterstützung bei Problemen bieten, für gemeinsame Aktivitäten und die Pflege von Hobbys zur Verfügung stehen und die eigene Weiterentwicklung fördern. In der Kindheit erlaubt der Freundeskreis ein selbständiges Erforschen der Umwelt, die Entwicklung von Interessen und sozialen Kompetenzen und die Übernahme der Geschlechtsrolle. In der Jugend fördert er die Ablösung von den Eltern und die Selbstfindung, ermöglicht das Eingehen heterosexueller Beziehungen und die Partnerwahl. Im Erwachsenenalter ist er weiterhin für die Freizeitgestaltung von Bedeutung und bietet Rat, emotionale Unterstützung und praktische Hilfe.
Generell werden vier bis fünf Personen als enge Freunde bezeichnet, wobei der "beste Freund" in der Regel gleichgeschlechtlich ist (Statistisches Bundesamt l985, 1987a). Sie spielen als Ratgeber in schwierigen Situationen eine in etwa gleich große Rolle wie die Eltern von Erwachsenen. Freunde und Bekannte stammen vor allem aus der eigenen Kindheit und Schulzeit oder wurden am Arbeitsplatz, bei geselligen Anlässen, im Verein oder in der Nachbarschaft kennen gelernt. Der Kontakt mit ihnen ist bei Mittelschichtangehörigen, Alleinerziehenden und Müttern mit Kindergartenkindern besonders intensiv. Im Gegensatz zu früher treffen sich Familienangehörige mit ihren Freunden und Bekannten heute häufiger in der Wohnung oder in Lokalen und seltener auf Spaziergängen oder in Parks.
Die Kontakte zu Nachbarn sind in der Regel relativ schwach ausgeprägt. So unterhielten sich laut einer repräsentativen Befragung (Institut für Demoskopie Allensbach 1983b) wohl 74% der Erwachsenen mit ihren Nachbarn, nahmen 60% für sie Nachrichten an und gratulierten 55% bei Familienfesten oder nahmen an Beerdigungen teil - aber nur 35% luden Nachbarn zu sich ein, 25% erledigten für sie Einkäufe, 19% passten auf ihre Kinder auf und 8% gingen mit ihnen gemeinsam in die Kirche. Generell wächst die Einbindung in die Nachbarschaft mit zunehmendem Alter.
Familie in verschiedenen Soziotopen
Eine Richtung der Familienforschung beschäftigt sich vor allem mit Soziotopen - ein Begriff, der abgegrenzte Lebensräume unter dem Gesichtspunkt ihrer natürlichen, baulichen, sachlichen und sozialen Bestandteile bezeichnet. Das jeweilige Soziotop wird von dem einzelnen Familienmitglied handelnd erschlossen, gedeutet, genutzt und verändert. Aber es wirkt sich auch auf dessen Entwicklung und Sozialisation aus. So macht es einen großen Unterschied, ob ein Individuum auf dem Land, in einer Kleinstadt oder einer Großstadt aufwächst. Ja, man muss sogar noch genauer differenzieren: Soziotope wie Arbeiter-, Kleinbürger- oder Villenviertel, wie Trabantenstädte, verstädterte Wohndörfer, stadtnah gelegene Landgemeinden oder Streusiedlungen bieten verschiedene Entwicklungsbedingungen, Lernmöglichkeiten, Erfahrungsbereiche, Herausforderungen und Belastungen. Oft sind die Unterschiede zwischen Familien, die in andersartigen Soziotopen leben, größer als die zwischen Unterschicht- und Mittelschichtfamilien. Bei den meisten Unterschieden handelt es sich aber um schwach ausgeprägte Tendenzen.
Vor allem in größeren Städten hat in den vergangenen Jahrzehnten eine funktionale Entmischung von Wohn- und Gewerbegebieten stattgefunden, wobei viele Betriebe in das Umland abwanderten. Auch entstanden Stadtrandsiedlungen, Wohndörfer und Trabantensiedlungen, da die zunehmende Motorisierung eine immer größer werdende Wahlfreiheit bei der Entscheidung über den Wohnort gewährleistet und längere Anfahrtswege zum Arbeitsplatz oder zu Geschäften zulässt. Diese Soziotope unterscheiden sich von innerstädtischen und Altbauvierteln hinsichtlich der Wohnungsgröße und -ausstattung, der Miethöhe und des Vorhandenseins von Geschäften, Ämtern, Versorgungs- und Bildungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Grünflächen - Angebote, die von den einzelnen Familien und ihren Mitgliedern jedoch in höchst unterschiedlichem Ausmaße genutzt werden. Je nach Nutzung sind unterschiedliche Auswirkungen auf Lebenslage und Familienleben festzustellen. Generell bieten städtische Soziotope einen differenzierteren Arbeitsmarkt als ländliche Gemeinden, der auch eine größere Frauen- und Müttererwerbstätigkeit ermöglicht. So überrascht nicht, dass in Städten Frauen seltener heiraten oder sich eher scheiden lassen. Beispielsweise hatten 1988 in Hamburg bis zum Alter von 30 bis 34 Jahren 65% aller Frauen geheiratet; in Rheinland-Pfalz und im Saarland waren es aber 92%. Auch lebten in Hamburg nur 53% der 30- bis 40-jährigen Frauen mit ihrem Ehemann zusammen, im Saarland jedoch 83%.
In städtischen Soziotopen gibt es vielfältigere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, ein größeres kulturelles und Freizeitangebot sowie mehr soziale Einrichtungen wie Kindergärten, Horte oder Beratungsstellen - obwohl es dort weniger Kinder gibt: "Städte wie München, aber auch Regensburg oder Würzburg, haben einen Anteil von 0- bis 6-jährigen Kindern an der Gesamtbevölkerung von 4 bis 5%, während Landkreise, wie Bamberg oder Eichstätt, einen Anteil von 0-bis 6-jährigen von 8% und mehr aufweisen" (Bertram 1990: 16). In Hamburg kamen 1988 auf 100 Frauen im Alter von 35 bis 39 Jahren 103 Kinder, in Baden-Württemberg waren es jedoch 162 und in Niedersachsen 160. So ist in Städten die Haushaltsgröße im Durchschnitt kleiner, müssen Familien verstärkt mit kinderlosen Allein- oder Doppelverdienern auf dem Wohnungsmarkt konkurrieren und dementsprechend höhere Mieten zahlen. Die geringe Kinderzahl in Großstadtfamilien erklärt auch, wieso die Wohnumwelt wenig kindgemäß gestaltet wird.
In städtischen Soziotopen leben Großeltern und andere Verwandte meist relativ weit entfernt. Dieses gilt vor allem für verstädterte Wohndörfer und reiche Stadtviertel. So haben Städter generell mehr Kontakt zu Bekannten und Nachbarn, wobei insbesondere Hauseigentümer und Gartenbesitzer Nachbarschaftskontakte pflegen, während Bewohner von Industriearbeiter- und Kleinbürgervierteln seltener Gespräche mit Nachbarn oder auf der Straße führen. Dementsprechend werden in Stadtrandgebieten mit überwiegend freifinanziertem Wohnungsbau die Chancen besser beurteilt, andere Menschen kennen zu lernen. Viele Stadtbewohner berichten aber auch von Problemen mit Nachbarn, Vermietern oder Hausmeistern; dieses gilt zum Beispiel für knapp 20% der von dem Sozialreferat der Landeshauptstadt München (1981) befragten Familien mit Kindern. In der Stadt übernehmen Bekannte häufiger die Kinderbetreuung als auf dem Land; in Kleinbürger- und reichen Vierteln sowie in verstädterten Wohndörfern rangieren sie sogar vor den Verwandten. Auch initiierten die Kinder in größeren Städten mehr Bekanntenbeziehungen für ihre Eltern als auf dem Land.
In der Stadt spielen Kinder häufiger und länger in den Wohnungen. Aber gerade dort sind diese schlechter zum Spielen geeignet als auf dem Land, da sie kleiner sind. Für Kleinkinder ist ein selbständiger Aufenthalt im Freien nur dann möglich, wenn die Eltern einen eigenen überschaubaren Garten haben, was zumeist nur in Stadtrandgebieten mit freifinanziertem Wohnungsbau und in reichen Vierteln der Fall ist. In anderen Stadtteilen sind die Spielmöglichkeiten oft sehr beschränkt, da es vielfach an Spielplätzen, Grünanlagen und Freizeitflächen im näheren Umkreis der Wohnungen mangelt und Freiflächen zwischen mehrgeschossigen Wohnungsbauten eher als Abstandsflächen denn als Spielbereiche dienen. Wohl sind heute Spielplätze annähernd gleich über alle Stadtteile verteilt, werden aber überwiegend von älteren Kindern abgelehnt, da sie häufig mangelhaft ausgestattet sind, monoton wirken und wenig Gruppenaktivitäten gestatten. So sind kleinere Kinder in Innenstadtgebieten sowie in alten Arbeiter- und kleinbürgerlichen Vierteln die meiste Zeit an die Wohnung gebunden, da sie auf der Straße und auf weiter entfernten Freizeitflächen aufgrund der Verkehrsgefährdung nicht alleine spielen dürfen. Ältere Kinder (männlichen Geschlechts) halten sich jedoch relativ häufig auf der Straße auf, da diese für sie Treffpunkt, Kommunikations- und Erfahrungsraum ist. Dementsprechend wird die Straße oft zum Ort eigenständiger Kinder-Subkulturen. Jugendliche in der Stadt unternehmen nachmittags und abends mehr als solche auf dem Land. So gehen sie häufiger in Lokale, Kinos, Theatervorführungen und Konzerte. Auch interessieren sie sich mehr für Politik.
In größeren Städten, insbesondere in neuen Vierteln, bieten sich Kindern weniger Möglichkeiten für Primärerfahrungen als auf dem Land und in kleineren Gemeinden. Beispielsweise liegen viele Erfahrungsräume wie kleinere Geschäfte, Märkte, Wälder usw. nicht mehr wohnungsnah. Auch erleben viele Kinder Erwachsene nicht mehr in ihrer Rolle als Erwerbstätige, sind sie von der Arbeitswelt ausgeschlossen. Ferner bieten sich ihnen weniger Gelegenheiten für Abenteuer und zur Selbstbewährung, mangelt es ihnen an elementaren Naturerfahrungen. Jedoch verläuft die intellektuelle Entwicklung von Stadtkindern besser; sie sind auf der Schule erfolgreicher und erzielen höhere Bildungsabschlüsse. Dieses liegt aber zum Teil daran, dass in der Stadt obere und mittlere Statusgruppen mit entsprechenden Erziehungszielen überrepräsentiert sind und das Bildungsangebot umfangreicher ist. Auch wurde festgestellt, dass mehr Arbeitereltern in Kleinstädten und in Kleinbürgervierteln (von Großstädten) höhere Schulabschlüsse für ihre Kinder anzielen als solche auf dem Land oder in Arbeitervierteln. Hier zeigt sich, dass Unterschichtfamilien in schichtheterogenen Stadtvierteln von dem anregungsreichen sozialökologischen Umfeld profitieren, sich also mehr an Mittelschichtfamilien orientieren, in ihrer Erziehung weniger restriktiv sind, sich mehr in Kindergarten und Schule engagieren sowie ihr Netzwerk stärker ausbauen. So wird deutlich, dass die Separierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Stadtvierteln nicht nur Nährboden für soziale Konflikte sein kann, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitglieder von Unterschichtfamilien und Randgruppen begrenzt.
Auf dem Land arbeiten weniger Erwachsene als Angestellte oder Beamte und mehr als Selbständige. Auch sind mehr Frauen als mithelfende Familienangehörige beschäftigt. Viele von ihnen klagen über eine ständige Überlastung; zum Beispiel 54% der in der Landwirtschaft tätigen Frauen (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a). Familien, die auf dem Land wohnen, besitzen häufiger ein eigenes Haus, das zumeist sehr gut mit Haushaltsgeräten u. Ä. ausgestattet ist. Vor allem bei Landwirten gibt es noch relativ viele Dreigenerationenfamilien, werden Räume von Eltern und Großeltern gemeinsam benutzt oder wird nur ein Haushalt geführt, wenn diese in separaten Wohnungen (in demselben Haus oder benachbarten Gebäuden) leben. Generell sind Familien auf dem Land weniger bereit, die Großeltern in ein Altersheim zu schicken, und plädieren für ein näheres (aber möglichst räumlich getrenntes) Zusammenleben der Generationen. Auch beteiligen sie die Großeltern mehr an ihrem Familienleben, an der Kindererziehung und an Entscheidungen als Stadtfamilien. Außerdem berichten sie von weniger Spannungen.
Auf dem Land gibt es mehr und häufigere Kontakte zu Nachbarn und Verwandten - Letztere wohnen zumeist in der näheren Umgebung. Die meisten Gespräche mit Bekannten, Nachbarn und Verwandten werden aber in industrialisierten Landgemeinden geführt. Die Mitglieder von Landfamilien sind sportlich weniger aktiv als die Städter. Sie beschäftigen sich in ihrer Freizeit vielfach mit Garten- und Handarbeit, Basteln, Lesen, Fernsehen und Musikhören. Generell spielen Kirchen, Vereine und örtliche Feste eine große Rolle; der Gottesdienst wird von mehr Menschen regelmäßig besucht. Familien auf dem Land sind konservativer als Stadtfamilien, wobei Landwirte die konservativste Gruppe bilden. So tendieren sie zu traditionellen Geschlechtsrollendefinitionen und Erziehungszielen sowie zu geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung.
Ehepaare, die auf dem Land leben, zeugen das erste Kind zumeist früher nach der Hochzeit und erreichen eine höhere Kinderzahl. Vor allem Landwirte wünschen sich viele Kinder, da sie diese zum Beispiel noch oft als Hilfskräfte sehen und dementsprechend auf ihren Hof einsetzen (weniger Freizeit der Kinder, aber mehr Kontakt zum Vater). Landfamilien räumen Kindern seltener eine zentrale Stellung ein, verlangen von ihnen ein größeres Maß an Gehorsam, akzeptieren noch häufiger Körperstrafen und klären ihre Kinder später auf. Landwirte können zudem mehr Autorität beanspruchen, da die Kinder sie noch in ihrer Berufsrolle erleben und von ihnen angelernt werden. Auf dem Land dürfen sich Kinder draußen eher ohne Aufsicht aufhalten und freier bewegen. Jugendliche haben ein relativ positives Verhältnis zu ihren Eltern, berichten von weniger Konflikten und sprechen von weniger Bevormundung bei persönlichen Entscheidungen, hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung und bei der Berufswahl. Allerdings erhalten Kinder eine etwas schlechtere Schulbildung als in der Stadt, da weiterführende Schulen schlechter zu erreichen sind sowie Bildung und geistige Arbeit weniger geschätzt werden. Auch ist die Tendenz, Jungen eine bessere Schulbildung als Mädchen zukommen zu lassen, noch stärker ausgeprägt. Außerdem halten die Eltern oft weniger Kontakt zu Kindergarten und Schule.
Familie und Arbeitswelt
Nach einer Umfrage des BAT-Freizeit-Forschungsinstituts sind den Befragten Familie, Freunde, Freizeit und Bildung wichtiger als der Beruf; dieser folgt erst an fünfter Stelle (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.04.1986). Auch bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) gaben 73% der befragten Frauen und 54% der Männer, die vor der Wahl zwischen beruflicher Karriere und Familie standen, der Familie den Vorzug. Damit wird aber nicht der große Einfluss der Arbeitswelt auf den Einzelnen und die Familie verneint, obwohl dieser zumeist wenig bewusst ist.
Bei einer für den Freistaat Bayern repräsentativen Umfrage (Krombholz 1987) gaben 14% der Erwerbstätigen (18% der Frauen, 11% der Männer) an, dass der Beruf negative Auswirkungen auf das Familienleben habe. Sie klagten beispielsweise darüber, dass sie zu wenig daheim seien, unter Überarbeitung litten und zu wenig Zeit für die Familie hätten. Derartige Belastungen wurden vor allem von jüngeren Befragten, Personen mit höherer Bildung und überdurchschnittlichem Haushaltsnettoeinkommen sowie von Eltern mit mehreren Kindern genannt.
Negative Auswirkungen können insbesondere von Nacht-, Schicht- und Feiertagsarbeit ausgehen. So leisten etwa 13% der Erwerbstätigen Nachtarbeit; etwa 10% der berufstätigen Männer und 3% der Frauen leisten täglich und weitere 3 beziehungsweise 2% oft Schichtarbeit - was zumeist unausweichlich ist und vor allem Vollzeitbeschäftigte trifft (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 1984). Während bei Frühschichten viel Zeit für Familientätigkeiten am Nachmittag bleibt, lassen Spät- und Nachtschichten den Erwerbstätigen an den Rand der Familie rücken, schränken seine Sozialkontakte ein und verhindern viele regenerative Aktivitäten. Auch wird der Verhaltensspielraum von Kindern beschnitten - so müssen sie zum Beispiel still sein und dürfen keine Freunde einladen, wenn der von Schichtarbeit betroffene Elternteil am Nachmittag schläft.
Berufstätigkeit und Familie lassen sich hingegen bei gleitender Arbeitszeit am besten miteinander vereinbaren - rund 12% der abhängig Beschäftigten (13% bei Vollzeit- und 5% bei Teilzeitarbeit) können bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, was vor allem auf Beamte und Angestellte zutrifft, aber nur sehr selten auf Arbeiter. Ähnliches gilt auch für viele Erwerbstätige, die ihren Arbeitsplatz auf dem Wohngrundstück haben und somit von nichtberufstätigen Ehepartnern und Kindern jederzeit erreicht werden können. So arbeiteten 1980 etwa 10% der Väter und 18% der Mütter von Kindern unter 16 Jahren (ohne Landwirte) auf dem Wohngrundstück. Jedoch können aus dieser Situation auch ganz spezielle Probleme resultieren: Beispielsweise sind die Berufspflichten allgegenwärtig, kann es zur sozialen Isolierung kommen. Zudem handelt es sich in vielen dieser Fälle um Selbständige, die häufig beruflich überlastet sind und wenig Zeit für ihre Familie haben.
Berufstätige - nicht erwerbstätige Mütter
Von besonderer Bedeutung für das Familienleben ist auch, ob die erwerbstätigen Familienmitglieder mit ihrer Berufsarbeit zufrieden sind oder nicht, ob sie diese als produktiv, lohnend und befriedigend oder als langweilig, überlastend und hektisch beurteilen. Kehren sie erschöpft, gereizt, verärgert und gestresst nach Hause zurück, dann benötigen sie mehr Zeit für die Regeneration, sind für anspruchsvollere Freizeitaktivitäten weniger ansprechbar, erleben Hausarbeit und Kinderbetreuung als anstrengender, haben oft weniger Geduld mit ihren Kindern und reagieren bei Problemen und Konflikten häufiger aufbrausend und irrational. Auch mag sich ihre Stimmung negativ auf das Familienklima auswirken.
Jedoch gehen nicht nur Einflüsse von der Arbeitswelt auf den Einzelnen und die Familie aus, sondern sie verlaufen auch in entgegengesetzte Richtung. So bestimmen zum Beispiel Sozialisationserfahrungen und Persönlichkeitsstruktur die Berufswahl, das Verhalten am Arbeitsplatz und den Berufserfolg mit. Auch wirkt sich das Familienklima auf das berufliche Engagement aus. Beispielsweise wurde bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) festgestellt, dass 58% der Erwerbstätigen, die ihr Familienleben als sehr glücklich empfanden, sich in ihrem Beruf besonders einsetzten - ansonsten waren es nur 38%. Auch engagierten sich 60% der Befragten, welche die Interessen der Familie voranstellten, voll im Beruf und brachten für ihn Opfer. Hingegen setzten sich nur 46% der Berufstätigen ganz am Arbeitsplatz ein, die ihre eigenen Interessen an erster Stelle nannten.
Unter den vollerwerbstätigen Müttern sind Frauen mit Kleinkindern, Alleinerziehende und Ausländerinnen überrepräsentiert, während Mütter mit höheren Bildungsabschlüssen häufiger teilzeitbeschäftigt sind. Die zunehmende Zahl erwerbstätiger Frauen und Mütter lässt sich damit erklären, dass heute Frauen auf den Beruf hin sozialisiert werden und eine bessere Schul- und Berufsausbildung als früher erhalten. So nimmt die Erwerbstätigkeit einen dominierenden Platz in ihrem Bewusstsein ein. Zudem wird sie mit Emanzipation, Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein, Arbeitsfreude, Anregung, Kommunikation mit anderen und Anerkennung durch Dritte assoziiert. Dementsprechend nähern sich Frauen in ihren Einstellungen zum Beruf, ihren Karriereerwartungen und ihrer Arbeitsmotivation immer mehr den Männern an: Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (BiB-Mitteilungen 1985, Heft 6) sind den meisten jüngeren Frauen berufliche Ziele im Vergleich zu außerberuflichen genauso wichtig wie Männern, klassifizieren sie diese nach derselben Rangordnung, sind sie gleichermaßen an beruflicher Weiterbildung interessiert.
Nach einer für Baden-Württemberg repräsentativen Befragung (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) wollten 40% der erwerbstätigen (50% der ganztags beschäftigten) Frauen im Beruf etwas erreichen. Auch ist die Berufsfreude bei Frauen groß: 52% der erwerbstätigen Frauen fühlten sich durch ihre Arbeit voll und ganz befriedigt, 43% zum Teil und nur 4% überhaupt nicht, wobei die Zufriedenheit bei weiblichen Angestellten, Beamten und Selbständigen sehr viel größer als bei Arbeiterinnen war.
Generell wurde der Beruf positiver empfunden, wenn kein materieller Zwang zur Erwerbstätigkeit bestand und wenn bei verheirateten Frauen die Ehemänner mit seiner Ausübung einverstanden waren. Negativ wurden aber die gegenüber Männern bestehenden schlechteren Arbeitsmarkt- und Aufstiegschancen gesehen - jede vierte berufstätige Frau berichtete von Benachteiligungen gegenüber ihren männlichen Kollegen. Auch ist ihr Einkommen unterdurchschnittlich hoch. Dennoch würden nur etwa 10% der berufstätigen Frauen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wenn sie könnten (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b; Krombholz 1987).
Der Wunsch nach einer Statusveränderung ist bei nichtberufstätigen Frauen jedoch sehr viel stärker ausgeprägt. Laut einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) stellten 44% der nichterwerbstätigen Frauen (und sogar 63% der 20- bis 29-jährigen sowie 60% der 30- bis 39-jährigen) Überlegungen an, ob sie wieder eine Berufstätigkeit aufnehmen sollen - wobei dieser Wunsch bei Frauen mit einer besseren Ausbildung und mit nur wenigen Kindern sowie bei Städterinnen sehr viel stärker ausgeprägt war. Aber nur 3% rechneten mit einer unmittelbar bevorstehenden Rückkehr in die Arbeitswelt; weitere 10% hielten einen Wiedereinstieg innerhalb von zwei, drei Jahren für denkbar.
Der weitaus größere Teil der verheirateten erwerbstätigen Frauen hat die Berufstätigkeit aus familienbedingten Gründen unterbrochen. So hatten sie laut der vorgenannten Umfrage ihren Arbeitsplatz aufgegeben, weil sie ein Kind bekamen (65%), da ihre Kinder sie zu Hause brauchten (49%), weil ihnen ihr Familienleben wichtiger als der Beruf war (29%) oder wegen fehlender Kinderbetreuung (15%). Diese Entscheidung wird in der Regel von den anderen Familienmitgliedern mitgetragen. So sahen 76% ihrer Partner mehr Vor- als Nachteile im Berufsverzicht ihrer Ehefrauen; nur 5% nannten mehr Nachteile. Sie glaubten, dass es so für die Kinder besser sei (69%), die Familie ein gemütlicheres Zuhause habe (67%), der Haushalt immer in Ordnung sei (67%), sie selbst im Haushalt nicht mitarbeiten müssten (53%), sie mehr Zeit füreinander hätten (47%) und die Frau immer für sie da sei (40%). Auch fanden es 87% der Kinder und 70% der Jugendlichen mit nichterwerbstätigen Müttern gut, dass ihre Mutter zu Hause ist. Nur 2% der Kinder und 10% der Jugendlichen hielten es für besser, wenn sie berufstätig wäre.
Auch bei einer bundesweiten Umfrage (Erler et al. 1988) wurden vor allem familienorientierte Gründe für den Berufsausstieg angegeben; nur 29% nannten zugleich berufsbezogene Gründe. So kommentieren die Autoren: "Die jungen Paare haben eine hohe Wertschätzung für Kinder und möchten ihnen optimale Lebensmöglichkeiten eröffnen. Das Kind soll nicht nur materiell, sondern auch emotional die größtmögliche Zuwendung erhalten. Und dies ist nach Meinung der meisten jungen Frauen und Männer noch immer nicht möglich, wenn die Mutter berufstätig ist. Mütter in der Bundesrepublik Deutschland, junge Frauen in Paarbeziehungen insgesamt, sind mehrheitlich davon überzeugt, dass Kinder in den ersten Lebensjahren am besten von der eigenen Mutter versorgt werden sollten. Diese Ansicht wird durch die Partner verstärkt, die häufig nachdrücklich die Bedeutung der Mutter unterstreichen und ihre Berufsrückkehr oft mitverhindern" (S. 30). So rechneten nur 14% der Hausfrauen mit der Unterstützung ihres Partners, wollten sie (wieder) erwerbstätig werden. Für den Zeitraum, in dem Kinder klein sind, lebt also das Leitbild der "klassischen Versorgerehe" wieder auf: Über 80% der befragten jungen Frauen erwarteten, dass der Mann sie nach der Geburt eines Kindes finanziell versorgt; dies galt sogar für 95% der befragten nichtberufstätigen Mütter.
In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Familientätigkeit in der Öffentlichkeit stark abgewertet. So wird sie heute von der Gesellschaft wenig geschätzt, haben nichterwerbstätige Frauen einen niedrigen sozialen Status. Das hat zur Folge, dass vielen Frauen der Berufsverzicht sehr schwer fällt - er bedeutet für sie einen Verlust an Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, an finanzieller Unabhängigkeit und familialer Macht. Vielfach fühlen sie sich benachteiligt und entwickeln negative Selbstwertgefühle. Auch mangelt es manchen nichterwerbstätigen Frauen an sozialen Kontakten, leiden sie unter Langeweile. Viele haben das Gefühl, dass ihre Leistungen daheim zu wenig anerkannt werden. Manchmal machen nichterwerbstätige Mütter ihre Kinder für die eigene unbefriedigende Situation verantwortlich und erleben sie als Fesseln, sind deshalb ihnen gegenüber gereizt und behandeln sie ungerecht. In anderen Fällen versuchen sie, einen Lebenssinn in der Mutterrolle und dem Streben nach großen Erziehungserfolgen zu finden. Hier werden die Kinder oft überfordert oder im Kindstatus fixiert, da die Frauen nur so ihre Mutterrolle beibehalten können. Die "Brigitte Untersuchung '88" (Erler et al. 1988) ergab jedoch, dass in erster Linie Hausfrauen mit beruflichem Rückkehrwunsch unter ihrer Lebenssituation litten: Sie berichteten von innerer Ambivalenz und Zerrissenheit, waren mit ihrem Leben und ihrem Partner unzufrieden, empfanden negative Selbstwertgefühle. Fast einem Drittel "fiel die Decke auf den Kopf". Hingegen erlebten Langzeithausfrauen im Vergleich zu ihnen oder zu erwerbstätigen Frauen die größte innere Harmonie. Sie waren mit ihrer Situation und dem erreichten Emanzipationsniveau zufrieden, zeigten das größte Selbstbewusstsein als Mütter.
Auch bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) berichteten 40% der 30- bis 39-jährigen und 54% der 50- bis 60-jährigen Hausfrauen, dass ihre Tätigkeit sie voll und ganz befriedigt. Weniger als 4% antworteten "überhaupt nicht". An Vorteilen der Familientätigkeit wurden beispielsweise genannt: Hausfrauen können sich ihre Zeit besser einteilen, haben mehr Freizeit und können dementsprechend ihre Interessen besser pflegen, können ihren Haushalt leichter in Ordnung halten und als Gastgeberin glänzen, gelten eher als kinderlieb. Auch assoziierten 45% der Befragten ein glückliches Familienleben mit der Entscheidung für die Hausfrauentätigkeit, aber nur 18% mit der Berufstätigkeit der Frau.
Vielfach wird übersehen, dass die Familientätigkeit hohe Anforderungen an die sie ausübenden Personen stellt. So verlangt sie ihnen ein breiteres Spektrum rationaler, planerischer, emotionaler, expressiver, kommunikativer und anderer Fähigkeiten als die Berufstätigkeit ab, fördert sie die Entwicklung von psychologischem Verständnis, Kreativität und Denkfähigkeit, ermöglicht sie eher eine ganzheitliche Selbstentfaltung und das Einbringen der ganzen Persönlichkeit. Becker-Schmidt und Knapp (1985: 168) schreiben: "Weibliche Arbeitskraft garantiert nicht allein die materielle Versorgung der Familienmitglieder; mütterliches Engagement gewährleistet auch affektiven Rückhalt, Konfliktbewältigung, Interessenausgleich. Frauen müssen beide Anforderungen synchronisieren und ausbalancieren: ohne sachlich-instrumentelles Kalkül lässt sich ein Haushalt nicht organisieren; Kindererziehung dagegen gedeiht nur in einem Klima der Wärme, der emotionalen Überschüsse, der Spontaneität, des Verzichts auf durchrationalisiertes Verhalten. Zuhausesein ermöglicht Zerstreuung, Entregelung der Sinne, Aufgabe von fester Zeitplanung".
Dennoch dürfte für immer mehr Frauen eine ausschließliche Familientätigkeit zu einer nur kurzen Phase in ihrem Leben werden: Laut einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) kehrt rund die Hälfte der die Erwerbstätigkeit unterbrechenden Frauen - insbesondere Mütter mit nur ein oder zwei Kindern, Ausländerinnen und Frauen, deren Ehemänner wenig verdienen oder die noch nicht lange verheiratet sind - innerhalb von drei Jahren in den Beruf zurück. So beträgt die durchschnittliche Dauer der Unterbrechung nur rund fünf Jahre. Insgesamt haben 54% der heute berufstätigen Frauen laut der oben genannten Befragung die Erwerbsphase unterbrochen, und zwar 40% einmal, 11% zweimal und knapp 3% häufiger. Die meisten sind wieder berufstätig geworden, weil sie gern wieder mit anderen Menschen zusammenkommen wollten (54%), finanziell unabhängig sein wollten (45%), durch den Haushalt nicht ausgelastet waren (45%), ihre Altersvorsorge sichern wollten (42%), eine neue Aufgabe wünschten, da ihre Kinder sie nicht mehr so nötig brauchten (36%), einige größere Anschaffungen planten (36%) oder sich persönlich mehr leisten wollten (35%).
Den befragten Frauen fiel der Wiedereintritt in die Arbeitswelt umso schwerer, je länger sie daheim waren. Der Verlust an beruflichen Qualifikationen, der Grad der Entfremdung vom Arbeitsleben sowie die persönlichen und familialen Umstellungsprobleme beim Wiedereinstieg werden nämlich mit zunehmender Dauer der Unterbrechung immer größer. Auch müssen die Frauen sich dann immer häufiger mit schlechter bezahlten Stellen abfinden.
Laut einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) wächst 28% der berufstätigen Frauen (38% der erwerbstätigen Mütter mit drei und mehr Kindern) die Arbeit oft und 55% manchmal über den Kopf - gegenüber 17 beziehungsweise 62% der nichterwerbstätigen Frauen. Bei einer in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Umfrage (Simm 1989) erklärten jedoch mehr als drei Viertel der erwerbstätigen Mütter, dass sie Beruf und Familie gut oder sehr gut miteinander vereinbaren können: "Allerdings unterscheiden sie sehr deutlich zwischen den Belastungen durch ihre Kinder und den Belastungen durch Haushaltstätigkeiten. Während die erwerbstätigen jungen Mütter angeben, dass ihre Haushaltspflichten 'oft schwer mit der Erwerbstätigkeit zu vereinbaren '' seien, gilt das nicht für ihre Aufgaben bei der Kindererziehung. Die Doppelbelastung betrifft also nicht insgesamt den Konflikt von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit, sondern vor allem den Konflikt zwischen Beruf und Haushalt" (S. 36).
Eine Überlastung kann zu Gereiztheit, Erschöpfung und anderen Stresssymptomen sowie zu daraus resultierenden Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen führen. Viele Frauen versuchen, die Belastung dadurch zu vermindern, dass sie ihre beruflichen Ziele reduzieren, auf Aufstiegschancen verzichten oder auf Halbtagstätigkeiten ausweichen. Sie zeigen aber auch ein ähnliches Verhalten, wenn sie durch ihre Erwerbstätigkeit die Karriere ihres Ehemannes behindern oder wenn sie in Konfliktsituationen geraten, wo sie sich zwischen Familie und Beruf entscheiden müssen.
Wohl meinten bei einer bundesweiten Umfrage (Brigitte/Metz-Göckel/Müller 1985) 53% der befragten Männer, dass der Beruf für Frauen genauso wichtig sei wie für Männer - aber nur 20% der in Baden-Württemberg befragten Ehemänner erwarteten bei Berufstätigkeit ihrer Frau positive Rückwirkungen auf ihre Ehe; 43% rechneten hingegen mit negativen (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a). Jedoch schilderten Männer mit erwerbstätigen Partnerinnen ihr Familienleben etwas positiver als solche mit nichterwerbstätigen Frauen. Laut einer für den Freistaat Bayern repräsentativen Befragung (Krombholz 1987) nannten Ehepaare, bei denen beide Partner berufstätig waren, auch mehr gelöste Konflikte (und etwa gleich viel ungelöste oder verdrängte) als Ehepaare, bei denen nur der Mann ein Einkommen hatte. Bei den erstgenannten Paaren gab es häufiger Auseinandersetzungen über Ordnung, die Aufgabenteilung im Haushalt und den Beruf, bei den letztgenannten öfters über die Beziehung zu Verwandten (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b).
Zu den Vor- und Nachteilen der Erwerbstätigkeit kann zum Beispiel auf folgende Befunde verwiesen werden: Laut einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) sahen Männer Vorteile der Berufstätigkeit ihrer Partnerin vor allem darin, dass sie sich mehr leisten könnten (61%) sowie dass ihre Frau mehr Kontakt zu anderen Menschen habe (59%), zufriedener (51%) und mehr ausgelastet sei (44%). Als Nachteile nannten sie, dass die Belastung für ihre Frau sehr groß wäre (46%), dass es weniger gemütlich zu Hause sei (27%) und dass der Haushalt oft zu kurz käme. In der Regel wurden mehr Nachteile und weniger Vorteile aufgezählt, wenn Kinder unter 15 Jahren in der Familie lebten.
Nach einer anderen repräsentativen Untersuchung in Baden-Württemberg (Krüsselberg/Auge/Hilzenbecher 1986) gibt es jedoch bei Frauen mit unterschiedlicher Erwerbszeit und Kinderzahl keine großen Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung ihrer Zufriedenheit mit Arbeit, Wohnungsreinigung, Wäschepflege, Freizeit und Kinderbetreuung: Sie beurteilten diese Bereiche zumeist als zufrieden stellend oder überwiegend zufrieden stellend.
Allerdings messen erwerbstätige Frauen laut der "Brigitte-Untersuchung '88" (Erler et al. 1988) der Hausarbeit weniger Bedeutung bei und mögen somit andere Maßstäbe anlegen. Bei dieser Studie wurde auch festgestellt, dass sie weniger von sich als Mütter überzeugt sind: Nur 28% glaubten, dass sie alles für ihre Kinder tun, was eine "gute" Mutter tun kann - im Gegensatz zu 49% der nichterwerbstätigen Mütter. Jedoch fühlten sie sich durch ihre Kinder weniger stark eingeschränkt und in der eigenen Entwicklung behindert.
Besondere Schwierigkeiten gibt es vielfach hinsichtlich der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kinderbetreuung, insbesondere bei kleineren Kindern. So sind erwerbstätige Mütter aufgrund des Mangels an Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren, wegen der zumeist nicht mit ihrer Arbeitszeit übereinstimmenden Öffnungszeiten von Kindergärten beziehungsweise aufgrund der uneinheitlichen Stundenpläne von Grundschulen auf die Hilfe von Verwandten, Freunden, Nachbarn, Tagesmüttern usw. angewiesen.
Beispielweise werden in Baden-Württemberg etwa 85% der Kinder, die weniger als drei Jahre alt sind und deren Mütter berufstätig sind, am Vormittag und 90% am Nachmittag innerhalb des Familienverbandes betreut; ansonsten werden sie zu gleichen Teilen in Krippen oder in Tagespflegestellen, bei Freunden beziehungsweise Nachbarn untergebracht (Werner 1984). Kinder zwischen drei und sechs Jahren werden am Vormittag zu 68% im Kindergarten und zu 20% innerhalb des Familienverbandes betreut; die Übrigen werden in Kindertagesstätten, Tagespflegestellen, bei Freunden und Nachbarn untergebracht. Am Nachmittag spielt dann die Betreuung durch Großeltern und andere Verwandte eine größere Rolle. Auch bei älteren Kindern übernehmen Verwandte und Nachbarn oft die Beaufsichtigung nach der Schule, wenn die Mütter ganztags erwerbstätig sind. Häufig bleiben sie aber ohne Betreuung - in Baden-Württemberg ist dieses bei 27% der betroffenen Kinder für drei und mehr Stunden an Werktagen der Fall (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a). So ist es nicht verwunderlich, dass laut dieser Umfrage nur 43% der ganztags berufstätigen und 63% der teilzeitbeschäftigten Mütter mit der Betreuung ihrer Kinder völlig zufrieden waren.
Bei einer außerhäuslichen Betreuung von Kleinst- und Kleinkindern besteht die Gefahr von Entwicklungsstörungen, wenn diese diskontinuierlich und unpersönlich ist beziehungsweise wenn die Kinder mit wechselnden Bezugspersonen und unterschiedlichen Erziehungsstilen konfrontiert werden. Übernehmen Großeltern die Pflege und Erziehung der Kinder, so mögen sie auch ihre Enkel vereinnahmen, verwöhnen und überbehüten. In der Regel hat die Berufstätigkeit der Mutter eher eine positive Wirkung auf die Entwicklung von Mädchen und eine negative auf die von Jungen (Bronfenbrenner 1986).
Eine für Baden-Württemberg repräsentative Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) ergab Folgendes: Väter mit Kindern unter 18 Jahren berichteten nicht häufiger von allgemeinen Erziehungsproblemen (wie zum Beispiel Ungehorsam, Unordentlichkeit, Trotz, Streit oder Lügen), wenn ihre Partnerin berufstätig war. Generell fanden es 55% der Jugendlichen mit berufstätiger Mutter gut, dass sie arbeitet, 22% war es egal und nur 23% hätten sie lieber daheim.
Interessant ist noch das Befragungsergebnis, dass Kinder erwerbstätiger Mütter andere Rollenleitbilder entwickeln als solche mit nichtberufstätigen Müttern. So bevorzugen weibliche Jugendliche, deren Mütter auf die Berufsausübung verzichteten, die Hausfrauen- und Mutterrolle stärker als Mädchen, deren Mütter erwerbstätig blieben oder nach einer kurzen Unterbrechung wieder in die Arbeitswelt zurückkehrten. Entsprechendes gilt auch für männliche Jugendliche hinsichtlich ihrer Vorstellung, ob die zukünftige Ehefrau erwerbstätig sein soll oder nicht (Allerbeck/Hoag 1985).
Alternative Familienformen
Schon immer waren Menschen mit den jeweils vorherrschenden Familienformen unzufrieden und entwickelten alternative Konzeptionen. Die Gegenmodelle reichen von der totalen Ablehnung von Ehe und Familie bis hin zu deren grundlegenden Reform; sie umfassen Kommunen, Kibuzze, Kollektive, Wohngemeinschaften, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Ehen ohne sexuelle Treue usw. So wird zum Beispiel in Kommunen versucht, das Privateigentum abzuschaffen, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufzuheben, sexuelle Freizügigkeit durchzusetzen und eine repressionsfreie Erziehung zu praktizieren. Die Kommunarden wollen sich selbst nach einem neuen Menschenbild umgestalten, distanzieren sich von der bürgerlichen Welt und möchten die Gesellschaft revolutionieren. Dabei orientieren sie sich seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem an sozialistischen Ideologien - in der Zeit zuvor gab es aber auch Kommunen, die sich auf jüdische oder christliche Lehren beriefen oder in erster Linie ein naturverbundenes einfaches Leben anstrebten (Landkommunen). Zumeist existieren Kommunen nur für kurze Zeit; sie scheitern an utopischen Erwartungen, großen Konflikten und der mangelnden wirtschaftlichen Grundlage.
Wohngemeinschaften
Wohngemeinschaften sind im Vergleich zu Kommunen sehr viel kleinere Gruppen von nichtverwandten Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben und wirtschaften. In der Bundesrepublik Deutschland entstanden viele Wohngemeinschaften in den 60er-Jahren im Zusammenhang mit der Studentenbewegung. Sie verfolgten vielfach ähnliche Ziele wie die Kommunen - nur im Kleinen: So wurde in ihnen mit Gemeinschaftseigentum, sexueller Freizügigkeit und neuen Formen der Kindererziehung experimentiert, wobei sich die Mitglieder vor allem von sozialistischen Ideen leiten ließen.
Heute sind Wohngemeinschaften zu einer selbstverständlichen Lebensform geworden, die sich von ihren Ursprüngen in den 60er-Jahren entfernt hat und keiner Rechtfertigung mehr bedarf. Man schätzt die Zahl der Wohngemeinschaften auf 60.000 bis 100.000 (H. Schenk 1984), wobei die meisten in Universitäts- und Großstädten vorzufinden sind. Ihre Mitglieder sind zumeist Studenten oder junge Akademiker, die gemeinsam eine Wohnung oder ein Haus gemietet haben, weil sie auf diese Weise mehr Platz haben und preiswerter leben können (geringere Kosten für Miete, Lebenshaltung und Haushaltsgeräte). Andere Gründe für die große Resonanz dieser Lebensform sind Möglichkeiten zu einer Rationalisierung der Haushaltsführung, einer nicht geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilung und einer demokratischen Organisation.
In Wohngemeinschaften streben die meisten Mitglieder nach persönlicher Weiterentwicklung, Selbstverwirklichung, emotionaler Sicherheit und Überwindung von Isolation, wobei sie der intensiven und herrschaftsfreien Kommunikation eine große Bedeutung beimessen. So stehen oft lange Gespräche im Mittelpunkt des Gruppenlebens, in denen gesellschaftspolitische Themen und Aktivitäten, alternative, politische oder religiöse Werte sowie sozialwissenschaftliche und philosophische Fragestellungen behandelt werden. Häufig wird auch über persönliche und zwischenmenschliche Probleme diskutiert, wobei die Mitglieder nach Sensibilität und Offenheit für Gefühle und psychische Prozesse trachten, (selbst-)therapeutische Ansprüche verfolgen und gegenseitige Lebenshilfe leisten. Da es für Wohngemeinschaften keine eindeutigen Rollen, Beziehungsdefinitionen, Strukturen und Regeln gibt, muss auch die Art des Zusammenlebens in fortwährenden Verhandlungen ausgestaltet werden. Dabei kommt es oft zu frustrierenden Dauerdiskussionen um die Rechte und Pflichten des einzelnen. Die in diesen Gesprächen getroffenen Regelungen über Haushaltsführung, Arbeitsteilung und Finanzen sind von Wohngemeinschaft zu Wohngemeinschaft unterschiedlich. So werden zum Beispiel die anfallenden Hausarbeiten unter den Mitgliedern aufgeteilt, abwechselnd in einem bestimmten Turnus ausgeführt oder gemeinsam erledigt. Zumeist gibt es eine Haushaltskasse, in welche die Mitglieder entweder den gleichen oder einen nach der Höhe ihres Einkommens gestaffelten Betrag einzahlen. Vereinzelt werden auch alle Einkünfte gemeinsam verwaltet. Besitz und Eigentum spielen generell eine geringe Rolle.
Das "Zentrum" einer Wohngemeinschaft ist in der Regel die Küche, in der die meisten Gespräche ablaufen, gemeinsam gekocht und gegessen wird. Durch die Anwesenheit in der Küche signalisieren die Mitglieder ihre Gesprächsbereitschaft. Die anderen Räume werden zumeist nur von Einzelpersonen oder Paaren genutzt, die sich dorthin zurückziehen können und dann in der Regel ungestört bleiben. So schiebt sich zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit die Gruppenöffentlichkeit. In nahezu allen Wohngemeinschaften wird heute keine sexuelle Freizügigkeit mehr praktiziert. Manche Mitglieder haben keinen Partner, andere entweder einen festen Partner außerhalb oder innerhalb der Wohngemeinschaft - wobei Letzteres seltener zu sein scheint: Es besteht nämlich eine Art "Gruppeninzestverbot" (Lange), das die Mitglieder vor sexueller Konkurrenz untereinander schützt und verhindern soll, dass Partnerbeziehungen den Gruppenzusammenhalt schwächen. Partner, die gemeinsam in einer Wohngemeinschaft leben, müssen erst eine Paar-Identität aus dem Beziehungsgeflecht herausarbeiten, die sich nicht wie in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften automatisch aus der Abgrenzung nach außen (eigener Haushalt) ergibt. Die anderen Mitglieder mögen diesen Prozess fördern und die Paarbeziehung stabilisieren, können aber auch einen negativen Einfluss auf sie ausüben.
In Wohngemeinschaften leben nur wenige Kinder, die dort vielfältigere Sozialisationsbedingungen vorfinden als in der Kleinfamilie. Sie haben mehr Bezugspersonen, werden mit unterschiedlicheren Rollenvorbildern konfrontiert, können mehr soziale Lernerfahrungen machen, erhalten häufiger Rückmeldung und erfahren mehr kognitive Anregung. Leben Kinder verschiedener Paare in einer Wohngemeinschaft, so gehen sie oft geschwisterähnliche Beziehungen ein. Die sich herausbildende Kindergruppe ermöglicht ihnen auch mehr Unabhängigkeit. Die Eltern können sich gegenseitig helfen und ihre Erfahrungen mit den Kindern austauschen. Zudem erleben sie eine gewisse Entlastung durch die anderen Mitglieder, die oft bei Erziehungsfehlern korrigierend eingreifen. Die kindliche Entwicklung mag aber durch unterschiedliche Wertorientierungen, Normen und Erziehungsstile der Erwachsenen geschädigt werden. Ferner verlieren Kinder aufgrund der hohen Mitgliederfluktuation oft wichtige Bezugspersonen (Deprivationserfahrungen): Wohngemeinschaften bestehen nämlich selten länger als zwei Jahre mit derselben Personenkonstellation. Immer wieder scheiden Mitglieder aus, weil sie ihr Studium beendet oder einen Arbeitsplatz gefunden haben, weil sie mit ihrem Partner zu zweit leben möchten oder weil sie von anderen Haushaltsangehörigen fortwährend in Konflikte verwickelt werden. So müssen Beziehungen immer wieder umstrukturiert werden.
Neben der zuvor beschriebenen Form der Wohngemeinschaft gibt es noch einige weitere, die aber bei weitem nicht so verbreitet sind. Manche Wohngemeinschaften sind Teil eines umfassenderen alternativen Lebensentwurfes und werden dann über die Spätadoleszenz hinaus als Haushaltsform beibehalten. Einige Wohngemeinschaften entstehen auch aus dem Zusammenschluss von Kleinfamilien oder Alleinerziehenden. Gerade hier gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Intensität des Zusammenlebens. Auch ist die gemeinsame Wertebasis nur recht vage ausformuliert - eine größere Rolle als Motive für die gewählte Lebensform spielen hier Sympathie und zweckrationale Gründe. Schließlich gibt es vereinzelt Wohngemeinschaften älterer Menschen. Sie haben sich aus Angst vor Isolation und Vereinsamung zusammengeschlossen, wollten die Paarsituation erweitern oder ein starkes Bedürfnis nach Kontakt und Anregung befriedigen. Die Mitglieder bewohnen oft separate Wohnungen in einem Haus, sodass Gruppenprozesse zumeist weniger intensiv sind. Von großer Bedeutung sind die wechselseitige Unterstützung und Hilfe.
Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Als nichteheliche Lebensgemeinschaft bezeichnet man die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau in einer umfassenden Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft, die nicht offiziell bestätigt beziehungsweise legitimiert wurde. Derartige Beziehungen sind heute von der Gesellschaft weitgehend toleriert: So waren bei einer im April 1986 durchgeführten repräsentativen Umfrage (EMNID-Institut 1986c) 74% der Befragten für eine "Ehe auf Probe" und nur 25% (meist ältere Personen) dagegen. Eine "Ehe ohne Trauschein" wurde bereits von jedem zweiten Befragten akzeptiert - aber nur noch jeder Vierte war dafür, wenn die Partner Kinder haben. Bei einem solchen Meinungsbild ist es nicht verwunderlich, dass laut einer Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Allerbeck/Hoag 1985) 85,4% der Männer und 79,7% der Frauen, die noch ledig waren, aber einmal heiraten wollen, zunächst vor der Ehe zusammenleben möchten.
Bei einer im Auftrag des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit (1985) vom EMNID-Institut im Jahr 1983 durchgeführten Umfrage wurde in 7,5% aller Haushalte Personen angetroffen, die nach eigenem Bekunden in nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben. 66% dieser Erwachsenen hatten einen gemeinsamen Haushalt gebildet. So kann man davon ausgehen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland rund 1,25Mio. Haushalte nichtehelicher Lebensgemeinschaften gibt, die sich vor allem in größeren Städten befinden. Die in diesen Haushalten lebenden Erwachsenen waren laut oben genannter Umfrage zu knapp 40% über 30 Jahre alt, hatten zu etwa einem Drittel das Abitur oder einen Hochschulabschluss erworben und lebten zu drei Fünfteln für weniger als drei Jahre zusammen. In einem Fünftel der Haushalte war mindestens ein Partner geschieden; in einem Viertel lebte mindestens ein Kind aus früheren Beziehungen der Partner und bei 5% ein gemeinsames Kind. Amtliche Statistiken weisen für 1987 jedoch nur 778.000 nichteheliche Lebensgemeinschaften aus, davon 90.000 mit Kindern (Statistisches Bundesamt 1989). Nach einer nichtrepräsentativen Umfrage (Marbach et al. 1987) hat etwa ein Viertel aller Erwachsenen einmal für mindestens ein Jahr in einer Partnerschaft gelebt, ohne verheiratet gewesen zu sein.
Generell lassen sich verschiedene Formen nichtehelicher Lebensgemeinschaften unterscheiden: So hatten laut der Umfrage des EMNID-Instituts (Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 1985) 33% der Befragten fest vor, ihren Partner später zu heiraten. Weitere 38% waren sich dessen (noch) nicht sicher. Eine feste Heiratsabsicht war vor allem bei 18- bis 24-jährigen, bei Personen mit mittlerer Schulbildung, bei Kleinstädtern und bei Partnern festzustellen, die zwischen ein und drei Jahren zusammenlebten und weder geschieden waren noch Kinder aus früheren Beziehungen hatten. In diesen Fällen gehen die Partner also davon aus, dass die nichteheliche Lebensgemeinschaft nur eine Vorstufe zur Ehe ist, welche die Funktion der früher üblichen Verlobungszeit übernimmt. Als "Ehe auf Probe" soll sie den Partnern ermöglichen, einander zu prüfen und gründlich im Alltag kennen zu lernen. Auf diese Weise soll eine Fehlentscheidung vermieden werden, die unter Umständen zu einer späteren Scheidung mit den damit verbundenen hohen Kosten und Unterhaltsansprüchen führen könnte.
Manche Personen fühlen sich auch noch zu jung für die Ehe oder möchten erst die eigene beziehungsweise gemeinsame Existenz sichern. In vielen dieser Fälle wollen die Partner erst bei Schwangerschaft oder Kinderwunsch heiraten, da für sie eine Ehe ohne Kinder nicht plausibel ist. Hier wird deutlich, dass nur die Ehe in den letzten Jahren einen Bedeutungsverlust erlitten hat - die Familie hat aber auch bei jungen Erwachsenen weiterhin einen hohen Stellenwert. 28% der befragten Personen, die in nichtehelichen Lebensgemeinschaften lebten, hatten hingegen keine Heiratsabsichten. Unter ihnen waren Paare überrepräsentiert, die in Großstädten lebten, die seit mehr als drei Jahren zusammen waren und bei denen zumindest ein Partner geschieden war oder Kinder aus früheren Beziehungen hatte. Diese Paare lassen sich in zwei Untergruppen aufteilen: Etwa 8% aller befragten Personen lehnten die Ehe grundsätzlich ab. Sie kritisierten an ihr vor allem die Verrechtlichung und Institutionalisierung persönlicher Beziehungen, die sie als Teil ihres privaten Intimbereiches betrachteten. Als andere Nachteile der Ehe galten zum Beispiel die zu engen Bindungen, die mangelnde Emanzipation der Frau, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die negativen Folgen von Trennung und Scheidung. Die anderen Befragten sahen in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft eine für sie eher akzeptable Alternative zur Ehe, die sie nicht prinzipiell ablehnten. Diese Personen wollten die eigene Unabhängigkeit bewahren und sich selbst verwirklichen. Auch sahen sie in der Liebe die eigentliche Legitimation ihrer Beziehung, die sie nur so lange aufrechterhalten möchten, wie die Liebe dauert. Manche hatten zudem Angst vor dem Scheitern ihres Verhältnisses, da sie bereits in ihrer Herkunftsfamilie beziehungsweise in einer früheren Ehe eine Scheidung erlebt hatten. Sicherlich spielten manchmal auch Bindungsängste, der Zweifel an der eigenen Fähigkeit zu einer lebenslangen Beziehung und die Angst vor der Übernahme von Verantwortung eine Rolle.
Eine andere Form der nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist die zumeist recht kurzfristige und instabile Verbindung zwischen zwei jüngeren Partnern, über deren Dauer die Beziehungsqualität entscheidet. Oft leben auch geschiedene oder verwitwete Personen zusammen, weil sie Unterhaltszahlungen, Renten und andere öffentliche Leistungen nicht verlieren möchten. Ähnliches gilt manchmal für Studentenpaare, bei denen ein Partner im Falle der Heirat auf Zahlungen nach dem BAföG verzichten müsste. Einige nichtehelichen Lebensgemeinschaften bestehen auch nur so lange, wie die Partner an verschiedenen Orten arbeiten und getrennte Haushalte haben müssen. Finden sie jedoch in derselben Gemeinde zwei Arbeitsplätze, so ziehen sie zusammen und "legalisieren" ihre Beziehung.
Laut der erwähnten EMNID-Umfrage ist die traditionelle Rollenverteilung in nichtehelichen Lebensgemeinschaften seltener zu finden als in vergleichbaren Ehebeziehungen: So übernahmen Männer mehr Aufgaben im Haushalt beziehungsweise wurden mehr Arbeiten gemeinsam erledigt als in einer Vergleichsgruppe - wobei die Unterschiede jedoch nicht sehr groß waren (die angegebenen Prozentsätze schwankten zwischen 1 und 7%). Auch fällten Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften mehr Entscheidungen gemeinsam, verwirklichten also eher das Postulat der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sie gingen mit Konflikten offener um, unterstützten einander mehr, waren zärtlicher zueinander, hatten mehr gemeinsame Interessen und gingen öfters aus.
In der Regel sind beide Partner erwerbstätig. Sie legen zumeist einen mehr oder minder großen Teil ihrer Einkünfte zusammen - in den übrigen Fällen behält jeder Partner sein Einkommen; nur selten sorgt einer für beide. Obwohl die Partner großen Wert auf Freiheit, Selbstentfaltung und die grundsätzliche Möglichkeit einer jederzeitigen Trennung legen, haben sie meistens ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und enge Bindungen entwickelt. Eine große Bedeutung wird auch der sexuellen Treue beigemessen. Nach der EMNID-Umfrage rechneten 30% der Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Nachteilen ihrer Lebensform gegenüber der Ehe - vor allem in materieller Hinsicht, in der sozialen Sicherung und auf dem Wohnungsmarkt. Obwohl aufgrund des Wertewandels und der positiven Haltung der Medien eine Diskriminierung von nichtehelichen Lebensgemeinschaften selten geworden ist, berichteten Befragte immer noch von Schwierigkeiten mit Eltern, Verwandten und Nachbarn, unter denen vor allem Frauen litten (Pohl 1985). Probleme mit Behörden oder im Beruf wurden aber nur noch von wenigen genannt. Da nichteheliche Lebensgemeinschaften weniger dauerhaft als Ehen sind, gibt es oft Auseinandersetzungen bei einer Trennung. Zum einen kann es zu Streitigkeiten um Besitztümer kommen, mag sich die Verteilung gemeinsam verwalteter Gelder schwierig gestalten. Zum anderen sind - insbesondere wenn die Beziehung langfristig war - nichterwerbstätige Partner benachteiligt, da sie keine Unterhaltsansprüche haben. Ähnliches gilt für Männer beim Vorhandensein gemeinsamer Kinder: Sie haben als nichteheliche Väter sehr viel weniger Rechte als die Mütter der Kinder. So ist es nicht verwunderlich, dass laut der vorgenannten EMNID-Umfrage bei 11% der nichtehelichen Lebensgemeinschaften mündliche, bei 8% schriftliche und bei 2% sogar notarielle Vereinbarungen für den Trennungsfall getroffen wurden.
Teil 3 Familienprobleme
Im Mittelpunkt des 3. Teils unseres Buches stehen Probleme, die häufig in Familien auftreten und sie längerfristig belasten. Kenntnisse über häufig auftretende Schwierigkeiten und deren Ursachen sind Voraussetzung für die Konzeptualisierung und Beurteilung von familienpolitischen Maßnahmen wie auch für die praktische Tätigkeit von Sozialpädagogen.
Erkenntnisse über Problemfamilien und Familienprobleme werden auf vielen verschiedenen Wegen gesammelt. Zum einen werden die zu Beginn des Teils 2 erwähnten Familientheorien angewandt. Zum anderen wurden insbesondere bei der Untersuchung von Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen, psychosomatischen Erkrankungen und Suchtkrankheiten unterschiedliche Erklärungsmodelle entwickelt (Textor 1988, Weckowicz 1984). Dazu gehören vor allem das Krankheitsmodell, das von vielen Ärzten vertreten wird, das konstitutionelle Modell (Conrad, Kretschmer, Sheldon), das Stressmodell (Meehl, Zubin), das psychodynamische Modell (Freud, Adler, Sullivan), das Entwicklungsmodell (Erickson, Piaget), das lerntheoretische Modell (Pawlow, Skinner), das kognitive Modell (Ellis, Beck), das humanistische Modell (Rogers, Maslow), das phänomenologisch-existentialistische Modell (Frankl), das "Labeling"-Modell (Goffman), das mikrosoziale Modell (Berne, Laing) und das makrosoziale Modell (Durkheim, Marx, Parsons). Diese Modelle, die wiederum Sammelbegriffe für eine mehr oder minder große Zahl von Theorieansätzen sind, lassen sich generell auf psychische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten usw. anwenden.
Problemursachen, die sich auf pathogene Familienstrukturen und -prozesse zurückführen lassen, werden vor allem von Praktikern der Familientherapie und -beratung herausgestellt, deren Theorieansätze dem mikrosozialen Erklärungsmodell zuzurechnen sind. Auch hier sind im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine Vielzahl von Therapieansätzen entwickelt worden, die sich folgenden "Schulen" zuordnen lassen (Textor 1985): Strategische Familientherapie (Haley, Palazzoli, Watzlawick), strukturelle Familientherapie (Minuchin), verhaltenstherapeutische Familientherapie (Patterson, Liberman), Therapie der erweiterten Familie (Speck, Bowen), erfahrungsbezogene Familientherapie (Satir, Kempler) und psychodynamische Familientherapie (Stierlin, Boszormenyi-Nagy).
Es ist offensichtlich, dass sich alle diese Erklärungsmodelle und Therapieansätze (wie die Familientheorien) nur auf einzelne Aspekte der Gesamtproblematik konzentrieren und deshalb möglichst im Sinne einer "integrativen" Theoriebildung zu einem "Ganzen" zusammengefasst werden sollten (Textor 1985, 1988). Aus Platzgründen ist es nicht möglich, die erwähnten Modelle und Theorieansätze darzustellen und im Folgenden auf die einzelnen Familienprobleme und Problemfamilien zu beziehen, obwohl in diesem Teil oft auf ihre Erkenntnisse zurückgegriffen wird. Auch scheint es mir sinnvoller zu sein, einen Überblick über die jeweiligen Schwierigkeiten, ihre Ursachen und Folgen zu geben, als theoretische Fragestellungen zu erörtern. Anzumerken ist noch, dass zum Beispiel über Familien mit arbeitslosen, behinderten oder pflegebedürftigen Mitgliedern, über Scheidungs-, Teil- und Stieffamilien auch viele empirische Forschungsergebnisse vorliegen. Wie die Praxisberichte von Sozialarbeitern liegen ihnen häufig keinen expliziten Theorieansätze zugrunde.
Eheprobleme und Familienkonflikte
Oft wird die Familie als belastend erlebt: So berichteten Erwachsene bei einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b), dass sie in ihrer Familie aufeinander Rücksicht nehmen (52%) sowie einander Erwartungen und Ansprüche erfüllen müssen (32%), dass sie dort Streit und Auseinandersetzungen erleben (27%), viel arbeiten (24%) und immer scharf rechnen müssen (16%), von anderen abhängig sind (14%), Stress erleben (14%), oft gestört werden (12%) oder gelangweilt sind (5%). 12% der Befragten kostet die eigene Familie sehr viel Kraft, 32% ziemlich viel, 42% etwas und 11% gar keine Kraft - Frauen fühlen sich zumeist etwas stärker belastet als Männer. Auch bei einer bundesweiten Umfrage (Wahl/Stich/Seidenspinner 1989) berichteten 24% der Befragten von häufigen Familienkonflikten. Überrepräsentiert waren Familien mit älteren Kindern oder Jugendlichen, Familien mit mehr als zwei Kindern und solche mit einem niedrigen sozialen Status.
In diesem Zusammenhang sind Ehekonflikte von besonderer Bedeutung, da sie nicht nur die Partnerbeziehung stören und eventuell zu ihrer Auflösung führen können, sondern weil sie sich oft auch auf die Erfüllung der Funktionen von Familien negativ auswirken. In einer für den Freistaat Bayern repräsentativen Umfrage (Krombholz 1987) zeigte sich folgendes Bild: 66% der Befragten berichteten von keinerlei Ehekonflikten; 21% erlebten einen oder zwei von 17 vorgegebenen möglichen Konfliktfeldern als belastend. Generell gaben jüngere Ehepartner, Personen mit höheren Bildungsabschlüssen und Frauen mehr Eheprobleme an. Die meisten Konflikte bezogen sich auf den Umgang mit Geld, das Temperament oder die persönlichen Gewohnheiten des Partners, die Verrichtung der Hausarbeit, die Freizeitgestaltung sowie auf Verwandte, Freunde und Bekannte. Konflikte können zum Beispiel zu psychosomatischen und psychischen Erkrankungen, Verhaltens- oder Persönlichkeitsstörungen, sexuellen Dysfunktionen und Suchtkrankheiten führen; so hat etwa jeder dritte Deutsche bereits einmal in seinem Leben irgendeine psychische Krankheit erfahren oder leidet immer noch an ihr (Bundesregierung 1975).
In diesem Kapitel soll untersucht werden, welche pathogenen Familienstrukturen und -prozesse Ehekonflikte oder psychische Störungen hervorrufen und aufrechterhalten können. Zuvor ist aber noch darauf hinzuweisen, dass in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch individuelle Merkmale eine große Rolle spielen: So liegen die Ursachen häufig in ungelösten und abgewehrten intrapsychischen Konflikten, bei denen entgegengesetzte Handlungstendenzen, Antriebe und Motive aufeinander treffen oder bei denen diese in einem eklatanten Widerspruch zu Familienregeln, Werten oder gesellschaftlichen Normen stehen. In anderen Fällen wirkt sich negativ aus, dass erwachsene Familienmitglieder egozentrisch sind, sich in erster Linie mit sich selbst beschäftigen oder ohne Rücksichtnahme auf andere nach Selbstverwirklichung, Bedürfnisbefriedigung und Genussmaximierung streben. Manche grenzen sich zu stark von den anderen Familienmitgliedern ab, behalten also ihre Gedanken und Gefühle bei sich, sind abweisend und verschlossen. Andere grenzen sich hingegen zu schwach ab, überschütten die Partner und Kinder mit ihren Empfindungen und Emotionen, streben fortwährend nach deren Zuneigung und Bestätigung. Einige wechseln auch immer wieder zwischen Phasen der Abgrenzung und Verwicklung, was vor allem für (Klein-)Kinder sehr verwirrend ist.
In vielen Fällen haben sich die erwachsenen Familienmitglieder zu plötzlich oder noch nicht von ihren Eltern abgelöst. Sie leben in alten Abhängigkeiten, selbst wenn sie diese verneinen. Auch sind sie oft durch unbewusste innere Aufträge oder Delegationen ("du sollst ein erfolgreicher Arzt werden", "Aus dir wird nie etwas werden!"), durch Schuldgefühle ("Wie kann ich meinen Eltern nur zurückzahlen, was sie mir an Gutem getan haben?") oder Hass ("Meine Mutter hat von mir immer nur genommen") an ihre Eltern gebunden. Die in den beiden letztgenannten Fällen empfundene Ungerechtigkeit kann dazu führen, dass der Erwachsene entweder versucht, seine "Schulden" gegenüber den Eltern zum Beispiel stellvertretend an seinen Partner oder seine Kinder zurückzuzahlen, diese also mit Gunstbeweisen überhäuft (und eventuell erdrückt), oder von ihnen zunächst nur nimmt und so von ihnen das erhalten will, was ihm seine Eltern vorenthielten.
Viele erwachsene Mitglieder von Familien, in denen es große Eheprobleme gibt oder einzelne Personen psychisch erkranken, leiden unter Wahrnehmungsstörungen. Sie registrieren bestimmte Eindrücke nicht, klammern ganze Klassen von Empfindungen und Emotionen aus ihrem Bewusstsein aus oder verzerren Wahrnehmungen. Aber auch Denkprozesse können gestört sein; so haben viele Schwierigkeiten, zwischen unterschiedlichen Ereignissen und Erfahrungen zu differenzieren, sie zu kategorisieren, ihre Ursachen zu erfassen und Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ermitteln. Auch mag ihr Denken zu abstrakt beziehungsweise zu konkret sein, durch irrationale Einstellungen ("Wenn du einen Fehler machst, ist das eine große Katastrophe", "Du musst immer so handeln, dass dich alle Menschen lieben") oder dogmatisch vertretene Werte verfälscht werden oder sprunghaft und regellos sein. Zudem sind viele Entscheidungen gefühlsbestimmt. Es ist offensichtlich, dass unter diesen Umständen auch viele Kinder Denk- und Wahrnehmungsstörungen entwickeln; die Lösung von Problemen und Konflikten wird erschwert.
Ähnliches gilt auch für Kommunikationsstörungen. So senden die Mitglieder dieser Familien häufig undeutliche, vage und unklare Botschaften, die mehrdeutige Begriffe und unvollständige Sätze enthalten. Oft werden komplexe Tatbestände, Gefühle und Gedanken nur mit ein oder zwei Worten angedeutet, da der "Sender" glaubt, dass der "Empfänger" zum Beispiel aus Liebe weiß, was er sagen will. Vielfach stehen auch verbale Botschaften im Widerspruch zur Gestik und Mimik des Senders. In derartigen Fällen ist der Empfänger verwirrt. Er macht nun seinerseits oft den Fehler, dass er nicht zurückfragt, sondern mit Hilfe seiner Erfahrungen und seines Bildes vom Sender die Botschaften zu entziffern versucht. Oder er hört ihm nicht mehr zu, unterbricht ihn oder disqualifiziert seine Aussagen. Problematisch ist ferner, wenn die Familienmitglieder unterschiedliche Kommunikationskanäle verwenden, füreinander sprechen oder über Dritte miteinander kommunizieren. Es ist offensichtlich, dass es bei einem derartigen kommunikativen Verhalten leicht zu Missverständnissen, falschen Reaktionen und Auseinandersetzungen kommt. Auch erschwert es die Lösung von Ehe- und Familienkonflikten, die durch normative (Übergänge im Lebens- und Familienzyklus) und nichtnormative Lebensereignisse (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Arbeitsplatzwechsel usw.) hervorgerufen werden können. Andere Ursachen von Konflikten können unterschiedliche Erwartungen, Einstellungen, Werte, Bedürfnisse und Persönlichkeitseigenschaften, zu hohe Ansprüche, verdeckte Machtkämpfe usw. sein. Konflikte laufen zumeist nach ganz bestimmten Interaktionsmustern ab. Sie haben vor allem dann pathogene Auswirkungen, wenn sie zur Spaltung der Familie, zu Bündnissen mit Außenstehenden (Großeltern, Freunden) oder zur Ausstoßung eines Familienmitgliedes führen. Problematisch ist ferner, wenn eine Person zum Sündenbock gemacht wird.
Vielfach können sich die Familienmitglieder nicht auf den Konfliktgegenstand und die Ursachen einigen, stimmen Problemdefinition und Problem nicht überein, werden aufgrund fehlender Informationen oder mangelnder Kreativität keine Lösungen gefunden, scheitern richtige Konfliktlösungsversuche an Inflexibilität oder zu starren Interaktionsmustern, Beziehungsdefinitionen und Regeln. So wird immer wieder über dieselben Punkte gestritten, belasten die ungelösten Konflikte das Familienleben und führen zu Gefühlen wie Unzufriedenheit und Feindseligkeit, zu Entfremdung und einem negativen Selbstbild. Vielfach kommt es dann immer häufiger zu Konflikten, werden immer schneller Drohungen, Erpressungsversuche, Schuldzuschreibungen und Gewalt eingesetzt, nimmt die Kompromissbereitschaft immer mehr ab. In anderen Fällen distanzieren sich die Mitglieder voneinander, gehen einander aus dem Weg oder internalisieren die Konflikte, die sich dann durch Symptome wie Depressionen, Alkoholismus oder Ängste äußern können. Ähnliches gilt auch für den Fall, dass Konflikte immer wieder verneint, abgewehrt, verdrängt oder verheimlicht und Verhandlungen aufgeschoben werden.
Neben Konflikten können sich auch bestimmte Beziehungsdefinitionen negativ auf das Familienleben auswirken. So gehen zum Beispiel manche Ehepartner eine symbiotische Beziehung ein, in der sie voneinander Besitz ergreifen, ihre Individualität aufgeben und miteinander verschmelzen. Jedoch mag auch eine Person eine schwächere Position (zum Beispiel als Kranker oder als "Kind") und eine andere eine stärkere (als Pfleger oder "Elternteil") einnehmen; beide sind aber ebenfalls voneinander abhängig. Zudem besitzt auch der "schwächere" Partner Macht, da er durch seine Symptome beziehungsweise sein Verhalten den anderen zu einem bestimmten Handeln zwingen kann.
Problematisch ist ferner, wenn erwachsene Familienmitglieder mit ihrer Beziehungsdefinition nicht zufrieden sind, also zum Beispiel überhöhte Erwartungen und unrealistische Vorstellungen haben; so suchen manche Partner das "Glück auf Erden", Einswerdung und die Befriedigung aller Bedürfnisse in der Ehebeziehung.
In diesem Zusammenhang spielen auch Mythen wie zum Beispiel die folgenden eine Rolle:
(l) Wer liebt, weiß automatisch, was der Partner wünscht, will, fühlt und denkt. Er hält dessen Bedürfnisse für wichtiger als die eigenen, will ihn glücklich machen und immer in seiner Nähe sein.
(2) Kein Partner kann ohne den anderen überleben. Er ist ohne ihn unvollständig.
(3) In einer guten Ehe gibt es keine Probleme und Konflikte. Die Partner haben immer dieselben Auffassungen, Ziele und Ideale.
(4) Eine gute Ehe kommt von selbst zustande, ohne dass die Partner an ihr arbeiten müssen. Sie bleibt immer gleich und verändert sich nicht im Verlauf der Zeit.
(5) Der Partner kann verändert und in eine bestimmte Form gebracht werden.
(6) Meinungsunterschiede sind böse und sind zu vermeiden. Wenn sie dennoch zustande kommen, kann nur einer Recht haben.
Aus derartigen Mythen resultieren so hohe Anforderungen an den Partner und die Ehebeziehung, dass sie nicht erfüllt werden können und fast schon automatisch zu Konflikten führen.
Ferner wirken Beziehungen pathogen, in denen sich Familienmitglieder voneinander distanziert haben, kaum noch Interesse für die Gedanken, Gefühle und Aktivitäten der anderen aufbringen, nur noch wenig Zeit miteinander verbringen und fast nur noch aus Gewohnheit zusammenleben. Wenn es zwischen den Ehepartnern zu einer "emotionalen Scheidung" (Bowen 1978) gekommen ist, mag auch der eine in eine symbiotische Beziehung zu einem Kind eintreten, sodass der andere zum Außenseiter wird (oder ein anderes Kind zu seinem Ersatzpartner macht). In anderen Fällen wechseln Familienmitglieder fortwährend zwischen Phasen der Verwicklung und der Abkapselung, da es ihnen nicht gelingt, ein akzeptables Maß zwischen Nähe und Distanz zu finden und beizubehalten.
Ehe- und Familienkonflikte können auch dadurch verursacht werden, dass die Mitglieder bestimmte Familienrollen nicht übernehmen. So mag zum Beispiel eine Frau die Mutterrolle verabsolutieren und ihrem Mann nicht mehr als Partnerin zur Verfügung stehen. In anderen Fällen werden nur bestimmte Rollensegmente ausgeklammert - beispielsweise wenn sexuelle Bedürfnisse nicht mehr in der Ehebeziehung befriedigt werden. Vielfach werden Familienrollen auch nur teilweise erfüllt, weil sich die Mitglieder verstärkt auf außerfamiliale Rollen konzentrieren, sich durch sie in ihrer Selbstentfaltung eingeschränkt fühlen oder ihnen die notwendigen Kompetenzen und Fertigkeiten fehlen. Manchmal sind sich die Familienmitglieder nicht über ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten im Klaren, weil die Rollen unklar definiert oder fortwährend gewechselt werden. In anderen Fällen werden sie hingegen zu starr voneinander abgegrenzt, nach nicht mehr zeitgemäßen Leitbildern gestaltet oder nicht dem Alter, dem Geschlecht und den Eigenschaften des jeweiligen Individuums angepasst.
Viele Familienprobleme resultieren auch aus der mangelhaften Erfüllung familialer Funktionen. Manche Ehepaare scheitern zum Beispiel an den Anforderungen der Haushaltsführung: So ist ihre Wohnung unaufgeräumt und verdreckt, kommt es zu Mangel- und Falschernährung, werden Besuche und Festlichkeiten zu einer Katastrophe, wird fortwährend der Haushaltsetat überzogen. Oft wird aber auch um eine gerechte und partnerschaftliche Aufteilung der anfallenden Arbeiten gekämpft. In anderen Familien wird die Freizeitfunktion nicht erfüllt. Die Mitglieder beschäftigen sich nur wenig miteinander, organisieren selten Ausflüge und Spiele, gehen kaum noch aus und verbringen viel Zeit mit nicht gemeinsamen Freunden. So sind sie häufig gelangweilt und unzufrieden. Problematisch ist aber auch, wenn eine bestimmte Art der Freizeitgestaltung (zum Beispiel Fernsehen oder Videokonsum) im Mittelpunkt des Familienlebens steht oder sehr viel Zeit einzelner Mitglieder beansprucht. Schwierigkeiten bezüglich der Reproduktionsfunktion können aus sexuellen Problemen und Dysfunktionen (bis hin zur Infertilität) oder aus Desinteresse am Partner resultieren. Manchmal ist auch ein Ehegatte stark gehemmt, lässt Zärtlichkeiten nicht zu, wehrt Lustempfindungen ab oder lässt nur wenige sexuelle Praktiken zu. Zu Problemen kann es ferner aus überhöhten Erwartungen (gemeinsamer Orgasmus als Norm) oder beim Austragen von Ehekonflikten im sexuellen Bereich kommen.
Viele Ursachen für Familienprobleme liegen auch in den die Familie umgebenden Systemen. So ist oft das Verhältnis zu den beiden Herkunftsfamilien auf eine der folgenden Weisen gestört:
(l) Ein Ehepartner oder beide sind in symbiotische Beziehungen mit Mitgliedern der Ursprungsfamilie verwickelt. Sie erlauben ihnen die Einmischung in ihr Familienleben. Oft werden sie von den Eltern wie Kinder und nicht wie Erwachsene behandelt. In manchen Fällen spielt sich auch der größte Teil des Familienlebens in den Herkunftsfamilien ab. Problematisch ist insbesondere, wenn derartig enge Beziehungen durch "Bestechung", die Weckung von Schuldgefühlen, die Aufrechterhaltung von Rollenzuschreibungen u. Ä. aufrechterhalten werden.
(2) Die Ehepartner haben entweder die Beziehung zu den Herkunftsfamilien abgebrochen oder stehen nur in einem oberflächlichen Kontakt zu ihnen. Sie haben oft kein starkes Selbst herausdifferenziert und leben in einer sehr engen Beziehung. Manchmal haben sie Schuldgefühle oder vermissen die Unterstützung durch ihre Verwandten.
(3) Zwischen Zeugungs- und Herkunftsfamilien gibt es viele offene oder verdeckte Konflikte, welche die Beziehungen belasten und Folgen wie Rollenzuschreibungen oder Projektionen haben. Manchmal werden Kinder in die Auseinandersetzungen einbezogen und aufgehetzt.
(4) Bei Ehekonflikten gehen die Partner Bündnisse mit ihren Eltern ein oder werden von diesen negativ beeinflusst, sodass es zu einer Spaltung der Zeugungsfamilie kommt.
Auf ähnliche Weise kann natürlich auch das Verhältnis zum Netzwerk gestört sein. So haben manche Familienmitglieder extrem enge Beziehungen zu Dritten, die sie der Familie entfremden (bis hin zu außerehelichen Verhältnissen). Oder sie haben so gut wie keine Freunde und Bekannte, sodass sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse gänzlich auf die Familie angewiesen sind und einander oft "aussaugen". In anderen Fällen belasten konfliktreiche Netzwerkbeziehungen die Familienmitglieder oder mischen sich Freunde und Bekannte auf negative Weise in Eheprobleme ein.
Pathogene Einflüsse können auch von der Arbeitswelt ausgehen. So leiden viele Ehepartner unter Konflikten mit Vorgesetzten, Kollegen oder Untergebenen, tragen diese in die Familie hinein und reagieren sie an anderen Familienmitgliedern ab. Große Belastungen können ferner aus beruflich bedingtem Stress, ständiger Überforderung, Kündigungsgefahr oder einem Arbeitsplatzwechsel resultieren. In diesen Fällen sind die Erwachsenen oft erschöpft, gereizt, frustriert und ungeduldig, reagieren schon bei kleinsten Anlässen aufbrausend oder kommen ihren Aufgaben als Partner und Elternteil nicht mehr richtig nach. Manchmal finden sie daheim wenig Verständnis und Unterstützung. Wenn beide Ehepartner erwerbstätig sind, werden Haushaltsführung und Kindererziehung häufig zu einer großen Last, bleibt ihnen nur wenig Zeit für gemeinsame Gespräche und Aktivitäten sowie zur Entspannung. Ähnliches gilt auch für den Fall, dass eine Person regelmäßig Überstunden macht beziehungsweise Arbeit mit nach Hause nimmt. Andere Belastungen können aus finanziellen Problemen oder beengten Wohnverhältnissen, aus Wertekonflikten oder unterschiedlichen Weltanschauungen resultieren.
Veränderte Familienstrukturen
Familienstrukturen wandeln sich nicht nur im Verlauf des Familienzyklus, sondern können sich auch aufgrund von Trennung, Scheidung und Wiederheirat verändern. Auf diese Weise entstehen zwei besondere Familienformen, nämlich die Familien Alleinerziehender und die Stieffamilien. Sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von Erstfamilien und konfrontieren ihre Mitglieder mit ganz speziellen Problemen. Im Gegensatz zu früher werden diese Familienformen weniger negativ gesehen. Nach Meinung vieler Fachleute bieten sie ihren Mitgliedern genauso gute Entwicklungsbedingungen wie "Normalfamilien". Bevor sie jedoch genauer beschrieben werden, soll noch der Scheidungszyklus dargestellt werden.
Trennung und Scheidung
Im Jahr 1988 wurden 128.729 Scheidungen registriert. Hinsichtlich der Scheidungsquote sind große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern festzustellen; so werden zum Beispiel im Freistaat Bayern - prozentual gesehen - nur halb so viele Ehen geschieden wie in Berlin. Generell ist in Städten die Scheidungsquote höher als auf dem Land; in Großstädten wie Hamburg, Frankfurt/Main und München werden schon mehr als 40% aller Ehen geschieden. Die durchschnittliche Ehedauer zum Zeitpunkt der Scheidung beträgt etwas weniger als 12 Jahre; Ehen im vierten und fünften Ehejahr sind besonders gefährdet. Das bedeutet, dass unter den knapp 100.000 Kindern, die jedes Jahr von der Scheidung ihrer Eltern betroffen werden, besonders viele Kleinkinder vertreten sind. Auch sind fast 60% der Kinder geschiedener Frauen Einzelkinder (Schwarz/Höhn 1985; Statistisches Bundesamt 1985, 1989).
Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte hat die Zahl der Scheidungen stark zugenommen. Dieses liegt zum Teil daran, dass Pflicht-, Solidaritäts- und Akzeptanzwerte und damit auch der Verpflichtungs- und Verbindlichkeitscharakter der Ehe an Bedeutung verloren haben. Stattdessen werden Individualismus, Emanzipation und Unabhängigkeit mehr betont.
Entsprechend dem neuen Eheleitbild ist Ehe an Liebe, Interessenübereinstimmung, wechselseitige Bedürfnisbefriedigung und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung geknüpft - sind diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben, ist die Ehe gefährdet. Hinzu kommt, dass Scheidungen zunehmend von der Gesellschaft akzeptiert und durch den Gesetzgeber erleichtert wurden und dass der Einfluss religiöser Normen stark abgenommen hat. So waren schon 1979 nur noch 12% aller Katholiken und 6% aller Protestanten der Meinung, dass die Ehe unauflösbar sein sollte (Institut für Demoskopie Allensbach 1983b). Auch fällt die Entscheidung, sich zu trennen, leichter, weil immer mehr Ehefrauen erwerbstätig und damit finanziell unabhängig sind. Weitere Faktoren sind, dass die Zahl der Kinder in Familien zurückgegangen ist und dass ihre Beaufsichtigung in Zeiten der berufsbedingten Abwesenheit allein erziehender Elternteile durch Kindergärten, Horte und private Arrangements sichergestellt werden kann.
Generell ist die Scheidungswahrscheinlichkeit größer, wenn die Ehepartner in sehr jungen Jahren oder wegen vorehelicher Schwangerschaft geheiratet haben, sich hinsichtlich Alter, Bildung und Schichtzugehörigkeit stark voneinander unterscheiden, kurz nach der Hochzeit das erste Kind zeugten oder kinderlos blieben. Auch bei einem niedrigen sozioökonomischen Status, nicht erfüllten Erwartungen an den Status, mangelnder Unterstützung der Ehe durch Eltern und Freunde, unterschiedlichen Rollenvorstellungen der Partner oder bei Berufstätigkeit beziehungsweise höherer Bildung der Frau ist die Scheidungsquote überdurchschnittlich hoch. Trennung und Scheidung werden heute als ein dynamischer und komplexer Prozess der Veränderung verstanden, der mehrere Jahre lang.
Die Vorscheidungsphase, deren Dauer von wenigen Monaten bis mehreren Jahren reichen kann, beginnt mit einer gewissen Desillusionierung und Unzufriedenheit mit der Ehebeziehung und dem Partner. Oft werden die Probleme zunächst verdrängt, verleugnet oder bagatellisiert. Die zunehmende Ernüchterung und Enttäuschung führen dann zu immer häufiger werdenden Auseinandersetzungen oder zu wachsender Entfremdung und stillem Rückzug. Die Partner kommunizieren weniger miteinander, sehen einander immer negativer, empfinden immer weniger positive Gefühle füreinander und sind bei Konflikten nicht mehr kompromissbereit. Oft kommt es zu außerehelichen Beziehungen. Die Wahrnehmung einer zunehmenden "emotionalen Scheidung" führt häufig auch zu Versuchen, die Ehe zu retten oder neu zu beleben.
Irgendwann im Verlauf dieses Prozesses beginnt einer der Partner, an eine mögliche Trennung zu denken. Die endgültige Entscheidung hierzu wird in der Regel erst nach einer längeren Zeit der inneren Konflikte, der Ambivalenz und Angst vor der Zukunft gefällt. Dabei wird nur selten gründlich über die Folgen einer Scheidung in finanzieller und emotionaler Hinsicht nachgedacht. Oft diskutieren die Ehepartner über die Möglichkeit einer Trennung oder trennen sich (mehrmals) probehalber. Zumeist wird eine Vielzahl von Gründen für den endgültigen Scheidungsentschluss genannt. So können zum Beispiel das veränderte Verhalten, die Untreue, die psychischen Probleme, der Alkoholmissbrauch oder die Gewalttätigkeit des Partners eine Rolle spielen. Andere Ursachen können die in der Ehe erlebte Einschränkung der Selbstentfaltung, mangelnde Bedürfnisbefriedigung, die Idealisierung anderer Partnerschaften oder die Erwartung von mehr Glück in der Beziehung zu einem anderen Partner sein. Weitere Gründe sind Kommunikationsstörungen, unterschiedliche Werte, ein Auseinanderentwickeln der Partner, unerwartete Schicksalsschläge (Krankheit, Arbeitslosigkeit usw.) oder die Unfähigkeit, den Übergang von einer Phase des Familienzyklus zur nächsten zu bewältigen. Oft versuchen Eltern in der Vorscheidungsphase, Spannungen und Konflikte vor kleineren Kindern geheim zu halten, die von diesen aber dennoch erspürt werden. Können Kinder nicht über ihre Wahrnehmungen sprechen oder wird deren Richtigkeit von den Eltern verneint, beginnen sie, an sich selbst und ihrer Beobachtungsfähigkeit zu zweifeln. In anderen Fällen erleben die Kinder die Auseinandersetzungen ihrer Eltern mit, werden in sie hineingezogen, müssen Partei ergreifen (Loyalitätskonflikte) oder versuchen, durch auffällige Verhaltensweisen von den Ehekonflikten abzulenken. Sie leiden häufig so stark unter dieser Situation, dass es zur Ausbildung von Symptomen kommt.
Die Scheidungsphase beginnt mit der endgültigen Trennung der Ehepartner und endet mit der gerichtlichen Ehelösung. Sie dauert zwischen einem Jahr und mehr als drei Jahren. Von besonderer Bedeutung für die weitere Entwicklung ist die Art und Weise der Trennung - ob sie plötzlich (und für einen Partner überraschend) oder nach langen Auseinandersetzungen, im Streit oder in Übereinstimmung, wegen eines neuen Partners oder aus anderen Gründen erfolgte. Wichtig ist auch, ob das in der Regel vorgeschriebene Trennungsjahr in verschiedenen Wohnungen oder in demselben Haushalt (zum Beispiel aufgrund von Wohnungsnot oder einem sehr geringen Einkommen) verbracht wird. Die im letztgenannten Fall andauernden Spannungen, der stark eingeschränkte Bewegungsraum und das für (Klein-)Kinder nicht nachvollziehbare Verhalten der Eltern können psychisch sehr belastend sein.
Auf eine Trennung reagieren Ehepartner mit höchst unterschiedlichen intensiven Gefühlen: Trauer, Schmerz, Reue, Depression, Wut, Hass, Aggressivität, Verbitterung, Schuldgefühle, Angst vor der Zukunft, Erleichterung, Verwirrung, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung usw. Ihre Empfindungen und inneren Konflikte können so stark sein, dass es zu Verhaltensauffälligkeiten, psychosomatischen Beschwerden, Selbstmordversuchen und der Entwicklung von Symptomen kommt. Vielfach leidet die berufliche Leistungsfähigkeit. Auch wurde ermittelt, dass Personen in dieser Situation häufiger in Unfälle verwickelt sind.
Zumeist berichten der passive Partner und derjenige, der die Trennung initiiert hat, von unterschiedlichen Emotionen; ersterer hat es in der Regel schwerer und benötigt mehr Zeit, um die Sequenz üblicher Reaktionen zu durchlaufen. Aber auch die subjektive Bewertung der Trennung (zum Beispiel als katastrophale Lebenskrise oder als Start in ein neues und sicherlich glücklicheres Leben) ist von großer Bedeutung für die Art und Weise ihrer Bewältigung. Zumeist ist die Trennung schwerer zu verarbeiten, wenn die Ehekrise lange dauerte, wenn sich der Betroffene schuldig am Scheitern seiner Ehe fühlt, wenn er aus religiösen Motiven heraus gegen eine Scheidung ist, wenn er mit niemandem über seine Gefühle sprechen kann oder wenn er emotional instabil ist, ein negatives Selbstbild besitzt oder eine pessimistische Lebenseinstellung hat. Mit größeren psychischen Problemen ist auch zu rechnen, wenn ein Elternteil nach der Trennung für längere Zeit keinen/kaum Zutritt zu seinen Kindern hat. Frauen haben stärker mit der Trennungserfahrung zu kämpfen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt schon älter sind, keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und wenig Berufserfahrung haben, wenn sie sich über die Position ihres Mannes definiert haben und nun einen großen Statusverlust erleben oder wenn sie mit großen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert werden.
Zu großen Problemen können auch die mit einer Trennung verbundenen zeit- und arbeitsaufwendigen Umstellungen führen. So muss sich zumindest ein Partner eine neue Wohnung suchen und diese einrichten, beginnt für viele Frauen die Arbeitsplatzsuche beziehungsweise das Einarbeiten in eine neue Stelle, müssen die Partner ungewohnte Rollen (zum Beispiel als Familienernährer) und Aufgaben (Kochen, Wäschepflege, Kontakt zu Behörden usw.) übernehmen, die zuvor nur der Ehegatte ausgeübt hatte und für die nun die entsprechenden Fähigkeiten fehlen. Auch müssen sie den Lebensstil von Singles wiedererlernen, fängt erneut die Partnersuche an. Überwältigt von diesen Anforderungen, flüchten viele getrennt lebende Personen in neue Beziehungen und Abhängigkeiten, während andere eine "zweite Pubertät" durchleben. Umstellungen gibt es auch im Netzwerk, das sich zumeist nach der Trennung der Ehepartner teilt. Die Partner müssen sich mit den negativen Reaktionen des einen Teils auseinander setzen, während sie von den Mitgliedern des anderen Netzwerkteils psychische und praktische Unterstützung, Hilfe bei der Beaufsichtigung von Kindern, Ratschläge und materielle Leistungen erhalten. In der Folgezeit muss das Netzwerk wieder ausgebaut werden, wobei oft der Kontakt zu anderen Geschiedenen gesucht wird.
Nach der Trennung bestehen zwischen den Partnern weiterhin Kontakte; oft sind sie auch noch lange emotional aufeinander fixiert. Konflikte und Auseinandersetzungen werden häufig durch die Kommunikation über Dritte oder die Einmischung von Verwandten verschärft. Aber auch die Konsultation von Rechtsanwälten kann zu einer Eskalation führen. So verhindern juristische Abläufe vielfach das Gespräch zwischen den Partnern und die selbstbestimmte Einigung, fördern negative Verhaltensweisen (Rache, Betrug usw.), erschweren das Erkennen des eigenen Anteils am Scheitern der Ehe und lassen das Wohl der Kinder aus den Augen verlieren. Vereinzelt kommt es zu Auseinandersetzungen bezüglich des Sorgerechts, wobei sich besonders negativ auswirkt, wenn die Kinder vor Gericht gegen den anderen Elternteil ausgespielt werden oder gegen ihn aussagen sollen.
Zumeist erfolgt aber die Ehelösung einverständlich nach einer mindestens einjährigen Trennungszeit. Etwa 59% der Scheidungsanträge werden von Frauen, 31% von Männern und 10% von beiden Ehepartnern gemeinsam gestellt werden (Weiß 1985). Etwa drei Viertel aller Scheidungen verlaufen ohne Streit vor dem Gericht ab. Auch werden diesem in fast allen Fällen Vereinbarungen über Folgesachen von den Parteien vorgelegt. Hier haben sich also die Ehepartner schon vor der Verhandlung über die Aufteilung des Besitzes, den Unterhalt, das Sorgerecht oder die Umgangsregelungen geeinigt. Das Gericht trifft dann im Scheidungsverfahren die endgültige Entscheidung, wobei es in der Regel getroffene Vereinbarungen bestätigt. Kinder werden auch heute noch zumeist ihrer Mutter zugesprochen - die alleinige Sorge des Vaters, die gemeinsame Sorge (beide geschiedenen Elternteile sind weiterhin rechtlich für ihre Kinder verantwortlich) und die Aufteilung der Kinder zwischen den Eltern kommen nur selten vor.
Es ist offensichtlich, dass in dieser Phase auch die Kinder leiden. Fast alle Kinder sind gegen die Trennung ihrer Eltern und reagieren auf die Abwesenheit eines Elternteils mit Schock, Schmerz, Trauer und Angst. Oft fühlen sie sich von ihm verraten oder befürchten, dass sie ihn nicht wieder sehen werden. Ihr Zorn richtet sich entweder gegen den ausgezogenen ("hat die Familie verlassen") oder den anderen Elternteil ("hat den Partner vertrieben"). Generell sind die Reaktionen von Kindern auf Trennung und Scheidung sehr unterschiedlich und spiegeln ihr Alter und ihre Individualität wider. So besitzen zum Beispiel Kleinkinder noch nicht die intellektuellen Fähigkeiten, mit deren Hilfe die Bedeutung der Trennung ihrer Eltern und die damit verbundenen Veränderungen verstanden werden könnten. Deshalb sind sie vielfach verwirrt und hilflos, verleugnen die Trennung oder leiden unter schrecklichen Phantasien. Sie haben Angst, nicht mehr geliebt und wie der eine Elternteil verlassen zu werden. Aber auch das Sicherheitsgefühl älterer Kinder wird beeinträchtigt. Sie erleben sich häufig als wertlos und ohnmächtig. Oft überfordern sie sich selbst, wenn sie ihren problembeladenen Eltern emotionale Zuwendung und Hilfe bieten oder sie miteinander versöhnen wollen. Sie verbergen manchmal ihre eigenen Gefühle und Probleme, um ihre Eltern nicht noch zusätzlich zu belasten.
Viele Kinder sind nach der Trennung ihrer Eltern aggressiv, gewalttätig und zerstörerisch, während andere mit Rückzug, Depressivität, Verlust an Interessen und Apathie reagieren. Jüngere Kinder entwickeln auch Schuldgefühle, weil sie sich (grundlos) für die Trennung ihrer Eltern verantwortlich halten oder negative Emotionen ihnen gegenüber erleben. Viele Kinder leiden unter starken Loyalitätskonflikten, fühlen sich zwischen beiden Elternteilen hin- und hergerissen. Häufig kommt es zur Ausbildung von Symptomen wie Einnässen, Einkoten, Schlafstörungen, Trennungsangst (anklammerndes Verhalten), Nervosität, Schulprobleme oder andere Verhaltensauffälligkeiten. Sie verschwinden zumeist bald wieder - sind sie aber noch ein Jahr nach der Trennung vorhanden, bleiben sie auch in den folgenden Jahren bestehen.
Jungen und Einzelkinder leiden unter der Scheidung ihrer Eltern zumeist mehr als Mädchen und Kinder mit Geschwistern. Der Verlust fällt auch umso schwerer, je jünger die Kinder sind und je intensiver ihre Beziehung zu dem ausgezogenen Elternteil ist. Die Anpassung an die neue Situation kann ferner durch größere Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder wie Anmeldung in Krippe, Kindergarten beziehungsweise Hort oder Umzug in Verbindung mit Schulwechsel und dem Verlust von Freunden erschwert werden.
Hinzu kommt, dass viele Eltern in dieser Phase des Scheidungszyklus ihren Erziehungsaufgaben nur unzureichend nachkommen. Aufgrund ihres emotionalen Zustandes, der Probleme der Alltagsbewältigung und des oft erfolgenden Wiedereintritts in die Arbeitswelt haben sie nur wenig Zeit für Gespräche und Spiele mit ihren Kindern. Sie kümmern sich nur wenig um sie, mögen sie sogar vernachlässigen und haben Recht wenig Gespür für das, was in ihnen vorgeht. Da sie oft überlastet und übermüdet sind, mögen sie auch ein autoritäreres Erziehungsverhalten als früher zeigen und häufiger von körperlicher Züchtigung Gebrauch machen. Problematisch ist ferner, dass vor allem jüngeren Kindern zumeist weder die Gründe für die Trennung genannt noch Informationen über die Zukunft gegeben werden. Zudem sind die Kinder mehr oder minder plötzlich nicht mehr Mittelpunkt des Familienlebens. In anderen Fällen verwöhnen und überbehüten die Eltern ihre Kinder, da sie befürchten, dass deren Entwicklung durch die Scheidung geschädigt werden könnte.
In dieser Phase des Scheidungszyklus verändern sich abrupt die Eltern-Kind-Beziehungen. So verliert das Kind einen Elternteil als Identifikationsfigur, Freund, Helfer und ausgleichendes Element. Das Verhältnis zu dem anderen Elternteil wird hingegen intensiver und enger. Problematisch ist, wenn dieser erwartet, dass sich das Kind auf seine Seite stellt, ihn tröstet und unterstützt. Oft verbietet der Elternteil ihm, Gefühle des Verlustes, der Trauer, des Schmerzes oder der Sehnsucht nach dem anderen Elternteil zu zeigen. Häufig versucht er auch, Besuchskontakte zu erschweren oder sogar zu unterbinden. Ferner kann sich negativ auswirken, wenn Kinder als Waffe im Scheidungsprozess benutzt, in Konflikte der Eltern hineingezogen, bei beziehungsweise nach Besuchen ausgehorcht oder als Informanten, Nachrichtenkuriere, Mitwisser von Geheimnissen usw. missbraucht werden.
In der Nachscheidungsphase, die etwa ein Jahr dauert, aber auch kürzer oder sehr viel länger sein kann, wird in der Regel das Familiensystem wieder stabilisiert, gewinnen die Familienmitglieder ihr psychisches Gleichgewicht zurück und gewöhnen sich an ihren neuen Lebensstil. Gefühle des Schmerzes, der Trauer, der Rachsucht, des Selbstmitleids, der Angst usw. werden immer schwächer und verschwinden zumeist gänzlich; sie mögen jedoch wieder aufleben, wenn der frühere Partner erneut heiratet oder ein weiteres Kind bekommt. Das Scheitern der Ehe und die Scheidung werden aufgearbeitet und akzeptiert. Auch lösen die Erwachsenen ihr Selbst immer mehr von dem des Expartners ab, bis sie schließlich die "psychische Scheidung" von ihm erreichen. Wenn das neue Leben aber nicht den Erwartungen und Hoffnungen entspricht, wenn sich die Erwachsenen einsam fühlen oder wenn nichtsorgeberechtigte Elternteile starke Sehnsucht nach ihren Kindern empfinden, mögen sie sich jedoch in die geschiedene Ehe zurückwünschen.
Zumeist normalisiert sich in dieser Phase die Beziehung zum Expartner. Es werden kaum noch negative Gefühle ihm gegenüber erlebt. Oft wird ein lockerer Kontakt zu ihm und den früheren Schwiegereltern aufrechterhalten, der aber im Verlauf der Zeit erlöschen kann. Er ist in der Regel stärker ausgeprägt, wenn Kinder vorhanden sind und gemeinsam erzogen werden. Die Gesprächsinhalte sind dann meistens auf Erziehungsfragen beschränkt. In manchen Fällen bestehen aber negative Gefühle gegenüber dem früheren Partner fort und mögen zu neuen Konflikten führen, die oft über die Kinder ausgetragen werden (zum Beispiel Versuch der Unterbindung von Kontakten zu dem nichtsorgeberechtigten Elternteil).
In der Nachscheidungsphase gewinnen die früheren Ehepartner zumeist neue Lebensziele und -inhalte. Sie definieren die durch die Ehe geprägten Identitätsbereiche neu. rauen, die wieder in die Arbeitswelt eingetreten sind, haben nun die meisten Anpassungsschwierigkeiten gemeistert und genießen ihre Unabhängigkeit. Die Erwachsenen gewinnen ihr Selbstvertrauen, ihre Tatkraft und ihr Wohlbefinden zurück, schauen wieder optimistisch in die Zukunft. Sie bauen ein neues Netzwerk auf, sodass Gefühle der Einsamkeit immer mehr schwinden. Auch gehen sie neue Partnerschaften ein, die von kurzfristigen und oberflächlichen Kontakten bis hin zu langfristigen und intimen Beziehungen reichen können. Oft werden zunächst niedrigere Ansprüche an die Partner gestellt, da jede Beziehung besser als die frühere Ehe erscheint und noch negative Selbstwertgefühle vorhanden sind. Auch mag die Angst vor dem erneuten Scheitern in einer Partnerschaft noch stark ausgeprägt sein. Gegen Ende der Nachscheidungsphase sind die meisten Erwachsenen aber für eine längerfristige Beziehung oder eine neue Ehe offen.
Zumeist verbessert sich nun auch das Verhältnis zwischen den sorgeberechtigten Elternteilen und den Kindern, kommt es zu einer intensiveren Kommunikation miteinander. In manchen Fällen haben aber die allein erziehenden Elternteile weiterhin zu wenig Zeit für ihre Kinder und vernachlässigen sie. Sie fühlen sich aufgrund der Belastung durch Beruf, Haushalt und Erziehung überfordert, sind oft gestresst und erschöpft. Vielfach halten sie sich nichtsorgeberechtigten Elternteilen gegenüber für benachteiligt - wobei diese häufig genauso empfinden: Sie vermissen ihre Kinder, fühlen sich als Bittsteller bei der Planung von Besuchen und erleben sich als ohnmächtig, wenn sie Einfluss auf die Erziehung oder den Lebensweg ihrer Kinder zu nehmen versuchen.
Generell lassen sich verschiedene Formen der Beziehung zwischen geschiedenen Eltern und ihren Kindern unterscheiden:
(1) Beide Elternteile erziehen ihre Kinder weiterhin gemeinsam. Sie trennen die aufgelöste Paarbeziehung von der unauflösbaren Eltern-Kind-Beziehung, stimmen ihre Erziehungsmaßnahmen aufeinander ab und respektieren einander als Eltern.
(2) Beide Eltern verbringen etwa gleich viel Zeit mit ihren Kindern, die zumeist nach einem bestimmten Muster zwischen beiden Haushalten wechseln. Die früheren Partner kommunizieren aber nur wenig miteinander und stimmen ihr erzieherisches Verhalten kaum ab. So können die Kinder unterschiedlichen Erziehungsstilen, Regeln und Einflüssen ausgesetzt sein.
(3) Die Kinder leben in der Wohnung des einen Elternteils, besuchen aber den anderen regelmäßig. Sie werden in dessen Haushalt integriert (haben zum Beispiel ein eigenes Zimmer, helfen bei der Hausarbeit usw.). Der Elternteil nimmt ihnen gegenüber noch Erziehungsaufgaben wahr, verhält sich aber zumeist wie ein Freund.
(4) Die Kinder treffen regelmäßig mit dem nichtsorgeberechtigten Elternteil zusammen. Da dieser seine Wohnung aber nicht für Kinder ausgestattet hat, behandelt er sie zumeist als Besucher und verbringt sehr viel Zeit mit ihnen in Parks, auf Spielplätzen, im Zoo, in Restaurants usw. Er kann oft wenig mit den Kindern anfangen und holt manchmal Großeltern oder seinen neuen Partner zur Hilfe. Er ist nicht mehr sozialisierend, erzieherisch oder disziplinierend tätig.
(5) Zwischen Kindern und nichtsorgeberechtigtem Elternteil besteht nur noch ein unregelmäßiger und flüchtiger Kontakt.
(6) Es gibt keine Beziehung mehr zwischen den Kindern und dem nichtsorgeberechtigten Elternteil. Oft wurden Besuche durch frühere oder neue Partner unterbunden.
Generell nimmt der Kontakt zwischen nichtsorgeberechtigten Eltern und ihren Kindern im Verlauf der Zeit ab, wobei etwa zwei Jahre nach der Trennung ein besonders starker Einbruch zu verzeichnen ist.
In der Nachscheidungsphase lassen die zuvor beschriebenen Reaktionen von Kindern auf die Trennung der Eltern in ihrer Intensität nach und verschwinden in der Regel. Die neue Lebenssituation wird zunehmend akzeptiert; die Kinder gewöhnen sich an die beschriebenen Veränderungen und entwickeln sich "normal" weiter. Nur selten kommt es zu einer Chronifizierung von auffälligen Verhaltensweisen und zur Verfestigung von Symptomen. Oft dauert es aber mehrere Jahre, bis die Scheidung der Eltern als endgültig angesehen wird. Selbst nach der Wiederheirat eines Elternteils berichten Kinder noch von Versöhnungsphantasien und von aktiven Versuchen, die geschiedenen Eltern wieder zusammenzuführen.
Generell fällt Kindern die Anpassung an die Nachscheidungssituation leichter, wenn sie in regelmäßigem Kontakt zu dem nichtsorgeberechtigten Elternteil stehen und wenn sich die geschiedenen Partner in Erziehungsfragen einig sind. Bei langen und häufigen Besuchen werden diese als Alltagssituationen erlebt, kann die emotionale Bindung an den abwesenden Elternteil aufrechterhalten werden. Während sich viele Kinder auf Besuche freuen und oft versuchen, deren Ende herauszuzögern, reagieren andere auf negative Weise. Dieses ist vor allem dann der Fall, wenn der sorgeberechtigte Elternteil gegen Besuchskontakte ist, wenn keine Bindung an den anderen Elternteil besteht oder wenn er für die Auflösung der Familie verantwortlich gemacht wird oder mit Kindern nicht umgehen kann. Ältere Kinder mögen auch das Zusammensein mit Freunden derartigen Besuchen vorziehen.
In den vielen Fällen, bei denen einige Zeit nach der Trennung kein oder nur ein unregelmäßiger Kontakt zum nichtsorgeberechtigten Elternteil besteht, leiden Kinder häufig noch lange unter Gefühlen der Trauer, Sehnsucht oder Verärgerung. Sie erleben sich als wertlos, da sie so ohne weiteres verlassen wurden. Kleinere Kinder verleugnen oft den Elternteil und die mit ihm gemachten Erfahrungen. Einige machen ihn zur Negativfigur, während andere ihn idealisieren, sich mit ihm identifizieren sowie seine Eigenschaften und Eigenarten übernehmen. Das Verhalten Letzterer kann zu Konflikten mit dem sorgeberechtigten Elternteil führen und eine Anpassung an (prospektive) Stiefeltern erschweren.
Generell haben viele Kinder in der Nachscheidungssituation Probleme mit den neuen Partnern ihrer Eltern. Dieses ist besonders dann der Fall, wenn Partner häufig gewechselt werden oder eine intensive, längerfristige Beziehung abgebrochen wird. Die neuen beziehungsweise wiederholten Trennungserfahrungen können dazu führen, dass Kinder keine Bindungen mehr eingehen.
Auch mehrere Jahre nach der Trennung ihrer Eltern gewinnen die meisten Kinder der Scheidung immer noch nichts Gutes ab. Sie teilen nur selten die Meinung vieler geschiedener Erwachsener, dass die Auflösung der Familie zu einer positiven Weiterentwicklung geführt habe. Erwachsene, deren Eltern sich während ihrer Kindheit scheiden ließen, scheitern in ihrer eigenen Ehe häufiger als Partner aus Familien, in denen die Eltern zusammenblieben. Hierfür gibt es viele Erklärungen. So wird zum Beispiel postuliert, dass diese Erwachsenen in ihrer Kindheit kein Vorbild für eine positiv gestaltete Ehebeziehung erlebt hätten, aber wüssten, wie man sich aus einer unglücklichen Ehe befreit.
Familien Alleinerziehender
Im Jahr 1988 gab es 817.000 allein erziehende Frauen und 135.000 allein erziehende Männer, die rund l,3Mio. Kinder unter 18 Jahren versorgten. 156.000 Alleinerziehende waren verwitwet, 576.000 lebten von ihren Partnern getrennt oder waren geschieden, 198.000 waren ledig. Die meisten waren nur für ein oder zwei Kinder verantwortlich; 45.000 Mütter und 5.000 Väter erzogen jedoch drei und mehr Kinder (Statistisches Bundesamt 1989). Fast 13% aller Familien sind heute unvollständig; in München und anderen Großstädten sind es schon 20% (Süddeutsche Zeitung vom 17./18.11.1987). Etwa 23% aller Mütter haben mindestens ein Jahr lang ihre Kinder allein erzogen oder tun dieses immer noch (Marbach et al. 1987). Teilfamilien sind also zu einer weit verbreiteten Familienform mit spezifischen Strukturen, Bewältigungsstrategien und Problemen geworden. Sie bilden keine homogene Gruppe, sondern unterscheiden sich zum Beispiel hinsichtlich der Ursachen für die Unvollständigkeit, der finanziellen Lage, der Einstellung von Eltern und Kindern zu ihrer Lebenssituation, der Qualität der Entwicklungsbedingungen usw.
Allein erziehende Männer haben zumeist ein gutes Auskommen, einen hohen sozialen Status und ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Im Vergleich zu allein erziehenden Müttern haben sie es zumeist weniger schwer, einen neuen Partner zu finden. So heiraten sie in der Regel bald wieder oder gründen eine nichteheliche Lebensgemeinschaft - generell wird für Alleinerziehende eine abnehmende Tendenz zur Wiederheirat festgestellt.
Allein erziehende Frauen haben sehr viel häufiger als Männer mit finanziellen Problemen zu kämpfen. So verfügen 1987 32,5% der Alleinerziehenden über ein Nettoeinkommen von 600 bis 1.200DM. Mehr als 228.000 Haushalte Alleinerziehender waren auf Sozialhilfe angewiesen (BT-Drucksache 11/5106). Die materielle Situation allein erziehender Mütter ist besonders schlecht, wenn sie ledig sind, keine Unterhaltsansprüche (geltend gemacht) haben, Unterhaltszahlungen nur unregelmäßig, unvollständig oder mit Unterbrechungen erhalten, arbeitslos sind oder mehrere Kinder zu versorgen haben.
Das niedrige Einkommen vieler allein erziehender Frauen führt dazu, dass sie auf Vorbehalte bei Vermietern stoßen, sich mit kleinen Wohnungen zufrieden geben müssen und diese nur einfach einrichten können, dass sie wenig Ersparnisse für Notfälle haben, sich häufig keine Urlaubsreisen leisten oder ihren Kindern keine kostspielige Ausbildung bieten können. Zumeist haben sie einen niedrigen sozialen Status, insbesondere wenn sie nicht berufstätig sind oder Sozialhilfe erhalten. Viele müssen auch einen Statusverlust verkraften, wenn sie früher mit einem gut verdienenden Partner zusammenlebten. So haben Alleinerziehende häufig ein negatives Selbstbild, entwickeln Minderwertigkeitsgefühle und halten sich Verheirateten gegenüber für benachteiligt. Sie leiden heute wohl weniger unter sozialer Diskriminierung als früher, stoßen aber noch immer auf Vorurteile.
Der Anteil berufstätiger Frauen liegt bei Alleinerziehenden um rund 20% höher als bei verheirateten Frauen (Swientek 1984). Alleinerziehende sind in der Regel vollerwerbstätig, erzielen aber oft nur ein unterdurchschnittliches Einkommen, da sie vielfach keine qualifizierte Ausbildung erhalten oder (nach der Geburt ihrer Kinder) mehrere Jahre lang ihre Berufstätigkeit unterbrochen haben. Häufig fühlen sie sich durch Erwerbstätigkeit, Haushalt und Kindererziehung überlastet. Laut einer für Baden-Württemberg repräsentativen Umfrage (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a) hatten 43% der Alleinerziehenden den Eindruck, dass der häusliche Bereich unter ihrer Berufstätigkeit leide; jede fünfte Befragte fühlte sich dadurch außerordentlich belastet. Laut einer anderen für dieses Bundesland repräsentativen Umfrage (Krüsselberg/Auge/Hilzenbecher 1986) verwenden Alleinerziehende weniger Zeit für Hausarbeit und Kinderbetreuung als (berufstätige) verheiratete Mütter, aber sehr viel mehr Zeit für die eigene Freizeit.
Während manche Alleinerziehende sozial isoliert sind, empfangen andere Unterstützung innerhalb ihres gut funktionierenden und oft sehr großen Netzwerks. Dabei spielen ihre Eltern eine besondere Rolle. Sie bieten nicht nur Hilfe in Notlagen, sondern betreuen auch etwa doppelt so häufig ihre Enkel als bei vollständigen Familien (Bundesregierung 1986a). Da sie oft am Abend einspringen, ermöglichen sie ihren erwachsenen Kindern das Ausgehen. So können viele Alleinerziehende die in ihrem Netzwerk liegenden Möglichkeiten für befriedigende Sozialkontakte, die Partnersuche und die Selbstentfaltung nutzen. In diesen Fällen werden Kinder seltener als Hemmschuh für die eigene Selbstverwirklichung gesehen. Hier wird deutlich, dass es von großer Bedeutung für das Wohlbefinden von Alleinerziehenden ist, ob sie die in ihrer Situation liegenden Chancen wahrnehmen und wie sie diese nutzen.
Teilfamilien sind prinzipiell in ihrer Sozialisationsfunktion nicht defizitär. Viele Alleinerziehende stellen das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt ihres Lebens und kümmern sich intensiv um sie. Manche konzentrieren sich auch auf die Erziehung, um ihre diesbezüglichen Fähigkeiten ihrer sozialen Umwelt oder dem früheren Partner gegenüber zu beweisen. Andere handeln so, weil sie nach der Trennung oder nach dem Tod des anderen Elternteils ihre Kinder zunächst vernachlässigt haben und nun unter Schuldgefühlen leiden. In manchen Fällen entsteht eine sehr enge Mutter-Kind-Beziehung, sind die Mütter sehr fürsorglich und überbehütend. Dieses ist besonders dann der Fall, wenn die Kinder zu Ersatzpartnern gemacht werden und intensive Bedürfnisse nach Zärtlichkeit und Liebe befriedigen sollen oder wenn die Mütter in ihrer Kindheit schmerzhafte Trennungserfahrungen durchlebt haben.
Berufstätigen Alleinerziehenden steht generell nicht weniger Zeit für ihre Kinder zur Verfügung als erwerbstätigen verheirateten Müttern. Für beide Gruppen stellt sich das Problem der Kinderbetreuung in besonderer Schärfe, da es an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen mangelt. Besonders große Schwierigkeiten entstehen auch in den Ferien, bei einer Erkrankung der Kinder oder aufgrund des unregelmäßigen Stundenplans von Grundschülern. So werden Kinder von Alleinerziehenden oft von verschiedenen Personen versorgt (Diskontinuität der Betreuung) oder bleiben längere Zeit ohne Aufsicht ("Schlüsselkinder"). Dementsprechend besteht vielfach die Gefahr der Vernachlässigung.
Insbesondere überlastete und gestresste Alleinerziehende praktizieren häufig einen autoritären Erziehungsstil und machen von Körperstrafen Gebrauch. Ein problematisches Erziehungsverhalten resultiert vielfach aber auch daraus, dass Kinder als Hemmschuh für die eigene Selbstentfaltung erlebt werden oder dass Aggressionen und andere negative Gefühle auf sie übertragen werden, die eigentlich früheren Partnern gelten. Sehr junge ledige Mütter besitzen oft noch nicht die notwendigen Kompetenzen für eine erfolgreiche Erziehung. Sie haben generell bescheidenere Pläne bezüglich des weiteren Lebenswegs ihrer Kinder, zeigen mehr Gleichgültigkeit und Unsicherheit. In Teilfamilien trägt eine Person die alleinige Verantwortung für die Erziehung der Kinder, es mangelt an einem Korrektiv aufgrund des Fehlens eines Partners. Ein gutes Drittel der Alleinerziehenden klagt, dass sich der andere Elternteil überhaupt nicht um sein Kind kümmere; 56% versuchen aber auch, ihn so weit wie möglich aus der Erziehung der Kinder herauszuhalten (Marbach et al. 1987; Wahl/Stich/Seidenspinner 1989).
Da nur ein Rollenmodell in der Familie vorhanden ist, erleben viele Kinder Schwierigkeiten bei der Übernahme der Geschlechtsrollen. Bei Vaterabwesenheit kann sich das Fehlen einer Autoritätsperson beziehungsweise eines Identifikationsobjekts vor allem auf die Entwicklung von Jungen negativ auswirken; so wurden eine geringere Ausprägung der Wettbewerbsorientierung, des Dominanzverhaltens, der Frustrationstoleranz und der Ausdauer sowie schwächere moralische Prinzipien und mehr Verhaltensauffälligkeiten bei ihnen festgestellt als bei Jungen aus vollständigen Familien. Kinder aus Teilfamilien scheinen auch schlechtere Schulleistungen zu erbringen und weniger leistungsfähig zu sein. Ferner wird häufiger von Delinquenz, Selbstmordgefährdung, Depressivität, Persönlichkeitsstörungen und psychischen Konflikten berichtet. Probleme der Kinder können auch aus Unerwünschtheit und Ablehnung durch Dritte (vor allem bei nichtehelicher Geburt), aus eingeengten Entwicklungsmöglichkeiten, symbiotischen Eltern-Kind-Beziehungen, Parentifizierung oder aus negativen Erwartungen von Lehrern und anderen Bezugspersonen (sich selbst erfüllende Prophezeiungen, Stigmatisierung) resultieren.
Stieffamilien
Rund 65% der Geschiedenen heiraten wieder - bei knapp 30% aller Eheschließungen hat zumindest ein Partner eine Scheidung hinter sich. Derzeit leben etwa 1Mio. Kinder in Stieffamilien, also mindestens 8% aller Kinder (Koschorke 1985; Schwarz/Höhn 1985). In zweiten Ehen besteht in der Regel ein größerer Altersunterschied zwischen Mann und Frau als in ersten Ehen. Auch sind die Mütter häufiger berufstätig, sodass die finanzielle Lage zumeist recht gut ist, sofern keine größeren Verpflichtungen gegenüber früheren Partnern und den bei ihnen lebenden Kindern bestehen. Generell ist bei zweiten Ehen das Scheidungsrisiko größer als bei ersten Ehen.
Stieffamilien treten in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen auf: So können sie zum Beispiel nach der Scheidung oder Verwitwung eines oder beider Partner beziehungsweise nach der Geburt eines nichtehelichen Kindes entstehen, mögen ein oder beide Elternteile eigene Kinder in die Ehe einbringen, können gemeinsame Kinder in der Familie leben oder auch nicht. Im Gegensatz zu ersten Familien kommt es in Stieffamilien zu einer Überlagerung verschiedener Phasen des Familien-, Lebens- und Scheidungszyklus. So kann zum Beispiel ein Partner die Nachscheidungsphase bereits durchlaufen haben, während der andere den Tod seines früheren Partners noch nicht verarbeitet hat, können sich die Erwachsenen als Ehegatten in der Phase der "jungen Ehe" und als Eltern in dem Stadium der "Familie mit Schulkindern" befinden, können gleichzeitig Säuglinge und Jugendliche in der Familie leben.
Im Vergleich zu ersten Familien sind bei Stieffamilien auch die Grenzen des Familien- und Verwandtschaftssystems undeutlicher: So kann ein Elternteil starke Bindungen an die bei seinem früheren Partner lebenden Kinder haben und sich ihnen eventuell sogar mehr als den Stiefkindern verpflichtet fühlen, mögen diese häufige Besucher sein und fast wie Familienmitglieder behandelt werden, können noch intensive Kontakte zu geschiedenen Partnern und früheren Schwiegereltern bestehen. Die in der Stieffamilie lebenden Kinder empfinden häufig noch starke Gefühle für den abwesenden Elternteil sowie die Großeltern und besuchen sie regelmäßig. So bestehen vielfach starke Verflechtungen mit anderen Systemen. Aber selbst wenn es keinen Kontakt mehr gibt, können die abwesenden Partner einen starken psychologischen Einfluss auf die Beziehungen in der Stieffamilie ausüben, zum Beispiel als Negativfigur, Idealbild oder Vergleichsmaßstab.
Für Stieffamilien typische Probleme können aus der Überlagerung verschiedener Phasen der genannten Zyklen, die unklaren Grenzen, die Außenbeziehungen und das Nachwirken früherer Partnerschaften resultieren. Hinzu kommt, dass manchmal zweite Ehen aus problematischen Motiven geschlossen werden, also zum Beispiel der Scheidungsbewältigung oder der Flucht aus der belastenden Situation alleiniger Erziehungsverantwortung (unter schlechten materiellen Bedingungen) dienen. Häufig sind nach einer Scheidung auch die Ansprüche an neue Partner recht niedrig, da diese leicht den "schrecklichen" früheren Ehegatten übertreffen können und da Geschiedene sich aufgrund ihres negativen Selbstbildes oft eines besseren Partners nicht für würdig halten. Probleme können ferner daraus entstehen, dass die Scheidung beziehungsweise der Tod des früheren Ehegatten noch nicht verarbeitet wurde oder dass Konflikte aus der ersten Ehe in die zweite hineingetragen werden. Auch besteht die Gefahr der Wiederholung pathogener Beziehungsmuster. Zu negativen Entwicklungen kann es ferner kommen, wenn Probleme verleugnet werden, da die Partner nicht ein weiteres Mal mit ihrer Ehe scheitern wollen.
Schwierigkeiten können außerdem aus dem in der Gesellschaft weit verbreiteten negativen Bild von Stieffamilien (siehe das Märchenmotiv von der "bösen" Stiefmutter) resultieren, das leicht dazu führen kann, dass diese Familienform als defizitär betrachtet wird - obwohl sie ebenfalls gute Entwicklungschancen bieten kann. Hinzu kommt, dass es für Stieffamilien im Vergleich zu ersten Familien kaum eindeutige Normen, Rollenerwartungen und Leitbilder gibt. Ja, es kann geradezu gefährlich sein, wenn sich die Mitglieder am Modell der "Normalfamilie" orientieren, da sie auf diese Weise die beschriebenen Besonderheiten von Stieffamilien ignorieren. Die Erwachsenen sind dann zum Beispiel geneigt, außenstehende Elternteile und Kinder auszugrenzen, eine der Realität entsprechende Identität als Stieffamilie abzulehnen und ihren Status geheim zu halten.
Bei der Entstehung von Stieffamilien muss sich der neue Partner an ein bereits lange bestehendes Elternteil-Kind-Subsystem anschließen, in dem die Beziehungen nach der Scheidung beziehungsweise dem Tod des anderen Elternteils oft sehr eng geworden sind und das eine eigene Geschichte sowie besondere Werte, Regeln und Interaktionsmuster besitzt. Diese Selbstverständlichkeiten werden häufig durch das neue Familienmitglied in Frage gestellt. Dann kommt es zu Konflikten bezüglich der Gestaltung von Innen- und Außenbeziehungen, bis schließlich neue Rollenvorschriften, Regeln und Interaktionsmuster etabliert werden. Dieser Anpassungsprozess ist vielfach sehr langwierig und gelingt oft nicht vollständig: So ist in manchen Stieffamilien die Beziehung zwischen dem leiblichen Elternteil und den Kindern stärker als die Ehedyade oder das Verhältnis zwischen Stiefelternteil und Kindern. In diesen Fällen werden dem Stiefelternteil nur geringe elterliche Rechte eingeräumt, mag er bei Konflikten regelmäßig auf eine Koalition zwischen dem leiblichen Elternteil und den Kindern stoßen. Er kann entweder diese Situation akzeptieren oder versuchen, sie in einem langwierigen Prozess zu verändern. Es ist offensichtlich, dass es zu ähnlichen Problemen der wechselseitigen Anpassung kommen kann, wenn beide Partner eigene Kinder in die Stieffamilie einbringen und zwei Systeme mit komplexen Netzwerken und verschiedenen Erfahrungshintergründen miteinander verknüpft werden müssen. Hier dauert es oft besonders lange, bis sich ein starkes Ehesubsystem ausdifferenziert und sich die Mitglieder als eine Familie erleben.
Für Stiefmütter kann sich eine besonders schwierige Situation ergeben, wenn sie plötzlich die Verantwortung für den Haushalt und die Kindererziehung übernehmen müssen, obwohl sie bisher kaum Erfahrungen auf diesen Gebieten gesammelt haben. Aber auch für Stiefväter ist die Übernahme von Erziehungsaufgaben eine problematische Angelegenheit. So müssen sich Stiefeltern mit unrealistisch hohen Erwartungen auseinander setzen - zum Beispiel glauben viele, dass sie umgehend ihre Stiefkinder lieben werden und bei ihnen sofort mit Liebe, Respekt und Gehorsam rechnen können. Oft wollen sie ideale Elternteile werden, welche die Stiefkinder für alle Belastungen der vorausgegangenen Jahre entschädigen und sie glücklich machen. Manche Stiefeltern leiden unter starken Misserfolgsängsten und befürchten, dass ihre Erziehungsbemühungen mehr durch Dritte kritisiert werden als diejenigen leiblicher Eltern. Auch erhalten sie in der Regel weniger Unterstützung durch ihr Netzwerk.
Hinzu kommt eine große Rollenunsicherheit, da es für Stiefeltern keine Rollenmodelle, Leitbilder und Verhaltensnormen gibt. Zudem sind sie für Stiefkinder rechtlich nicht verantwortlich, werden also zum Beispiel von Erziehern und Lehrern nicht voll anerkannt. Ist ihr Partner geschieden, müssen sie die Elternrolle mit dem außenstehenden leiblichen Elternteil teilen, den sie oft als Konkurrenten erleben und aus der Zuneigung der Kinder auszuschließen versuchen - wobei derartige Bestrebungen natürlich auch von der anderen Seite ausgehen können. Aufgrund dieser Situation ist es nicht verwunderlich, dass Stiefeltern ihre Rolle auf höchst unterschiedliche Weise ausgestalten: Sie können für ihre Kinder zum Beispiel wie ein leiblicher Elternteil, ein Freund, ein distanzierter Vertrauter, ein "Onkel" oder ein Außenseiter sein.
Viele Kinder lehnen die Stiefeltern zunächst ab - insbesondere, wenn sie noch auf eine Versöhnung ihrer geschiedenen Eltern hoffen, den Abbruch der Beziehung zu dem außenstehenden leiblichen Elternteil befürchten oder (zum Beispiel aufgrund der Konkurrenz zwischen diesem und dem Stiefelternteil) starke Loyalitätskonflikte erleben. Hinzu kommt, dass sie sich oft ausgeschlossen und abgelehnt fühlen, da sich viele Partner zunächst auf die Paarbeziehung konzentrieren und damit den Kindern eine erneute Verlusterfahrung bereiten. Diese ist besonders stark, wenn die Kinder zuvor eine enge Beziehung zu dem allein erziehenden Elternteil entwickelt haben oder wenn ihnen zum Beispiel aufgrund von Parentifizierung oder Ersatzpartnerschaft eine große Selbständigkeit und viele Rechte zugestanden wurden. Auch erleben sie es als unakzeptable Zumutung, wenn von ihnen verlangt wird, den Stiefelternteil wie einen leiblichen Elternteil zu behandeln. In diesen Fällen versuchen viele Kinder, die Paarbeziehung zum Scheitern zu bringen. Sie mögen feindselig und widerspenstig sein, den Stiefelternteil provozieren oder verleumden, seine Annäherungs- und Erziehungsversuche ablehnen, sich zurückziehen oder Symptome entwickeln. Zumeist dauert es lange, bis Kinder ihre Stiefeltern tolerieren, wobei dieser Anpassungsprozess Jungen und älteren Kindern schwerer fällt als Mädchen und jüngeren Kindern. In der Regel muss sich erst eine tiefere Beziehung entwickelt haben, bevor sie die Erziehungsmaßnahmen von Stiefeltern akzeptieren. Aber noch lange nach der Wiederheirat können sie engere Bindungen zu dem leiblichen Elternteil empfinden und bei Konflikten mit ihm Bündnisse eingehen. Bringt der Stiefelternteil eigene Kinder in die Ehe ein, sind die wechselseitigen Anpassungsprozesse noch komplizierter. So fühlen sich viele Kinder verraten und reagieren mit Eifersuchtsszenen oder Verhaltensauffälligkeiten, wenn ihre leiblichen Eltern eine positive Beziehung zu Stiefgeschwistern entwickeln. Die Kinder erleben einander als Rivalen und reagieren ablehnend und feindselig aufeinander. Sie können aber auch sexuelle Anziehungskraft verspüren - in Stieffamilien sind die sexuellen Schranken generell weniger stark ausgeprägt als in ersten Familien. Zeugen die Eltern ein weiteres Kind, reagieren die Halbgeschwister oft erneut mit Verhaltensauffälligkeiten, da sie in dieser Situation große Ängste entwickeln und befürchten, von ihren Eltern nun weniger geliebt zu werden. Wenn die Anpassungsprozesse in der Gründungsphase einer Stieffamilie gelingen, verläuft die Entwicklung der Kinder zumeist besser als die Entwicklung von Kindern in Teilfamilien, aber etwas schlechter als in ersten Familien.
Familien mit besonderen Belastungen
Familie und Arbeitslosigkeit
Im Jahr 1988 gab es 2.099.638 Arbeitslose, von denen rund 12% Ausländer waren. Fast ein Drittel war bereits ein Jahr und länger arbeitslos (Statistisches Bundesamt 1989). Generell müssen verschiedene Gruppen von Arbeitslosen und ihren Familien unterschieden werden. So sind die negativen Folgen von Arbeitslosigkeit zum Beispiel besonders groß, wenn beide Ehepartner, der einzige Ernährer der Familie oder ein allein erziehender Elternteil davon betroffen sind, wenn eine besonders große Familie zu versorgen ist oder wenn eine Person länger als ein Jahr ohne Arbeit ist. Die Belastungen sind aber auch für viele junge Familien sehr groß, da sie hohe Ausgaben (insbesondere wenn sie Wohnungseigentum erworben haben) und oft nur geringe Ersparnisse haben.
Arbeitslosigkeit führt fast immer zu einer Verschlechterung der materiellen Situation einer Familie. Dieses ist besonders dann der Fall, wenn keine oder nur niedrige Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung bestehen. So haben in den letzten Jahren immer weniger Arbeitslose das höhere Arbeitslosengeld bezogen und mussten sich immer mehr mit der niedrigeren Arbeitslosenhilfe zufrieden geben: Während zum Beispiel 1981 noch 55% aller Arbeitslosen Arbeitslosengeld empfingen, waren es 1985 nur noch 36% - 37% (5% mehr als 1981) erhielten überhaupt keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. So ist nicht verwunderlich, dass im Jahr 1987 mehr als 438.000 Haushalte Sozialhilfe wegen Verlust des Arbeitsplatzes empfingen (Conen 1989).
Das verminderte Haushaltseinkommen führt natürlich auch zu Einschränkungen im Familienbudget. So kommt es häufig zu einer Verschlechterung von Kleidung und Ernährung, sind viele Freizeitaktivitäten nicht mehr finanzierbar, muss oft auf eine Urlaubsreise verzichtet werden. Sind die materiellen Ressourcen aufgebraucht, muss vielfach ein Teil des Eigentums veräußert werden. Kann die Familie ihre Wohnung nicht mehr finanzieren, muss sie in eine preiswertere umziehen oder wird im Extremfall sogar obdachlos. Die mit andauernder Arbeitslosigkeit zunehmende Verarmung kann zu sozialem Abstieg und unter Umständen zum Abgleiten in gesellschaftliche Randständigkeit führen.
Jedoch sind für die meisten Arbeitslosen die finanziellen Probleme leichter zu bewältigen als die psychosozialen Belastungen. So werden sie aus gewohnten Zeitstrukturen herausgerissen, haben keinen Feierabend und kein wirkliches Wochenende mehr (Entrhythmisierung des Tages und der Woche). Zumeist wissen sie nicht, wie sie die ihnen nun zur Verfügung stehende Zeit auf sinnvolle und befriedigende Weise verbringen können. Einige entwickeln neue Hobbys oder nutzen Weiterbildungsmöglichkeiten beziehungsweise Angebote von Kirchen, Verbänden und staatlichen Organisationen. Die meisten wissen aber nicht, wie sie die Zeit verbringen sollen, leiden unter Nichtstun und klagen über Langeweile. In der Regel kommt es zu einem gesteigerten Medienkonsum. Vor allem verheiratete Männer empfinden Arbeitslosigkeit als Zerstörung ihrer Identität als Ernährer ihrer Familie. Sie erleben oft einen Autoritäts- und Bedeutungsverlust als Ehepartner und Elternteil.
Generell tendieren Arbeitslose dazu, sich überflüssig zu fühlen, einen Mangel an Lebenssinn zu verspüren und ein negatives Selbstbild zu entwickeln. Sie machen sich häufig für ihre Situation verantwortlich und zweifeln an sich selbst. Da sie ihr weiteres Leben nicht mehr planen können, fühlen sie sich hilflos und ihrem Schicksal ausgeliefert. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit wird ihre Grundstimmung immer negativer, verlieren sie die Hoffnung auf Besserung ihrer Situation, werden sie immer passiver, unzufriedener und verbitterter. Oft werden sie depressiv oder alkoholkrank, wobei Alkoholmissbrauch vielfach mit erhöhter Streitlust, Aggressivität und Gewaltanwendung in der Familie verbunden ist. Auch verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand, sind sie häufiger krank. Obwohl Arbeitslose heute weniger stigmatisiert werden als in den 60er und 70er-Jahren, erleben sie weiterhin Vorurteile, Diskriminierung und eine Beeinträchtigung ihrer sozialen Beziehungen. So nimmt vor allem der Kontakt zu früheren Kollegen bald ab. Vereinzelt kommt es aber auch zur Selbstisolation. Anzumerken ist noch, dass die Stärke der beschriebenen psychosozialen Belastungen und anderen von der Dauer der Arbeitslosigkeit und der subjektiven Einschätzung der eigenen Chancen am Arbeitsmarkt abhängig ist.
Die Arbeitslosigkeit eines Elternteils führt auch zu Veränderungen in der Familie. So mag ein arbeitsloser Vater seine Frau im Haushalt oder bei der Kindererziehung entlasten, können seine Kinder für ihn eine neue Bedeutung erlangen (zum Beispiel als Sinn des Lebens). Viele arbeitslose Männer nutzen jedoch ihre freie Zeit nicht für Familientätigkeiten. Oft erleben sie eine Verschiebung familialer Macht hin zur Seite ihrer Frau, insbesondere wenn diese die Ernährung der Familie übernimmt. Für viele Familienmitglieder bedeutet die ständige Anwesenheit des arbeitslosen Vaters auch eine ungewohnte Kontrolle; die daraus resultierenden psychischen Belastungen können sich zum Beispiel in Konflikten äußern. So kommt es vielfach zu einer Verschlechterung familialer Kommunikation, zu häufigen Auseinandersetzungen (unter Umständen mit Gewaltanwendung) und zu einer Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens aller Familienmitglieder. Ferner nimmt die Scheidungsgefahr zu. Auch mag sich die Familie aus Angst vor Stigmatisierung nach außen hin abschotten beziehungsweise in soziale Isolation geraten. Generell bestimmt die vor Eintritt der Arbeitslosigkeit vorhandene Qualität des Familienlebens weitgehend darüber, ob und wie eine Familie die Arbeitslosigkeit eines Elternteils und deren Folgen bewältigt.
Im Jahr 1984 lebten rund 1,3 Mio. Kinder in Haushalten Arbeitsloser, also etwa 6,7% aller Kinder. Längerfristig Arbeitslose und Arbeitslosenhilfeempfänger haben sogar überdurchschnittlich viele Kinder (Zenke/Ludwig 1985c). Aufgrund der zuvor beschriebenen Umstände sind ihre Eltern oft wenig ansprechbar, kommt es häufig zu einer Vernachlässigung der Erziehung. Auch verschlechtert sich vielfach die Beziehung zum arbeitslosen Elternteil (Entfremdung, Konflikte usw.). Die Eltern zeigen weniger Interesse an der Schul- und Berufsausbildung ihrer Kinder, motivieren sie weniger und investieren weniger in ihre Bildung als vor Eintritt der Arbeitslosigkeit. Auch stellen sie oft den Kontakt zu Kindergarten und Schule ein. Bei Verhaltens- und Lernstörungen ihrer Kinder zeigen sie wenig Bereitschaft, mit Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten.
Aufgrund der finanziellen Situation müssen Kinder oft Abstriche beim Taschengeld hinnehmen oder auf dieses ganz verzichten. Sie dürfen nicht mehr zu Kindergeburtstagsfeiern, auf Klassenfahrt, ins Kino oder in den Zoo. Auch können sie bezüglich Kleidung und Freizeitausgaben nicht mit Gleichaltrigen mithalten, was vor allem in der Pubertät ein Problem sein kann. Oft schämen sie sich ihrer Eltern und fürchten den Spott ihrer Klassenkameraden.
Mit der Zeit büßen viele Kinder das Gefühl der Geborgenheit ein, entwickeln immer stärker werdende Ängste vor der Zukunft und resignieren zunehmend. Bei einigen Kindern kommt es zu einem Anstieg der Leistungsmotivation, zu einer Verbesserung der häuslichen Lernvoraussetzungen und einer Leistungssteigerung. Zumeist wird aber ein Motivationszerfall, ein sich verschlechternder mündlicher Sprachgebrauch und ein Rückgang der Schulleistungen festgestellt. Auch wechseln Kinder arbeitsloser Eltern seltener an weiterführende Schulen. Da ihnen oft eine größere Selbständigkeit eingeräumt wird, lösen sie sich vielfach schon früh von ihrer Herkunftsfamilie ab. Wenn sich die Familiensituation aufgrund der Arbeitslosigkeit sehr verschlechtert hat, flüchten aber auch viele ältere Kinder aus ihrer Familie. Werden die Familienverhältnisse als sehr belastend erlebt, zeigt sich das Leiden der Kinder häufig in psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten, in psychosomatischen Erkrankungen, Bettnässen, Schlafstörungen, Stottern, Aggressivität, Konzentrationsstörungen, Suchtmittelmissbrauch usw. Generell reagieren Mädchen stärker auf die Arbeitslosigkeit ihrer Eltern als Jungen (Hornstein/Lüders 1987).
Familie und Armut
Zu den Armen unserer Gesellschaft werden in erster Linie die Sozialhilfeempfänger gerechnet. In den letzten Jahren stieg die Zahl der Sozialhilfefälle von rund 2,8 Mio. im Jahr 1985 auf etwa 3,3 Mio. im Jahr 1990. Knapp 5% der Bevölkerung sind Sozialhilfeempfänger. Während 1984 erst knapp 21 Mrd. DM für Sozialhilfe ausgegeben wurden, waren es 1990 schon mehr als 34 Mrd. DM. Jedoch ist die Zahl der Armen größer als die der Sozialhilfeempfänger. So gibt es viele Anspruchsberechtigte, die Leistungen der Sozialhilfe nicht beantragen, weil sie uninformiert sind, den Kontakt zu Behörden scheuen (Schwellenangst) oder Diskriminierungen befürchten. Manche verzichten auch aus Stolz oder Scham auf staatliche Leistungen und versuchen, so lange wie möglich sich selbst zu helfen. Noch größer wird das Ausmaß der Armut, wenn man zu der Zahl der Sozialhilfeempfänger und der "verdeckt Armen" noch die Zahl der "relativ Armen" rechnet, also die Personen, deren Einkommen vom Durchschnittseinkommen um mehr als 50% nach unten abweicht.
Bei den Armen unserer Gesellschaft handelt es sich also nicht um eine homogene Schicht. Sie umfasst Untergruppen (jeweils mit besonders niedrigem Einkommen) wie zum Beispiel Dauerarbeitslose (diese bilden bereits rund ein Drittel aller Sozialhilfeempfänger), ältere Menschen (vor allem unverheiratete Rentnerinnen oder Witwen ohne eigene Rente), nichterwerbstätige oder nur halbtags beschäftigte Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Strafentlassene, Kranke oder Behinderte.
Arme Familien müssen nahezu das gesamte Haushaltseinkommen zur Befriedigung der Grundbedürfnisse ausgeben. Oft wird die materielle Notlage noch durch Überschuldung und eine planlose Wirtschaftsweise verschlimmert (zum Beispiel Impulskäufe; der größte Teil des Einkommens wird zu Beginn des Monats ausgegeben). Arme Familien geraten häufig in Wohnungsnot, da sie höhere Mieten nicht zahlen können, vielfach mit Mietzahlungen in Rückstand geraten oder aufgrund auffälliger Verhaltensweisen (zum Beispiel Alkoholmissbrauch, Gewalttätigkeit, Lärm) eine Kündigung ihres Mietvertrages hinnehmen müssen. Zudem werden bei der Vergabe von Sozialwohnungen "normale" Bewerber gegenüber Sozialhilfeempfängern und Randgruppenangehörigen bevorzugt. So werden arme Familien oft in nicht sanierte Altstadtviertel und andere Ghettos abgedrängt, in denen sie isoliert und anonym sind. Durch die Konzentration auf bestimmte Stadtteile wird zudem die Randgruppenbildung gefördert, werden Kinder und Jugendliche stärker negativen Einflüssen ausgesetzt. Mehrere hunderttausend Menschen leben auch in Obdachlosensiedlungen und Notunterkünften; mehr als die Hälfte von ihnen ist unter 18 Jahre alt. Zumeist wohnen sie mehrere Jahre in diesen Unterkünften, wobei etwa doppelt so viele Personen auf der gleichen Fläche wie in Sozialwohnungen hausen. Notunterkünfte sind zudem schlecht ausgestattet, bieten wenig Möglichkeiten zu einer Kosten sparenden Vorratshaltung und lassen oft hinsichtlich der Hygiene zu wünschen übrig.
Auf dem Land leben arme Familien eher in einem eigenen Haus oder müssen nur niedrige Mieten bezahlen. Ihre Wohnungen sind aber häufig renovierungsbedürftig (zum Beispiel undichte Türen und Fenster), haben eine ungenügende sanitäre Ausstattung und können nur schlecht beheizt werden. Gegenüber armen Familien in der Stadt haben solche auf dem Land häufiger unbare Einkünfte wie Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Sie sind oft auch besser in ihrer Gemeinde integriert, gehören vielfach Vereinen an und haben gute Kontakte zu Nachbarn. Die Beziehung zu Verwandten ist zumeist gut, sofern diese in der Nähe wohnen. Bei größeren Entfernungen scheitern Kontakte jedoch oft an den Fahrtkosten. Aber auch auf dem Land sind viele arme Familien isoliert. In diesen Fällen werden zumeist einige Familienmitglieder wegen Verwahrlosung, Alkoholmissbrauch, psychischen Störungen usw. abgelehnt. In der Stadt werden arme Familien vor allem dann diskriminiert, wenn sie in Obdachlosensiedlungen, Notunterkünften oder Ghettos leben. Oft ziehen sie sich aber auch bewusst von Freunden und Bekannten zurück, wenn sie mit diesen hinsichtlich ihrer Konsumgewohnheiten nicht mehr mithalten können. Zudem werden die Unterstützung und das Verständnis von Verwandten und anderen Netzwerkmitgliedern mit zunehmender Dauer von Notlagen geringer.
Armut wird zumeist als persönliches Versagen begriffen. Die erwachsenen Familienmitglieder reagieren auf ihre Lebenssituation vielfach mit Resignation, Gleichgültigkeit und Apathie, mit Depressivität oder Aggressivität. Sie entwickeln ein negatives Selbstbild, haben wenig Selbstrespekt, sind demotiviert, fühlen sich ohnmächtig und hilflos. Oft kommt es zu Alkohol- und Drogenmissbrauch, Gewaltanwendung und Kriminalität. Viele Partnerprobleme resultieren aus dieser Lebenssituation und können zur Scheidung führen. So leiden die meisten armen Familien unter einer Vielzahl von materiellen, psychischen, gesundheitlichen und anderen Belastungen ("Multiproblemfamilien"). Vielfach ist es ihnen kaum noch möglich, sich aus eigenen Kräften aus ihrer Lage zu befreien. Sie bitten zumeist aber erst dann um öffentliche Unterstützung, wenn sie bereits alle privaten Ressourcen und Hilfsquellen ausgenutzt haben, die Vielzahl ihrer Probleme nicht mehr bewältigen können und vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Manche Familien werden dann von sozialen Diensten abhängig. Sie geraten unter die Kontrolle von Sozialarbeitern und verlieren an Selbständigkeit.
Kinder aus armen Familien unterliegen oft einem sprunghaften Erziehungsverhalten ihrer Eltern, die zwischen Verwöhnung und harter Bestrafung wechseln. Häufig mangelt es ihnen an emotionaler Sicherheit, werden sie vernachlässigt. Aufgrund der ungenügenden kognitiven und sozialen Stimulation, der unzureichenden Motivierung und der fehlenden elterlichen Unterstützung bei Hausaufgaben ist bei vielen Kindern die Leistungsmotivation nur schwach ausgeprägt, sind ihre Schulleistungen unterdurchschnittlich. Sie sind unter Sonderschülern überrepräsentiert und erreichen nur selten einen qualifizierten Berufsabschluss. Auch begegnen ihnen manche Lehrer (und Arbeitgeber) mit Vorurteilen und negativen Erwartungen. So haben diese Kinder nur schlechte Lebenschancen. Oft leiden sie unter Fehlernährung, chronischen Gesundheitsproblemen und Entwicklungsstörungen, haben nur wenig Selbstvertrauen und schätzen sich selbst negativ ein. Aufgrund ihres Verhaltens, häufig aber auch wegen ihrer mangelnden Körper- und Kleiderpflege, werden sie vielfach von Gleichaltrigen abgelehnt und diskriminiert. In vielen Fällen kommt es zur Entwicklung von Verhaltensstörungen, zu Suchtmittelmissbrauch und Delinquenz.
Mehrkinderfamilien
Die Zahl von Mehrkinderfamilien hat im Verlauf der vergangenen zwei, drei Jahrzehnte immer mehr abgenommen. Im Jahr 1988 gab es nur noch 600.000 Haushalte mit drei und 156.000 Haushalte mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren (Statistisches Bundesamt 1989). Vier und mehr Kinder wachsen zu knapp 50% in Arbeiterfamilien auf. Aber auch Familien von Selbständigen sind überdurchschnittlich oft vertreten, solche von Beamten und Angestellten sind hingegen unterrepräsentiert (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 1980). Generell ist das Pro-Kopf-Einkommen in Mehrkinderfamilien sehr niedrig, liegt das Haushaltseinkommen vielfach nur knapp über der Sozialhilfeschwelle. Hier wirkt sich auch negativ aus, dass derartige Familien nur unzureichend vom Staat finanziell unterstützt werden. Die materiellen Belastungen sind in der Familiengründungsphase besonders hoch, da die erwerbstätigen Familienmitglieder noch am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen und erst ein geringes Einkommen erzielen. Bei finanziellen Schwierigkeiten sind die Ehefrauen oft gezwungen, einen Beruf auszuüben; so sind zum Beispiel noch über 30% der Mütter mit drei Kindern unter 15 Jahren erwerbstätig (Schwarz/Höhn 1985).
Da es an großen und zugleich kostengünstigen Wohnungen in den meisten Gemeinden mangelt und Mehrkinderfamilien bei Vermietern häufig auf Vorbehalte stoßen, müssen sie sich oft mit teuren und zu kleinen Appartements abfinden oder Wohnungseigentum erwerben. So ist vielfach die Belastung durch Miete oder durch die Finanzierung eines Eigenheims sehr hoch. In solchen Fällen steht besonders wenig Geld für Freizeit, Urlaub und Bildung zur Verfügung. Billigere Wohnungen sind meist klein, sodass es an Rückzugsmöglichkeiten und an Gelegenheiten für ein ungestörtes Lernen oder für getrennte Aktivitäten von Eltern und Kindern mangelt. Die Erwachsenen müssen oft in Spiele eingreifen sowie reglementierend und disziplinierend tätig werden. Vielfach sind Familienmitglieder aufgrund der beengten Wohnsituation nervös und gereizt.
In vielen großen Familien kümmern sich viele Eltern intensiv um ihre Kinder, denen sie große Mitspracherechte einräumen. Sie verbringen einen Großteil ihrer Freizeit gemeinsam und gestalten diese auf aktive Weise - sie machen Spaziergänge, wandern, fahren Rad, gehen Schwimmen, unternehmen Ausflüge usw. In anderen Mehrkinderfamilien - vor allem wenn die Mütter erwerbstätig sind - mangelt es den Eltern aber an Zeit für ihre Kinder. Diese lernen schon früh, dass sie die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Erwachsenen mit ihren Geschwistern teilen müssen. Oft sind ihre Eltern physisch und psychisch überlastet, da sie kaum Zeit zur Erholung haben und voll von ihren Kindern in Anspruch genommen werden. Dieses gilt besonders für den Fall sehr kurzer Geburtenabstände, da dann zunächst mehrere Kleinkinder unter hohem Zeitaufwand zu versorgen sind. Aber auch bei großen Geburtenabständen ist die Belastung sehr hoch, da jedes Kind die für sein Alter typische Betreuung benötigt und aufgrund der Altersunterschiede für seine Geschwister nur wenig als Spielkamerad geeignet ist. In Mehrkinderfamilien sind die Kinder zumeist nicht einseitig auf erwachsene Bezugspersonen ausgerichtet, da sie enge Beziehungen zu ihren Geschwistern eingehen. Diese spielen eine große Rolle im Sozialisationsprozess. Sie bieten kognitive Anregungen und erweiterte Sozialerfahrungen; im Zusammensein mit ihnen lernen Kinder sowohl Rücksichtnahme als auch Durchsetzungsfähigkeit.
Familien mit behinderten Mitgliedern
Im Jahr 1985 waren 5,37 Mio. Personen schwer behindert, also rund 9% der Bevölkerung. Von ihnen waren 29,7% 55 bis 64 und 43,8% über 65 Jahre alt; nur 4,4% waren unter 25 Jahre alt (Statistisches Bundesamt 1987a). Das bedeutet, dass in den meisten Fällen eine Behinderung erst im späten Erwachsenenalter auftritt - vielfach erst nach Eintritt in den Ruhestand. Generell sind große Unterschiede zwischen Behinderten je nach Behinderungsart festzustellen: Ihre Selbständigkeit und die beruflich nutzbaren Fähigkeiten der betroffenen Personen sind mehr oder minder stark eingeschränkt. Tritt eine Behinderung im Erwachsenenalter ein, kann diese Person häufig den erlernten Beruf weiter ausüben. Ist dies nicht möglich und können Umschulungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, wird sie arbeitslos. In manchen Fällen werden Behinderte pflegebedürftig und müssen von Verwandten (oder in sozialen Einrichtungen) betreut werden.
In diesem Abschnitt sollen in erster Linie die Lebenssituationen von Familien mit behinderten Kindern angesprochen werden. Zwischen 3 und 4% aller Kinder werden mit Behinderungen oder perinatal begründeten Anomalien geboren. Für Eltern ist ihre Geburt ein großer Schock. Dieser wird noch häufig dadurch verstärkt, dass viele Ärzte nicht in der Lage sind, die Nachricht auf taktvolle und schonende Weise zu übermitteln. Sie beschränken sich zudem in der Regel auf medizinische Aspekte, lassen die Eltern also in ihrer Not allein. Ferner können sie nach der Geburt oft nur unzureichende Informationen über Art und Ausmaß der Behinderung geben. So kommt es zumeist zu einer großen Familienkrise, die zumeist in Phasen verläuft:
(1) Die Familienmitglieder fühlen sich in ihrer gesamten Existenz und in ihren Zukunftshoffnungen bedroht, reagieren mit tiefer Erschütterung, Verzweiflung, Trauer und Angst. Viele Eltern betrachten sich als verantwortlich für die Behinderung ihres Kindes, sehen sie als "Strafe für ihre Sünden" an oder machen einander Vorwürfe. Manchmal kommt es zu psychosomatischen Reaktionen oder Selbstmordgedanken.
(2) In der Regel leugnen Eltern zunächst die Behinderung ihres Kindes.
(3) Dann lehnen sie sich gegen ihr Schicksal auf, wollen den Tod ihres Kindes und reagieren auf diesen Wunsch mit starken Schuldgefühlen.
(4) Später versuchen sie, mit dem Schicksal zu verhandeln, konsultieren zum Beispiel mehrere Ärzte, beten zu Gott, nehmen an religiösen Zeremonien teil.
(5) Schließlich akzeptieren sie ihr Schicksal und bewältigen die Krise auf eher negative oder eher positive Weise: Sie lehnen das Kind entweder ab und versuchen beispielsweise, es in einem Heim unterzubringen, oder sie nehmen es an und ändern ihren Lebensplan. Aber auch im letztgenannten Fall kann es lange dauern, bis sie sich nicht mehr von ihrem Kind abgestoßen fühlen und eine positive Haltung ihm gegenüber einnehmen.
Eltern behandeln behinderte Kinder entweder eher wie "normale" oder wie besondere Kinder. Häufig ist das Familienleben um das behinderte Kind herum zentriert. Da die Früherziehung von großer Bedeutung für seine weitere Entwicklung ist - je früher eine Förderung einsetzt und je intensiver sie ist, umso größer ist in der Regel der Erfolg -, entwickeln viele Eltern in diesem Bereich eine große Geschäftigkeit. Sie verbringen mehrere Stunden täglich mit therapeutischen Maßnahmen, bieten dem Kind bestimmte Entwicklungsanreize und die von ihm benötigte besondere Beziehungsqualität (zum Beispiel viel Aufmerksamkeit und Zuwendung). Durch strapazierende Übungen, eine strenge Diät, das Bestehen auf penetranter Sauberkeit und Ordnung sowie die Mechanisierung der Eltern-Kind-Beziehung reagieren aber auch manche ihre Aggressionen gegenüber dem Kind ab.
Viele Eltern erleben Schwierigkeiten, wenn sie eine gründliche ärztliche und pädagogische Beratung oder eine finanzielle Unterstützung erhalten wollen. So beschränken manche Ärzte die medizinische Betreuung nach der Diagnose der Behinderung auf die Verordnung von Medikamenten und auf die Hilfe in akuten Notlagen. Vor allem auf dem Land und in kleineren Gemeinden ist es schwer, Informationen über eine der Behinderung angemessene Erziehung einzuholen. Derartige Hinweise können vielfach nur von Behindertenorganisationen erhalten werden. Außerdem mangelt es an Betreuungs- und Fördermöglichkeiten - aber auch in vielen Städten ist das Netz ambulanter Hilfsdienste nur unzureichend ausgebaut. Hinzu kommt, dass manche Eltern in Auseinandersetzungen mit Vertretern von Behörden und Sozialversicherungen verwickelt werden, wenn sie eine finanzielle Unterstützung oder die Übernahme der Kosten für Krankengymnastik, heilpädagogische Maßnahmen u. Ä. beantragen. Auch gewinnen sie bisweilen bei Sozialämtern den Eindruck, dass sie mit Asozialen und anderen Randgruppen gleichgestellt werden.
Der hohe Zeitaufwand für die Versorgung und Betreuung behinderter Kinder - insbesondere wenn diese pflegebedürftig sind oder nicht alleingelassen werden dürfen - führt oft zu einer starken physischen und psychischen Belastung der Mütter, die in der Regel die Erziehung übernehmen. Sie müssen eine Vielzahl ihrer Bedürfnisse zurückstellen, wichtige Lebensziele aufgeben und auf viele Möglichkeiten der eigenen Selbstverwirklichung verzichten. Häufig verfügen sie über wenig Freizeit, finden nur noch wenig Gelegenheit zur Entspannung und Regeneration, können den Kontakt zu Freunden und Bekannten nicht mehr pflegen und fühlen sich aus diesem Grunde einsam und isoliert. Hinzu kommt, dass sie meistens ihre Berufstätigkeit und die damit verbundenen Befriedigungen aufgeben müssen. Dieses kann auch zu finanziellen Belastungen für die Familie führen, die durch öffentliche Leistungen nur ansatzweise kompensiert werden. Hier wirkt sich negativ aus, dass eine Pflege- und Betreuungstätigkeit in der Familie nicht als Lohnarbeit bezahlt wird und zum Beispiel bei der Berechnung einer späteren Rente nur unzureichend Berücksichtigung findet.
In vielen Fällen kommt es zu einer stark ausgeprägten Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, sodass die Mütter bei der Betreuung des behinderten Kindes, im Haushalt und bei der Erziehung anderer Kinder kaum von ihren Männern entlastet werden. Aufgrund der intensiven Beschäftigung mit dem Behinderten vernachlässigen sie oft dessen Geschwister und ihre Ehepartner. In anderen Fällen ziehen sich die Väter nach der Geburt eines behinderten Kindes aus der Familie zurück, konzentrieren sich auf ihren Beruf oder flüchten an den Stammtisch beziehungsweise in Vereine. Manche intensivieren aber auch die Beziehungen zu ihren nichtbehinderten Kindern, während sie sich kaum um das behinderte kümmern. Manche Ehepartner entfremden sich voneinander und lassen sich unter Umständen sogar scheiden, insbesondere wenn ihre Ehe zusätzlich durch Schuldgefühle oder Schuldzuschreibung, interpersonale Konflikte oder gesellschaftliche Isolation belastet ist. Der erlebte Stress kann ferner zu psychischen Störungen, Suchtmittelmissbrauch oder psychosomatischen Beschwerden (vor allem bei einer uneingestandenen Ablehnung des Kindes) führen.
Die gemeinsame Betreuung eines behinderten Kindes kann jedoch auch die Ehe der Eltern stärken, eine Intensivierung der Kommunikation hervorrufen sowie eine Zunahme an Liebe, Zärtlichkeit, Geduld, gegenseitiger Rücksichtnahme, Verständnis, Bescheidung und Demut bewirken. Viele Eltern werden sich mehr und mehr der positiven Seiten behinderter Kinder bewusst - wie beispielsweise ihrer unmittelbaren Herzlichkeit, ihres Vertrauens, ihres unbeschwerten Spiels sowie der Ganzheit und Eindeutigkeit ihrer Gefühle. Sie freuen sich über jeden Entwicklungsfortschritt.
Auch die Beziehung der Geschwister untereinander kann sehr verschieden sein: Viele Kinder begegnen einem behinderten Geschwisterteil besonders liebevoll und geduldig. Er mag sogar ihr Favorit werden, da er außerhalb der üblichen Rangordnung steht und nicht als Konkurrent erlebt wird. Sie betreuen ihn freiwillig mit, handeln ihm gegenüber nur selten aggressiv und zeigen viel Verständnis für sein Verhalten. In anderen Fällen lehnen sie aber das behinderte Kind ab und empfinden ihm gegenüber Feindseligkeit, Hass oder Neid. Sie mögen besonders ernst und frühreif werden, sich vorzeitig von ihren Eltern ablösen und unter Umständen aus ihrer Familie flüchten. Viele Geschwister behinderter Kinder erleben, dass ihre Eltern nur wenig Zeit für sie haben. Oft werden sie überfordert, müssen zum Beispiel viele Aufgaben im Haushalt übernehmen. Häufig werden sie aber auch überbehütet oder stehen unter einem großen Leistungsdruck, da sie ihre Eltern über die Mängel des behinderten Kindes hinwegtrösten sollen. Generell werden ihre Reaktionen zu einem großen Teil dadurch bestimmt, wie sich ihre Eltern gegenüber dem behinderten Geschwisterteil verhalten.
Die Existenz eines behinderten Kindes hat auch Auswirkungen auf das Netzwerk. So tendieren viele Eltern dazu, sich und ihr Kind von der Umwelt abzuschirmen. Sie brechen nach seiner Geburt Kontakte zu Freunden, Bekannten und Kollegen ab, kündigen die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden. Häufig werden sie aber auch von Netzwerkmitgliedern ausgeschlossen, die sich von ihnen distanzieren, intolerant, ablehnend, gleichgültig oder vorurteilsbeladen reagieren und zu keinerlei Unterstützung bereit sind. Schreiner (zitiert nach Kluge/Hemmert-Halswick 1982: 376) schreibt über das Verhalten der sozialen Umwelt: "Familien mit schwerstbehindertem Kind sind Familien, die tagtäglich von früh bis spät und oft auch in der Nacht im Anblick ihres Kindes daran erinnert werden, dass sie von ihren Mitmenschen, auch von denen, die den gesellschaftlichen Auftrag haben, oft in weiten Bereichen allein gelassen werden. Es sind Familien, denen von der Gesellschaft nur wenig Rechte für ihr Kind zugestanden werden, obwohl ein Schwerstbehinderter rechtlich mit allen anderen gleichgestellt ist. Es sind Familien, über deren Kinder viele glauben, öffentlich und ungefragt diskutieren zu können, ob sie lebenswert oder -unwert sind. Das sind Familien, deren Kinder von der Gesellschaft nicht nur abgelehnt, sondern auch als nichtexistent behandelt werden".
Eltern und Geschwister eines behinderten Kindes erleben immer wieder, dass andere Menschen es ignorieren, es anstarren oder ihm nachschauen, übertrieben hilfsbereit sind oder ablehnend reagieren. Sie mögen derartige Situationen als peinlich erleben, sich zurückziehen oder sich aggressiv verhalten. Aber auch die meisten Behinderten werden sich mit zunehmendem Alter der Ablehnung, Distanzierung oder Gleichgültigkeit ihrer Mitmenschen bewusst und müssen sich mit deren Reaktionen auseinander setzen. Diese Situation wird noch dadurch verschlimmert, dass nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz behinderter Kinder in Regelschulen und Kindergärten integriert wird. Die meisten werden in Sonderkindergärten, Sonderschulen, Heimen oder Rehabilitationszentren von ihrer Umwelt isoliert und an ihrer "Normalisierung" gehindert.
Viele Probleme von Familien mit behinderten Kindern resultieren auch aus Erziehungsfehlern. So verzärteln und verwöhnen viele Eltern ihre behinderten Kinder, verhalten sich ihnen gegenüber inkonsistent, machen sie zu Sündenböcken oder lassen sie nicht erwachsen werden (Überbehütung, Symbiosen). Manche setzen ihnen keine Grenzen, sodass diese die ganze Familie beherrschen. Werden die Kinder älter, haben viele Eltern Schwierigkeiten mit ihrem Pubertätsverhalten, insbesondere mit ihrem Bedürfnis nach sozialen und sexuellen Kontakten mit dem anderen Geschlecht. Bei Jugendlichen wird auch die berufliche und gesellschaftliche Integration zu einem großen Problem, da es nur wenig Ausbildungs- und Arbeitsplätze für sie gibt. So bleiben Behinderte deutlich länger bei ihren Eltern wohnen - oft bis diese sie aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr versorgen können. Dann lässt sich in der Regel eine Heimeinweisung nicht mehr vermeiden. Ältere Behinderte, die selbständig leben können, üben oft nur wenig qualifizierte Berufe aus und sind häufig arbeitslos. Aufgrund ihres niedrigen Einkommens sind sie vielfach auf Sozialhilfe und andere öffentliche Leistungen angewiesen. Auch ist es in der Regel schwer, eine behindertengerechte Wohnung zu finden und sie zweckmäßig einzurichten. Große Probleme ergeben sich ferner aus dem Wunsch nach einem Lebenspartner.
Familien mit pflegebedürftigen Mitgliedern
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es circa 600.000 pflegebedürftige Personen, die täglich Hilfe benötigen und zumeist bettlägerig sind. Weitere 900.000 Menschen, die ebenfalls in Privathaushalten leben, benötigen leichtere pflegerische Maßnahmen. Rund ein Drittel dieser 1,5 Mio. Personen ist unter 60 Jahre alt (Hessische Landesregierung 1986b). Es wird geschätzt, dass zwischen 12 und 15% der über 65 Jahre alten Bürger auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind, zwischen 4 und 6% gelten als pflegebedürftig (Bundesregierung 1986a; Kuratorium Deutsche Altershilfe 1986). Zu Gebrechlichkeit und Hilflosigkeit im Alter kommen oft psychische Störungen, unter denen zwischen 25 und 30% der über 65 Jahre alten Bürger leiden; circa 15% bedürfen einer Behandlung (Bundesregierung 1986a).
Nur etwa 14% der Pflegebedürftigen wurden 1978 in Heimen und ähnlichen Einrichtungen versorgt (Kuratorium Deutsche Altershilfe 1986), in rund 90% der übrigen Fälle erfolgt die eigentliche Versorgung durch Angehörige. Männer übernehmen in der Regel jedoch nur die Pflege ihrer Partnerinnen - ansonsten erfolgt die Betreuung entsprechend den traditionellen Rollenleitbildern überwiegend durch Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter (wobei sich Letztere zumeist nur leichteren Pflegefällen widmen). Viele nichterwerbstätige Frauen werden mit derartigen Aufgaben konfrontiert, wenn ihre Kinder das Haus verlassen. Generell nimmt die Belastung von Familien durch pflegerische Tätigkeiten immer mehr zu, da die Menschen immer älter werden und proportional gesehen immer mehr alte auf immer weniger junge Familienmitglieder kommen. Auch geht die Familiengröße zurück, sodass immer weniger Personen für die Betreuung hilfsbedürftiger Verwandter zur Verfügung stehen.
Es ist ein großer Unterschied, ob Familienmitglieder pflegerische Tätigkeiten bei einer Erkrankung von zeitlich beschränkter Dauer übernehmen oder ob die Pflegebedürftigkeit ohne ein absehbares Ende ist. Bei der Betreuung älterer Menschen handelt es sich zumeist um ein langfristiges Engagement. So nimmt laut einer Umfrage in Baden-Württemberg (Institut für Demoskopie Allensbach 1985b) jeder Vierte, der einen älteren Angehörigen regelmäßig versorgt, diese Aufgaben seit ein bis zwei Jahren wahr, jeder Zweite seit mehr als zwei Jahren.
Auch macht es einen Unterschied, ob die hilfsbedürftigen Familienmitglieder nur eine Unterstützung bei bestimmten Verrichtungen wie Einkauf, Fensterputzen oder Bügeln benötigen oder ob sie einer generellen Pflege bedürfen, ob sie dank der Versorgung durch Angehörige in der gewohnten Umgebung ihrer eigenen Wohnung bleiben können oder ob sie zu Verwandten ziehen müssen, ob die Angehörigen (zum Beispiel bei einer bereits bestehenden Hausgemeinschaft) unmerklich in pflegerische Aufgaben hineinwachsen oder diese bei einem plötzlichen Eintritt der Pflegebedürftigkeit unvorbereitet übernehmen sollen. Im letztgenannten Fall fällt die Anpassung an die neue Situation sehr viel schwerer, müssen gleichzeitig Aufgaben wie Umzug oder Haushaltsauflösung bewältigt werden.
In den meisten Fällen müssen Familienalltag und Wohnungseinrichtung an den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen ausgerichtet werden. Auch kann seine Krankheit zum alles beherrschenden Thema werden. Normalerweise ist die Pflegetätigkeit sehr zeitaufwendig; ein Drittel der Pflegepersonen wendet dafür sogar täglich mehr als sechs Stunden auf (Kuratorium Deutsche Altershilfe 1986). Zumeist sind sehr unterschiedliche Aufgaben zu erledigen, die den Tätigkeitsbereichen "Haushaltsführung", "Grundpflege", "Behandlungspflege", "Betreuung", "Erfüllung einer Präsenzpflicht" und "Unterstützung bei der Wahrnehmung von Außenkontakten" zugeordnet werden können. Zum letztgenannten Aufgabenbereich gehört auch die Vertretung des Pflegebedürftigen gegenüber sozialen Diensten, Behörden und anderen Institutionen.
Die physische Belastung der Pflegenden stellt sich wie folgt dar: Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung (Braun/Articus 1984) bezeichneten 28% der Befragten die Belastung durch die Pflegetätigkeiten als stark, 52% als mal stärker, mal schwächer und 20% als gering. Die Belastung war zu Beginn der Pflege, bei einem hohen Zeitaufwand für dieselbe, bei einer langen Dauer der Betreuung und bei fortgeschrittenem Alter der Pflegepersonen besonders hoch. Jeder dritte Befragte befürchtete, dass ihm die Belastung eines Tages über den Kopf wachsen könnte. So ist Pflege oft körperliche Schwerarbeit, wobei die Angehörigen vielfach die Anstrengung und die Gefahren für die eigene Gesundheit verdrängen. Jedoch wird etwa jeder Dritte in seiner Gesundheit beeinträchtigt, klagt zum Beispiel über Nervosität, Rückenleiden oder psychosomatische Krankheiten (Kuratorium Deutsche Altershilfe 1986).
Hinzu kommt, dass aufgrund der zeitlichen Bindung oft auf Freizeit, Urlaub, Wochenendausflüge und andere private Unternehmungen verzichtet und der Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten reduziert werden muss. Verbrauchte Kräfte können so nur noch zum Teil regeneriert werden, es kommt zu Frustrationen und zu Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Lebensführung. Dieses trifft vor allem auf Frauen zu, da sie zumeist die Hauptlast der Pflege tragen. Sie müssen oft auch ihren Beruf aufgeben, sodass sie die aus der Erwerbstätigkeit und dem Kontakt zu Kollegen resultierenden Befriedigungen verlieren. In diesen Fällen kann der Fortfall des zweiten Einkommens zudem zu finanziellen Belastungen führen, die durch hohe Ausgaben für die Pflege (Hilfsmittel, Transportkosten usw.) noch verschärft werden können. Manchmal muss dann der Pflegebedürftige in die Wohnung der Angehörigen umziehen, da der Haushalt nur mit Hilfe seines Einkommens aufrechterhalten werden kann.
Weitere psychische Belastungen für Pflegepersonen können ferner aus der Einschränkung der Privatsphäre, aus Zukunftsangst, Mitleid mit dem Hilfsbedürftigen oder negativen ärztlichen Prognosen resultieren. Auch treten zu Beginn der Pflege eines älteren Angehörigen oft Spannungen auf: Bisher lebten die Generationen getrennt, hatten ihren eigenen Lebensstil und vermieden Konflikte - nun müssen sie unter erschwerten Bedingungen wieder das Zusammenleben erlernen. So ist es nicht verwunderlich, dass alte Konflikte aufleben. Auch werden oft aggressive Impulse und Schuldgefühle empfunden, entstehen Probleme aus der Enge der Beziehung heraus.
Zudem kommt es zu einer Rollenumkehrung, verbunden mit Verwirrung und Unsicherheit: Die erwachsene (Schwieger-)Tochter muss nun einen Elternteil "bemuttern", der somit in eine Kindposition gerät. Er muss von Selbständigkeit und Selbstbestimmung Abschied nehmen, verliert an Einfluss und Macht, trauert um verloren gegangene Kompetenzen. Manche Pflegebedürftige wagen aus dem Gefühl der Abhängigkeit heraus nicht mehr, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Zu Schwierigkeiten kann es ferner kommen, wenn kranke oder behinderte Familienmitglieder ihre Pflegepersonen schikanieren, ihnen gegenüber aggressiv reagieren, keine Zeichen der Dankbarkeit zeigen, immer unzufrieden sind oder wenn ihr Gemütszustand fortwährend schlecht ist. Bei älteren Personen treten oft auch Persönlichkeitsveränderungen, Demenz und andere psychische Störungen auf, mit denen ihre Angehörigen vielfach nur schwer fertig werden.
Die Pflege eines Angehörigen kann auch negative Auswirkungen auf das Familienleben haben. So kommt es zum Beispiel oft zu einer Vernachlässigung von Haushalt und Kindererziehung, aber auch zu Partnerkonflikten, unter denen eine Familie zerbrechen kann. Beispielsweise berichtete in der vorgenannten Untersuchung (Braun/Articus 1984) knapp ein Drittel der Befragten von Unstimmigkeiten zwischen Hauptpflegeperson und Ehepartner. Bei einem Viertel kamen die Kinder zu kurz und litten unter der Gereiztheit ihrer Eltern. So lösen sich viele Kinder vorzeitig von daheim ab. Auch sind die Möglichkeiten für eine gemeinsame Freizeitgestaltung oder einen Familienurlaub stark beschränkt.
Familien mit alkoholkranken Mitgliedern
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es rund 2 Mio. Alkoholkranke, die mit knapp 3 Mio. Kindern zusammenleben. Heute wird davon ausgegangen, dass Alkoholismus genetisch mitbedingt ist - viele Eltern oder Geschwister von Alkoholikern sind ebenfalls alkoholkrank. Während sich der Alkoholmissbrauch zunächst verheimlichen lässt oder noch von Kollegen und anderen Netzwerkmitgliedern toleriert wird, treten mit fortschreitender Sucht immer mehr negative Folgen ein. So verlieren manche Alkoholkranke ihren Arbeitsplatz, was zu großen finanziellen Problemen für ihre Familien führen kann. Einige werden kriminell oder verursachen Unfälle, sodass es oft zu einer Verhaftung kommt. Aber auch ihre Hospitalisierung (Entziehungskur) kann eine längere Trennung von ihrer Familie mit sich bringen. Alkoholismus kann ferner zu somatischen Krankheiten (zum Beispiel chronische Magenentzündung, Fettablagerung in der Leber), Verletzungen, Bewusstseinsveränderungen und psychischen Störungen führen. In späteren Phasen des Alkoholismus kommt es manchmal auch zur Auflösung der Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern.
Zumeist steht der Alkoholmissbrauch eines Elternteils im Mittelpunkt des Familienlebens, bietet fortwährend Gesprächsstoff und bestimmt das Verhalten aller Familienmitglieder. In der Regel sind gemeinsame Mahlzeiten selten, unternehmen die Mitglieder nur wenig miteinander, wird die Freizeit kaum aktiv gestaltet. Oft leidet die Familie unter einer Vielzahl von Stressoren, zu denen auch chaotische Wohnverhältnisse, Abhängigkeit von Sozialhilfe, ständige Spannungen und Mangel an Kommunikation gehören können. Viele Alkoholkranke beherrschen ihre Familie, indem sie stark und tyrannisch oder schwach und hilflos agieren beziehungsweise fortwährend zwischen den beiden Extremen wechseln. Durch dieses Verhalten erzwingen sie bestimmte Reaktionen von ihren Angehörigen. Häufig halten Alkoholiker aber auch ihre Familie zusammen, indem sie durch den Alkoholmissbrauch von Krisen und Konflikten ablenken oder ein konfliktvermeidendes Verhalten ermöglichen. Zu einer Stabilisierung tragen ferner die in Familien von Alkoholkranken zu beobachtenden voraussagbaren und rigiden Interaktionsmuster bei. Zudem führt Alkoholismus zu verstärktem Zusammenhalt der nicht alkoholkranken Familienmitglieder und zur Abgrenzung gegenüber der Umwelt (Isolation der Familie).
Da Alkoholkranke (vor allem in fortgeschrittenen Stadien) die Verantwortung für ihre Familie nicht mehr tragen können, muss sie oft von ihren Partnern übernommen werden. Für viele Ehefrauen bedeutet das auch, dass sie wieder erwerbstätig werden und die Versorgung der Familie sicherstellen müssen - mit der Folge, dass die alkoholkranken Partner von ihnen abhängig werden und an Selbstbewusstsein verlieren. In diesen Fällen sind viele Ehefrauen unbewusst an einer Aufrechterhaltung des Status quo interessiert. Einerseits gewinnen sie durch die angedeutete Entwicklung an Macht, andererseits bildet sich zwischen ihnen und ihren Kindern vielfach eine besonders enge Beziehung aus. Häufig erfahren sie auch die Sympathie von Verwandten und Freunden, wodurch sie ihre Situation leichter ertragen können. So wird auch verständlich, wieso sie oft den Alkoholismus ihrer Partner fördern, indem sie zum Beispiel alkoholische Getränke kaufen ("Co-Abhängigkeit"). Ferner lässt sich erklären, weshalb manche Witwen von Alkoholikern wieder einen Alkoholkranken heiraten. In anderen Fällen - insbesondere wenn es zu häufigen Ehekonflikten und zu Gewaltanwendung in der Ehe kommt - reichen die Partner von Alkoholkranken jedoch nach einer gewissen Zeit die Scheidung ein. Wird (zunächst) versucht, die Alkoholabhängigkeit den Kindern gegenüber zu verheimlichen, entsteht in den betroffenen Familien leicht eine Atmosphäre der Verlogenheit und Täuschung. Die Heimlichtuerei lässt sich jedoch nur für einen mehr oder minder kurzen Zeitraum durchhalten. Dann werden die Kinder mit dem schlechten Verhaltensmodell ihrer Eltern konfrontiert. Sie reagieren auf den alkoholkranken Elternteil vielfach mit Ablehnung, Abscheu oder Angst und erleben Spannungen, Disharmonie und Ambiguität in der Beziehung zu ihm. Oft leiden sie unter Vernachlässigung, einem wechselhaften Erziehungsstil, physischer Misshandlung oder sexuellem Missbrauch. Viele Kinder alkoholkranker Eltern wirken unsicher, ängstlich, traurig, depressiv, verärgert oder verschlossen, haben ein negatives Selbstbild, fühlen sich verlassen und einsam. Da sie fortwährend Abweichungen von der Norm erleben, betrachten sie ihre Familie als anormal und schämen sich ihrer. Aus diesem Grunde bringen sie auch ihre Freunde nicht mit nach Hause.
Viele Kinder alkoholkranker Eltern übernehmen in ihren Familien Rollen wie die des "Familienoberhauptes" (ist verantwortlich für den Haushalt und die Erziehung jüngerer Geschwister), des "Familienhelden" (strebt nach Erfolg und Anerkennung), des "unsichtbaren Kindes" (ist in sich zurückgezogen, fühlt sich einsam), des "Sündenbocks" oder des "Familienclowns" (ist unreif, verletzlich und charmant). Aufgrund der Familienverhältnisse, vorgeburtlicher Schädigungen oder der mangelnden kognitiven Stimulation bleiben ihre Schulleistungen vielfach hinter ihren Fähigkeiten zurück; sie müssen relativ häufig eine Klasse wiederholen. Oft entwickeln sie Symptome wie generalisierte Beziehungsstörungen, Hyperaktivität, Aggressivität, Apathie, Schlafstörungen, Einnässen und andere Verhaltensauffälligkeiten. Manche laufen auch von daheim weg oder werden delinquent. Generell sind die negativen Wirkungen, die aus dem Aufwachsen in einer Familie mit einem alkoholkranken Elternteil resultieren, weniger stark, wenn das Verhältnis zum anderen Elternteil oder weiteren erwachsenen Bezugspersonen sehr gut ist oder wenn intensive positive Einflüsse von dem Netzwerk, der Schule oder anderen sozialen Einrichtungen ausgehen.
Auch als Erwachsene leiden viele Kinder alkoholkranker Eltern noch unter den Nachwirkungen des Aufwachsens unter den skizzierten Bedingungen. So suchen sie zum Beispiel fortwährend nach Zustimmung und Bestätigung durch Dritte, handeln, ohne vorher über die Konsequenzen ihres Verhaltens nachzudenken, und reagieren oft extrem auf Veränderungen. Sie nehmen sich sehr ernst, beurteilen sich selbst nach strengen Maßstäben und können nur schwer Freude empfinden. Viele sind beruflich wenig erfolgreich, leiden unter Alpträumen, essen zwanghaft oder berichten von psychosomatischen Beschwerden. Da sie nicht gelernt haben, was "normales" Verhalten ist, benehmen sie sich häufig auffällig. Auch erleben sie in intimen Beziehungen große Schwierigkeiten, die zu Ehekonflikten führen und mit einer Scheidung enden können. Da sie jedoch gelernt haben, abweichendes Verhalten zu akzeptieren, heiraten sie oft Alkoholiker oder Personen mit anderen psychischen Störungen. Rund 30% der Kinder alkoholkranker Eltern missbrauchen später selbst Alkohol - wobei dieses Forschungsergebnis für beide Geschlechter gleichermaßen gilt (Salloch-Vogel 1987).
Natürlich stammen nicht alle alkoholgefährdeten jungen Menschen aus Familien mit einem alkoholkranken Elternteil. Laut einer für den Freistaat Bayern repräsentativen Umfrage von 1984 (Bayerisches Staatsministerium des Innern/Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 1986) kommen sie auch überdurchschnittlich häufig aus unvollständigen Familien, haben die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern vor dem 12. Lebensjahr erlebt. Vielen fehlte daheim ein echter Gesprächspartner. Alkoholgefährdete Jugendliche berichteten bei der vorgenannten Befragung zudem häufiger von starken Spannungen zwischen ihnen und ihren Eltern. Vor allem das Verhältnis zu den Vätern wurde als schlecht bezeichnet und deren Verhalten als autoritär oder labil beschrieben. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass nach dieser Umfrage die Zahl jugendlicher Alkoholkonsumenten zwischen 1973 und 1984 (im Freistaat Bayern) stark zurückgegangen ist. Es gelten jedoch weiterhin knapp 7% aller Jugendlichen als alkoholgefährdet.
Familien mit drogensüchtigen Mitgliedern
In der Bundesrepublik Deutschland sind schätzungsweise zwischen 50.000 und 100.000 Personen allein von Heroin und andern Opiaten abhängig (Maier 1986). Laut einer Repräsentativerhebung von 1984 (Bayerisches Staatsministerium des Innern/Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 1986) hatten 10,6% der bayerischen Jugendlichen (circa 240.000) in ihrem bisherigen Leben schon irgendwann einmal illegale Drogen missbraucht - wobei männliche Jugendliche mit 53% nur etwas häufiger vertreten waren als weibliche. Ansonsten stammen die Jugendlichen aus allen Bevölkerungsschichten. Jedoch waren Großstädter, Studenten und Arbeitslose überrepräsentiert. Rund zwei Drittel haben Halluzinogene, 28% Heroin, 17% Stimulantien, 16% Schnüffelstoffe und 5% Kokain missbraucht. In den meisten Fällen war es bei einigen wenigen Versuchen geblieben; etwa 12.000 bayerische Jugendliche galten jedoch als hochgradig drogengefährdet.
Jugendliche mit Drogenerfahrung stammten überdurchschnittlich oft aus unvollständigen Familien, wurden mehr von Verwandten als von ihren Eltern erzogen oder wuchsen in Heimen auf. 27% bezeichneten ihre Beziehung zum Vater als schlecht beziehungsweise sehr schlecht im Vergleich zu 9% aller bayerischen Jugendlichen. Sie sahen ihren Vater als streng und autoritär oder als bedrohlich und aggressiv an. Auch nannten sie seltener ihre Eltern als Vertrauenspersonen. Im Gegensatz zu 6% aller bayerischen Jugendlichen waren 19% derjenigen mit Drogenerfahrung bereits irgendwann einmal von daheim ausgerissen. Sie berichteten auch von problematischen Schul- und Ausbildungskarrieren (zum Beispiel Sitzenbleiben, mittelmäßiges bis schlechtes Verhältnis zu Lehrern oder Ausbildern, negative Haltung zu Leistung). Ferner waren sie häufiger Mitglieder von Jugendcliquen. So wurden knapp 50% durch Freunde mit Drogen vertraut gemacht, etwa 30% durch Bekannte aus der Clique und circa 20% durch andere Bekannte. Jugendliche mit Drogenerfahrung nannten vor allem Neugier, den Wunsch nach Realitätsveränderung, andersartigen Wahrnehmungen und bestimmten körperlichen Empfindungen sowie das Vorbild von Freunden als Motive für den Drogenmissbrauch.
Viele spätere Drogenabhängige scheitern in der Jugend an altersspezifischen Entwicklungsaufgaben, da ihnen die notwendigen Kompetenzen fehlen. Diese konnten sie sich oft aufgrund einer gestörten Kindheit nicht aneignen. Aufgrund ihrer Misserfolgserlebnisse fühlen sie sich häufig als Versager, entwickeln ein negatives Selbstbild und halten sich für unfähig. Durch den Missbrauch von Drogen können sie schmerzhafte Emotionen, Selbstzweifel, deprimierende Gedanken usw. betäuben und Probleme verdrängen. Zudem können sie auf diese Weise altersgemäßen Anforderungen ausweichen und sich Leistungserwartungen entziehen.
Viele spätere Drogenabhängige versagen im Jugendalter auch beim Aufbau befriedigender Beziehungen zu Gleichaltrigen, insbesondere zu Personen des anderen Geschlechts. So fühlen sie sich vielfach einsam und frustriert, leiden unter sexuellen Problemen und erleben Kontakte zu anderen Menschen als oberflächlich. Durch den Missbrauch von Drogen können sie einer Auseinandersetzung mit dieser Situation ausweichen. Zudem wird ihr Geschlechtstrieb geschwächt. Durch die Verwendung von Drogen bringen sie ferner Aufregung und Abwechslung in ihr tristes Leben. Vielfach ist ihr Verhalten aber auch ein Zeichen von Selbstaggression.
Spätere Drogenabhängige wachsen häufig in Familien auf, in denen Kommunikationsprozesse gestört sind und die Mitglieder das Familienleben als langweilig empfinden, Gefühle nicht ausdrücken dürfen und sich voneinander entfremdet haben. Viele Eltern (und Geschwister) missbrauchen alkoholische Getränke oder Medikamente und sind somit für ihre Kinder ein schlechtes Vorbild. Oft stehen sie deren Experimenten mit Suchtmitteln gleichgültig gegenüber oder nehmen sie aufgrund von Verdrängungsprozessen nicht bewusst wahr. Die meisten Eltern machen weder sich selbst noch ihr Kind für den Drogenmissbrauch verantwortlich, sondern schreiben die Schuld Dritten (einschließlich dem Ehepartner) zu. Da sie davon ausgehen, dass der Drogenabhängige sein Verhalten nicht kontrollieren kann, bekämpfen sie es nicht auf wirksame Weise, machen Drohungen nicht wahr, erwarten bei Phasen der Abstinenz einen baldigen Rückfall (sich selbst erfüllende Prophezeiung) oder fördern sogar den Drogenmissbrauch, indem sie ihrem Kind Geld geben, damit es nicht stehlen oder der Beschaffungsprostitution nachgehen muss.
Zumeist haben sich die Eltern von (späteren) Drogenabhängigen voneinander entfremdet, ist ihre Ehebeziehung gestört. Oft verwickelt der gegengeschlechtliche Elternteil das Kind in eine symbiotische Beziehung und macht es zum Ersatzpartner. Indem er es überbehütet und verwöhnt, verhindert er dessen Weiterentwicklung und die Ausbildung von Selbständigkeit, Autonomie und Leistungsbereitschaft. Vielfach kommt es auch zu inzestuösen Beziehungen. Der gleichgeschlechtliche Elternteil des Kindes nimmt häufig eine Randposition in der Familie ein, da er von der symbiotischen Dyade ausgeschlossen wird und bei Konflikten immer auf ein Bündnis zwischen seinem Partner und dem (späteren) Drogenabhängigen stößt. So hat er wenig Macht in der Familie, kann das Kind nicht disziplinieren (da dieses von dem anderen Elternteil geschützt wird) und trifft bei seinen Erziehungsbemühungen auf den Widerstand seines Partners. Er zieht sich dann häufig aus seiner Familie zurück und verhält sich dem (später drogenabhängigen) Kind gegenüber gleichgültig oder feindselig. Aufgrund der skizzierten Situation kommt es auch nur selten zur Zusammenarbeit der Eltern bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs.
Unter diesen Umständen werden die Selbstdifferenzierung, Individuation und Ablösung des späteren Drogenabhängigen zu behindert. Er wird unzureichend auf die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters vorbereitet; sein Versagen ist somit vorprogrammiert. Zumeist kann er sich aus der symbiotischen Beziehung nicht lösen: Da er der Lebensinhalt des gegengeschlechtlichen Elternteils ist, rufen derartige Bestrebungen Ängste, Depressionen und Selbstmordgedanken hervor, die er unbewusst erspürt und die zu starken Schuldgefühlen führen. Zudem bemüht sich dieser Elternteil, das Kind an sich zu binden, indem er zum Beispiel an dessen Loyalität appelliert. Durch den Missbrauch von Suchtmitteln versucht der Drogenabhängige, diesen Konflikt zwischen Bindung und Selbstdifferenzierung zu lösen - so beweist er einerseits seine Unabhängigkeit und Selbständigkeit, indem er sich gegen den Willen seiner Eltern in der Drogenszene aufhält, und ermöglicht andererseits dem gegengeschlechtlichen Elternteil durch seine Inkompetenz und Hilfsbedürftigkeit, ihn weiterhin zu versorgen und zu behüten. Auf diese Weise erfüllt der Drogenmissbrauch bestimmte Funktionen für beide Seiten, die deshalb an der Aufrechterhaltung des Status quo interessiert sind ("Co-Abhängigkeit"). Übrigens ist die zuvor beschriebene Dynamik auch in Familien Alleinerziehender zu finden - so stammen Drogenabhängige überdurchschnittlich oft aus unvollständigen Familien. In diesen Fällen kann der Drogenmissbrauch aber ebenfalls dem Bekämpfen von Trauer, Schmerz und Verlustgefühlen dienen, die aus dem Erleben der Scheidung der Eltern oder des Todes eines Elternteils resultieren. Ferner gleiten manche Kinder Alleinerziehender in die Drogenszene ab, da sie vernachlässigt und zu wenig beaufsichtigt wurden.
In anderen Fällen erfüllt die Drogenabhängigkeit die Funktion, die Herkunftsfamilie zusammenzuhalten. Einerseits handelt es sich hier um emotional "tote" Familien, in denen die Mitglieder isoliert sind und kaum miteinander reden. Oft ist der Drogenmissbrauch das einzige Gesprächsthema; er sorgt gewissermaßen für Aufregung und gibt den Eltern wenigstens etwas Lebensinhalt. Da diese in der Sorge um ihr Kind geeint sind, wird die Gefahr des Zerfalls der Familie gebannt. Andererseits handelt es sich hier um Familien, in denen es häufig zu Ehekonflikten kommt und die Ehepartner mit dem Gedanken an eine Trennung spielen. Durch den Drogenmissbrauch eines Kindes werden sie von ihren Eheproblemen abgelenkt und zur Zusammenarbeit gezwungen. Besteht die Gefahr einer Trennung nicht mehr, wird der Drogenabhängige oft wieder abstinent. Kommt es erneut zu Ehekonflikten, ist ein Rückfall nahezu vorprogrammiert.
Heiraten Drogenabhängige, so ersetzt in manchen Fällen der Partner den symbiotischen Elternteil, indem er eine sehr enge Beziehung zu dem Drogenabhängigen eingeht, ihn verwöhnt und ihn überbehütet. In anderen Fällen ist er ebenfalls suchtkrank. Wird eine drogenabhängige Frau schwanger, so stellt sie oft ihre Ernährung nicht um, geht nicht regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen und bereitet sich kaum auf die Geburt vor. Deswegen und infolge des schlechten Gesundheitszustandes der Mutter kommt es bei der Geburt häufig zu Komplikationen. Vielfach wird das Kind auch drogenabhängig geboren, ist behindert oder mit AIDS infiziert.
Viele Säuglinge werden von ihren drogenabhängigen Eltern nur unregelmäßig versorgt und wenig stimuliert. Oft bleiben ihre Bedürfnisse unbefriedigt. Kleinkinder und ältere Kinder werden häufig vernachlässigt, hinsichtlich ihrer Entwicklung kaum gefördert und nur selten zu guten Schulleistungen angehalten. Vielfach ist der Erziehungsstil ihrer Eltern inkonsistent oder autoritär. Sie machen von Anweisungen, Drohungen und harten Strafen Gebrauch oder misshandeln ihre Kinder. Deshalb kommt es oft zu Verzögerungen und Störungen in der kognitiven, emotionalen und Sprachentwicklung. Die Kinder sind häufig unangepasst, leiden unter psychosozialen Problemen und Verhaltensstörungen, erbringen schlechte Schulleistungen oder wachsen in Heimen und Sondereinrichtungen auf.
Ausländerfamilien
Im Jahr 1988 lebten 4.489.000 Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland. Die meisten sind Türken, Jugoslawen, Italiener und Griechen. Sie haben sich überdurchschnittlich häufig in Großstädten niedergelassen; so betrug zum Beispiel 1987 im Freistaat Bayern der Anteil der Ausländer an der Bevölkerung 6,3%, in München aber 18% sowie in Nürnberg und Augsburg 13%. Rund 80% der derzeit hier lebenden Ausländer halten sich bereits sechs, etwa 60% sogar zehn Jahre lang und länger in der Bundesrepublik auf.
Bei Ehepaaren stellen "Familien mit männlichen Pionierwanderern ... mit 76,4% den Haupttyp dar, wohingegen Familien mit weiblichen Pionierwanderern (13,l%) ebenso selten sind wie die gemeinsame Wanderung (10,4%)" (Nauck 1988: 283). Neben den mit der Einarbeitung in einen neuen Arbeitsplatz, der Wohnungssuche, dem Spracherwerb und der Integration in einem neuen Kulturkreis verbundenen Belastungen müssen viele Ausländer somit auch die Trennung von ihren Angehörigen nach der Einreise verkraften. In vielen Fällen kommt es zu einer gewissen Entfremdung zwischen den in Deutschland lebenden Erwachsenen und den im Heimatland verbleibenden Familienmitgliedern. Aber auch beim Nachzug von Angehörigen bleiben häufig ältere Kinder zurück, die dann bei Verwandten aufwachsen. Ledige Ausländer, die in der Bundesrepublik einen Arbeitsplatz gefunden haben, heiraten zumeist relativ spät, wobei die Ehen in der Regel in ihrem Heimatland geschlossen werden. Sehr viele Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren sind aber noch immer unverheiratet.
In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Zahl der berufstätigen Ausländer abgenommen. Heute sind nur noch knapp 40% erwerbstätig - ein etwas höherer Anteil als bei der deutschen Bevölkerungsmehrheit. Aufgrund ihrer schlechteren Qualifikationen (wenige Jahre Schulbildung, keine deutschen Maßstäben entsprechende Berufsausbildung), aber auch aufgrund von Diskriminierung, finden Ausländer zumeist nur schlecht bezahlte Arbeit und haben wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Da sie die deutsche Sprache nicht vollkommen beherrschen, stehen ihnen selten Angestelltenberufe offen. So fallen Ausländerhaushalte in der Regel in untere und mittlere Einkommensgruppen. Auch sind Ausländer aufgrund ihrer schlechteren Qualifikationen stärker von Arbeitslosigkeit bedroht als Deutsche; ihre Arbeitslosenquote ist besonders hoch.
Zumeist sind die Wohnverhältnisse von Ausländerfamilien schlecht. Ihre Wohnungen sind vielfach zu klein (geringere Pro-Kopf-Wohnfläche als bei Deutschen) und unzureichend ausgestattet hinsichtlich sanitärer Anlagen, Heizung und Kälteschutz. Dennoch ist die Miete häufig überdurchschnittlich hoch. Viele wohnen in Sanierungsgebieten oder reinen Ausländervierteln, in denen es oft an Spielplätzen, Erholungsräumen und sozialen Einrichtungen mangelt, das Verkehrsaufkommen jedoch recht groß sein kann. Die meisten Ausländer leben gerne in einem Stadtteil mit einem hohen Ausländeranteil, da sie sich dort unter ihresgleichen wohler fühlen als in einem hauptsächlich von Deutschen bewohnten Viertel.
Laut einer Untersuchung des Sonderforschungsbereichs 3 der Universitäten Frankfurt/Main und Mannheim (Sfb 3-Ausländerumfrage 1982) konnten sich knapp 60% der Ausländer gut in der deutschen Sprache verständigen oder sie fließend sprechen (Statistisches Bundesamt 1985). In der Familie wird aber überwiegend die Heimatsprache verwendet. Zumeist sind die Deutschkenntnisse der Eltern schlechter als die der Kinder. Laut der vorgenannten Befragung fühlten sich nur 13% der Ausländer als Deutsche oder mehr als Deutsche denn als Angehörige der eigenen Nation. Jedoch wollten 1982 nur 8% innerhalb der nächsten zwölf Monate in ihr Heimatland zurückkehren. 44% wollten hingegen für immer in Deutschland bleiben, rund 25% noch für sechs Jahre und länger.
Schon aus den vorgenannten Befragungsergebnissen lässt sich schließen, dass Ausländerfamilien nur schlecht in die deutsche Gesellschaft integriert sind. Dafür spricht auch, dass laut der Sfb 3-Umfrage 75% der Ausländer keinen deutschen Freund hatten, obwohl rund 40% gerne mehr Kontakt zu Deutschen hätten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zahl gemischtnationaler Ehen sehr gering ist - 1983 wurden beispielsweise nur rund 28.000 derartiger Eheschließungen registriert (Nauck 1988). Der Kontakt zu Deutschen ist zumeist etwas intensiver, wenn Ausländer relativ jung sind, gute Deutschkenntnisse besitzen, bereits lange in der Bundesrepublik Deutschland leben, eine deutsche Schule besuchen (beziehungsweise besucht haben) oder in einem Gebiet mit geringem Ausländeranteil wohnen. Auch Ausländer der zweiten Generation berichten von mehr Freundschaften. Am besten haben sich in der Regel Jugoslawen und Spanier in die deutsche Gesellschaft eingefügt, am wenigsten hingegen Türken: Sie haben weniger Kontakt zu Deutschen und fühlen sich häufiger ungerecht behandelt (Statistisches Bundesamt 1985, 1987a). Auch haben sie einen besonders extremen Kontextwechsel erlebt, da sie aus einem überwiegend agrarisch strukturierten und durch den Islam geprägten Herkunftsland in eine moderne, hoch industrialisierte Gesellschaft wechselten. Für sie ist der aus der Lösung aus der traditionellen ethnischen Gruppe und den Verlust von Verwandtschaftskontakten resultierende Stress besonders groß.
Generell fühlte sich jeder fünfte Ausländer in seinem Wohlbefinden stark oder sogar sehr stark beeinträchtigt, weil er von Deutschen nicht geachtet oder ungerecht behandelt wurde. Vielleicht erklärt die erlebte Ausländerfeindlichkeit auch, wieso nur circa 75% der Ausländer im Vergleich zu mehr als 87% der Deutschen mit ihrem Leben zufrieden waren. In Ausländerfamilien sind zumeist geschlechtsspezifische Rollenunterschiede stärker ausgeprägt als in deutschen. So werden beispielsweise Mütter noch seltener von ihren Partnern bei Haushaltsführung und Kinderbetreuung entlastet. In vielen Fällen ist nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland jedoch auch eine Tendenz zu mehr Gleichberechtigung und Mitbestimmung der Frauen festzustellen, die mit einer stärkeren Emotionalisierung der Gattenbeziehung und einer größeren Achtung der Frau durch den Mann verbunden ist. Hier dürfte von Bedeutung sein, dass viele Frauen in der Bundesrepublik Deutschland (erstmals) erwerbstätig werden und oft einen hohen Beitrag zum Haushaltseinkommen leisten. Da ihre Kinder aufgrund der (im Vergleich zu den Herkunftsländern) sehr viel längeren Schul- und Ausbildungszeit länger von der Familie abhängig bleiben und ihre Erziehung größere Anforderungen an die Eltern stellt, gewinnen viele Frauen einen höheren Status auch aufgrund der größeren Bedeutung ihrer erzieherischen Tätigkeit.
Erwerbstätige Mütter sind aufgrund der Mehrfachbelastung durch Beruf, Haushalt und Erziehung oft physisch und psychisch erschöpft - vor allem, wenn sie mehrere Kleinkinder versorgen müssen. Vielfach stellt sich für sie auch das Problem der Kinderbetreuung während ihrer berufsbedingten Abwesenheit. So stehen zum Beispiel Großeltern nur selten zur Verfügung. Auch mangelt es generell an Plätzen in Krippen, Kindergärten und Horten. Zudem ist es in ihren Heimatländern unüblich, Kinder in Tagespflege zu geben.
Das vorgenannte Problem, die in der Bundesrepublik Deutschland sehr hohen Kosten für Kinder und die beengten Wohnverhältnisse dürften dazu beigetragen haben, dass im Verlauf der letzten Jahre bei Ausländerfamilien die Geburtenzahl sehr stark zurückgegangen ist. 1974 handelte es sich noch bei jeder sechsten Geburt um ein Ausländerkind, zehn Jahre später traf dieses nur noch auf jede zehnte Geburt zu (Statistisches Bundesamt 1985). Jedoch werden noch immer höhere Kinderzahlen in Ausländerfamilien erreicht. Vielfach spielt beim Kinderwunsch die Erwartung eine Rolle, dass die Kinder später finanzielle Leistungen für die Herkunftsfamilie und einen Beitrag zur Alterssicherung ihrer Eltern erbringen werden.
Ausländische Eltern besitzen oft weniger Erziehungswissen als deutsche. Zudem praktizieren sie noch häufiger einen autoritären Erziehungsstil. Vielfach erfolgt die Verhaltenskontrolle aber auch über zärtliche Beschützung, Behütung und emotionale Bindung. Viele Sozialisationspraktiken ausländischer Eltern wandeln sich mit zunehmender Dauer ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland, während bei ihren Erziehungseinstellungen eine Veränderung weniger deutlich ist. So wird zum Beispiel ihre Erziehung im Verlauf der Zeit weniger autoritär und geschlechtsspezifisch.
Ausländische Eltern tendieren dazu, bei der Erziehung von Söhnen deutsche Leitbilder zu beachten, während sie sich bei der Erziehung von Töchtern mehr an ihren eigenen Kindheitserfahrungen orientieren. Mit zunehmender Integration in den deutschen Kulturkreis werden Mädchen weniger und Jungen etwas mehr zur Hausarbeit herangezogen. Generell werden in ausländischen Familien Kinder mehr an der Hausarbeit und der Betreuung jüngerer Geschwister beteiligt. So ergab zum Beispiel eine Befragung türkischer Eltern (Nauck/Özel 1986), dass 47,9% ihrer Kinder täglich oder mehrmals in der Woche Einkäufe erledigten, 28,9% die Wohnung sauber machten, 24,2% auf kleinere Geschwister aufpassten und 15,3% beim Kochen halfen.
Ausländische Kinder besuchen seltener einen Kindergarten als deutsche. So werden sie oft zu wenig auf die Schule vorbereitet und erhalten keine Sprachförderung. Viele bleiben aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse schon in der Grundschule sitzen. Manche erwerben keinen Schulabschluss –beim vorzeitigen Schulabgang beherrschen sie häufig weder die deutsche noch ihre Herkunftssprache. Viele Schüler besuchen aber auch Hausaufgabenhilfen oder erhalten privaten Nachhilfeunterricht, sodass es ihnen häufiger gelingt, qualifizierte Schulabschlüsse zu erwerben. Immer mehr ausländische Kinder wechseln zudem an weiterführende Schulen mit dem Ziel eines späteren Studiums. Aber auch für sie sind Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache oft ein großes Problem.
Ausländische Schüler fühlen sich vielfach gegenüber ihren Mitschülern benachteiligt. Sie erfahren sie als unabhängiger und freizügiger, lehnen aber meistens ein derartiges Verhalten für sich selbst ab. Häufig erleben sie Schwierigkeiten im Kontakt zu deutschen Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten von Mädchen, sich Gruppen gleichaltriger Deutscher anzuschließen, von ihren Eltern zumeist stark eingeschränkt werden. Sie werden seltener aufgeklärt und sollen ihre Jungfräulichkeit bis zur Ehe bewahren. So haben sie nur selten gegengeschlechtliche Freunde. Ihre Freizeit spielt sich in erster Linie in der Familie ab - sie helfen im Haushalt, hören Musik, lesen oder schauen Fernsehen.
Viele ausländische Kinder werden erst in der Schule intensiver mit deutschen Werten, Normen und Erziehungszielen konfrontiert. Diese werden wohl von ihren Eltern toleriert, aber nur ansatzweise übernommen. So wachsen die Kinder in zwei Kulturen auf: Sie erleben in ihrer Familie die Heimatkultur, außerhalb der Familie die deutsche Kultur. Da Integrationsbemühungen in der Schule zumeist nur sprachbezogen sind, erfahren die Kinder nur wenig Vermittlung zwischen beiden Kulturen. So besteht die Gefahr von Kulturkonflikten und Orientierungsschwierigkeiten. In vielen Fällen erweist sich der Einfluss der in der Familie erfahrenen Heimatkultur als stärker - zudem rechnen die älteren Familienmitglieder auch damit, dass sie irgendwann in ihr Herkunftsland zurückkehren werden, und drängen dementsprechend auf ein Beibehalten der dort vorherrschenden Sitten und Gebräuche. In anderen Fällen passen sich Jugendliche und junge Erwachsene aber stärker an die deutsche Kultur an und geraten dann oft in Konflikte mit ihren Eltern. Sie stellen auch eher Vergleiche der eigenen Lebensbedingungen mit denen der Deutschen als mit denen in ihrem Heimatland an. Da ihre Lebens- und Arbeitssituation zumeist schlechter als die der meisten Deutschen ist, sind sie häufig unzufrieden und fühlen sich benachteiligt. Mit zunehmender Dauer ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland entfremden sich aber alle Ausländer immer mehr ihrer Heimatkultur. Zudem bekommen sie den dort ablaufenden, oft sehr raschen soziokulturellen Wandel nicht mehr mit. So wird die heimatliche Kultur ebenfalls fremd, ist auch bei einer Rückkehr in das Herkunftsland mit Anpassungsschwierigkeiten zu rechnen.
Familien mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen
In vielen Familien erleben Eltern Schwierigkeiten mit ihren Kindern. Relativ oft nennen sie Erziehungsprobleme wie häufigen Ungehorsam, Unordnung, Trotz, Eigensinn, Widerstand zum Zeitpunkt des Zubettgehens, zu großen Fernsehkonsum, Lärm, Streit, unordentliche Ausführung der Hausaufgaben, Genuss von zu viel Süßigkeiten und Schwierigkeiten beim Aufstehen - in dieser Reihenfolge (Institut für Demoskopie Allensbach 1983a). Vielfach wird auch kritisiert, dass die Kinder zu wenig Geduld haben, sich nur schlecht konzentrieren können, unruhig und nervös sind, schlecht schlafen, wenig Appetit haben und empfindlich sind. Bei Jugendlichen kommt es oft zu Erziehungsproblemen, wenn sie zum Beispiel aufsässig oder überheblich sind, fortwährend auf die eigenen Rechte pochen oder die Staatsform ablehnen.
Nach verschiedenen Untersuchungen werden heute zwischen 20 und 25% aller Kindergarten- und Schulkinder als verhaltensauffällig oder psychisch gestört eingestuft (Bundesregierung 1975); mindestens 5% sind behandlungsbedürftig. Auffällige Verhalten ist festzustellen: - im körperlichen Bereich (zum Beispiel Eß- und Schlafstörungen, Nägelkauen), - im psychischen (Ängstlichkeit, Phobien, Depressionen usw.), - im sozialen (zum Beispiel Aggressivität, Kontaktprobleme) oder - im Arbeits- und Leistungsbereich (Lern- und Konzentrationsstörungen, Schulversagen bei durchschnittlicher Intelligenz usw.). Bei Jugendlichen können auch Gewalttätigkeit, Zerstörungswut, Alkoholmissbrauch, Drogensucht, die Mitgliedschaft in Jugendsekten oder Abweichungen im Sexualverhalten zum Problem werden. Ferner sind vielfach extrem passive, sehr schüchterne oder übermäßig konformistische Kinder hilfsbedürftig - was oft nicht erkannt wird, da solche Symptome nicht die Aufmerksamkeit von Erwachsenen auf sich lenken.
Da die Entwicklung eines Kindes zu einem großen Teil von den individuellen Merkmalen der anderen Familienmitglieder, ihren Beziehungen und der Familie als Ganzem bestimmt wird, müssen derartige Faktoren auch bei der Untersuchung der Ursachen von psychischen Problemen und Verhaltensstörungen in Erwägung gezogen werden. Im nachfolgenden soll der Schwerpunkt auf solche interpersonale und familiale Entstehungsgründe gelegt werden. Damit wird jedoch nicht bestritten, dass auch manche Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten auch im Kind selbst liegen können.
So spielen in vielen Fällen somatische Faktoren wie Erbanlagen, Dispositionen, Behinderungen, Geburtsschäden, langwierige Krankheiten, Mangel an Antriebskraft, Hyperaktivität und Überempfindlichkeit eine große Rolle. Aber auch intrapsychische Konflikte sind von Bedeutung, bei denen zum Beispiel Bestrebungen des Kindes auf verinnerlichte Verbote treffen und abgewehrt werden. Ferner können Kinder aufgrund von Traumata unter großen Ängsten leiden, sich wegen negativer Erfahrungen abkapseln, unter Wahrnehmungsstörungen leiden oder aufgrund fehlender Kontakte zu Gleichaltrigen zu wenig soziale Fertigkeiten besitzen.
Viele Kinder erlernen auffällige Verhaltensweisen in ihren Familien, indem sie andere Mitglieder unbewusst nachahmen. Häufig versuchen sie auch, durch derartige Reaktionen die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen - insbesondere wenn ihnen dieses durch ein sozial akzeptiertes Verhalten nicht gelingt, wenn sie also zum Beispiel vernachlässigt werden oder aufgrund von extrem hohen Erwartungen nur selten ein Lob erhalten. Die Reaktionen der anderen Familienmitglieder, egal ob es sich dabei um Strafen, Verärgerung, Angst oder Sorge handelt, werden dann als Selbstbestätigung und Zeichen von Anteilnahme und Interesse gedeutet. Sie wirken also als positive Verstärker, erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Verhaltensauffälligkeiten und führen zu ihrer Verfestigung. Schließlich verhalten sich die Kinder auch außerhalb der Familie auffällig – insbesondere wenn dort ihr Verhalten ebenfalls positiv verstärkt wird, sie sich also zum Beispiel aufgrund ihrer Aggressivität eine führende Position in der Schulklasse erkämpfen können und von ihren Mitschülern bewundert werden. Häufig sind in Familien, in denen Kinder verhaltensauffällig werden, auch andere Personen mehr oder minder stark gestört - sie leiden ebenfalls unter pathogenen Familienprozessen und -strukturen. So werden in diesen Fällen oft Kommunikationsstörungen und ungewöhnliche Interaktionsmuster festgestellt. Unter diesen Umständen lernen Kinder nicht, sich klar und deutlich auszudrücken, Gedanken und Gefühle auf angemessene Weise zu äußern, richtig zuzuhören oder den Sinn unverstandener Botschaften mit Hilfe von Rückfragen zu ermitteln. Häufig erleben sie, dass ihre Mitteilungen ignoriert oder disqualifiziert werden. In anderen Fällen kommt es zu Konflikten mit den Eltern, die durch ihr Bestreben nach Individuation und Selbständigkeit, die Ablösungsproblematik, verschiedene Wertsysteme, unterschiedliche Vorbilder und viele andere Gründe hervorgerufen werden. Diese können sich negativ auswirken, wenn die Kinder hart bestraft oder ausgestoßen werden, wenn sie sich ungeliebt fühlen und ein negatives Selbstbild entwickeln. Manchmal ziehen sie sich zurück, kapseln sich ab und distanzieren sich von ihren Eltern. In anderen Fällen werden sie aggressiv und feindselig. Sie können aber auch die Konflikte verinnerlichen, die sich dann in Symptomen äußern. Häufig leiden Kinder unter den Ehekonflikten ihrer Eltern, werden in sie hineingezogen und erhalten bestimmte Rollen zugeschrieben. So fungieren sie zum Beispiel bei Auseinandersetzungen als Schiedsrichter, Vermittler oder Bundesgenosse oder wirken nach einem Streit als Botschafter, der negative Bemerkungen, Informationen über Gefühle oder Friedensangebote überbringen muss. In allen diesen Fällen werden die Grenzen zwischen der Ehedyade und den Kindern überschritten, werden letzteren Aufgaben zugewiesen, die ihrem Alter und ihrer Position nicht entsprechen. So glauben die Kinder oft, dass sie die Familie zusammenhalten, und halten sich für mächtiger, klüger und stärker, als sie sind. Bei häufigen Ehekonflikten und zunehmender Entfremdung der Gatten wird Kindern vielfach auch die Rolle eines Ersatzpartners zugeschrieben, der die emotionalen Bedürfnisse eines Elternteils befriedigen, ihm Trost spenden und als verständnisvoller Gesprächspartner dienen soll. Manchmal wird diese Beziehung so eng, dass sie zum Inzest führt, oder die Angst vor demselben wird so groß, dass körperliche Berührungen nicht mehr zugelassen werden und die Kinder starke sexuelle Hemmungen entwickeln. In diesen Fällen werden die Kinder an einen Elternteil gekettet und verlieren den anderen. Es kann sich negativ auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität auswirken, wenn der verbündete Elternteil gegengeschlechtlich ist und die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen unmöglich macht.
Wenn die Ehepartner aufgrund ihrer Konflikte oder aus anderen Gründen nicht mehr ihren familialen Aufgaben nachkommen, kann auch ein Kind parentifiziert werden: Es verzichtet auf altersgemäße Aktivitäten und Entwicklungsbedingungen, um die Führung der Familie und die Erziehung seiner Geschwister zu übernehmen. In anderen Fällen werden Kinder für die Familienprobleme verantwortlich gemacht und zum Sündenbock erklärt. Dazu kann es aber auch kommen, wenn die Eltern Spannungen aus ihrem Arbeitsverhältnis abreagieren wollen, sich durch individuelle Charakteristika oder Ablösungsbestrebungen der Kinder bedroht fühlen oder in sie verpönte Bestrebungen, Gefühle und Gedanken hineinprojizieren und sie deswegen stellvertretend bestrafen. Sie benutzen den Sündenbock als Ventil für Aggressionen, vermeiden durch die Rollenzuschreibung die Auseinandersetzung mit ihren Problemen und stabilisieren auf diese Weise ihre Persönlichkeit und ihre Beziehungen. Der Sündenbock entwickelt hingegen negative Gefühle, wird in seiner Individuation behindert und wird oft verhaltensauffällig.
Manche Kinder entwickeln auch Symptome, um die Ehe ihrer Eltern zu retten. So setzen sie diese ein, um die Aufmerksamkeit der Eltern während einer heftigen Auseinandersetzung auf sich zu ziehen und sie von dem Ehekonflikt abzulenken. Ähnlich wie verhaltensgestörte Sündenböcke zwingen sie ihre Eltern, sich mit ihren Symptomen und ihrer Behandlung zu beschäftigen. Beide werden zur Zusammenarbeit gezwungen, da sie nur so das Verhalten ihrer Kinder kontrollieren und die von ihnen außerhalb der Familie erzeugten Schwierigkeiten bewältigen können. In all diesen Fällen gewinnen die Kinder eine große Macht, da sie im Mittelpunkt des Familienlebens stehen, Schuldgefühle und Ängste hervorrufen und auf diese Weise die Eltern zu bestimmten Reaktionen zwingen können. Zudem erfahren sie einen sekundären Krankheitsgewinn, da die Eltern sich immer mehr um sie bemühen, sich für sie aufopfern oder sie von bestimmten Pflichten entbinden.
Vergegenwärtigt man sich den in den letzten Abschnitten verdeutlichten Zusammenhang, so überrascht nicht, dass bei einer repräsentativen Befragung von bayerischen Familien eine enge Beziehung zwischen ungelösten Ehekonflikten und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern ermittelt wurde (Krombholz 1987).
Kindern werden aber auch pathogen wirkende Rollen unabhängig von Eheproblemen zugewiesen. So wird zum Beispiel schon bei ihrer Geburt erwartet, dass sie später Arzt, Priester, Künstler oder Filmstar werden. Viele werden in Rollen wie die des Genies oder Dummkopfes, des "hässlichen Entleins" oder der berauschenden Schönheit, des "schwarzen Schafes" oder des Helden hineingedrängt. Richter (1969) verweist noch auf folgende Rollenzuschreibungen: "Unter Anlehnung an die von S. Freud angegebene Einteilung menschlicher Partnerbeziehungen ('Objektwahlen'') lassen sich beschreiben: die Rollen des Kindes als Substitut für eine Elternfigur, für einen Gatten oder eine Geschwisterfigur, als Abbild des elterlichen Selbst, als Substitut des idealen oder des negativen Aspekts des elterlichen Selbst und als umstrittener Bundesgenosse. In jeder dieser Rollen stecken zugleich Merkmale der normalen Eltern-Kind-Beziehung. Aber je einseitiger und enger die Eltern dem Kind die jeweilige Rolle in ihrer teils bewussten, teils unbewussten Einstellung vorschreiben, umso mehr erhöht sich die Belastung für das Kind, umso eher gerät es in die Gefahr einer neurotischen Erkrankung" (S. 17). In all diesen Fällen stehen die Kinder unter dem Druck, die zumeist unbewussten Erwartungen ihrer Eltern erfüllen zu müssen. Sie erleben, dass ihre Eigenarten, Bedürfnisse und Wünsche ignoriert werden, dass sie bei ihren Bestrebungen nach Individuation und Selbstverwirklichung sehr schnell an Grenzen stoßen.
Ferner wirken sich oft "Delegationen" (Stierlin 1976, 1977) negativ aus. So werden Kinder häufig mit der Mission betraut, für ihre Eltern bestimmte Aufgaben auf der Es-Ebene (zum Beispiel Ersatzbefriedigung unterdrückter Triebimpulse), Ich-Ebene (Bewältigung von Schwierigkeiten, an denen die Eltern scheiterten) oder Überich-Ebene (zum Beispiel Sühnung "böser" Taten) zu erfüllen. Diese Aufträge werden zumeist schon recht früh übermittelt - lange bevor dann die Kinder als Delegierte fortgeschickt werden, aber über ein Loyalitätsband mit ihren Eltern verknüpft bleiben. Problematisch ist, wenn die Aufträge die Kinder überfordern, im Widerspruch zueinander stehen oder gegen ein Elternteil gerichtet sind. Wie bei der Rollenzuschreibung werden auch hier die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder eingeschränkt, werden sie mit bestimmten Aufgaben belastet.
Viele Kinder entwickeln Symptome, weil sie in symbiotischen Beziehungen mit ihren Eltern "gefangen" sind. Derartige Beziehungen entstehen vor allem dann, wenn zwischen den Eltern eine "emotionale Scheidung" stattgefunden hat und sie sich nun ihren Kindern zuwenden, sie zu Ersatzpartnern machen und von ihnen die Zuneigung, das Verständnis und die Aufmerksamkeit verlangen, die ihnen ihr Ehegatte vorenthält. Oft spielen aber auch Abhängigkeitsbedürfnisse, das Gefühl der eigenen Unvollständigkeit oder Angst vor der Leere nach der Ablösung der Kinder eine Rolle. Ähnliche unbewusste Bestrebungen liegen "Bindungen" (Stierlin) zugrunde, die auf der Es- (zum Beispiel Verwöhnung), Ich- (Mystifikation) und Überich-Ebene (Gefühl der Verschuldung gegenüber den Eltern) erfolgen können. Eine andere Situation entsteht bei Projektionen, bei denen ein Elternteil Persönlichkeitssegmente, Triebimpulse oder Aspekte intrapsychischer Konflikte unbewusst in ein Kind verschiebt. So mag zum Beispiel ein Vater seine aggressiven Impulse in seinen Sohn hineinprojizieren, der dann diese ausagiert und bestraft wird. Auf diese Weise werden sowohl die aggressiven Bestrebungen des Vaters als auch sein Strafbedürfnis befriedigt.
Ferner kommt es vielfach zur Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten, wenn die Eltern fortwährend zwischen Phasen der Verwicklung und Symbiose auf der einen und Phasen der Distanziertheit auf der anderen Seite wechseln. Dann sind die Kinder verwirrt und entwickeln keine Verhaltensmaßstäbe. Ähnliches gilt für den Fall, dass sich die Eltern nicht auf Regeln für das Verhalten ihrer Kinder einigen können. Ferner wirkt sich negativ aus, wenn Regeln unklar sind, dem Alter der Kinder nicht angemessen sind, nicht an deren Entwicklung angepasst werden oder nicht durchgesetzt werden. Extreme Regeln, übertriebene Familienwerte und Mythen können zum Problem werden, wenn sie das Verhalten der Kinder übermäßig einschränken und in großem Gegensatz zu den Normen des sozialen Umfeldes stehen.
Selbstverständlich wird auch die Entwicklung von Kindern geschädigt, wenn die Eltern ihrer erzieherischen Funktion nicht nachkommen. So erfüllen manche Männer ihre väterlichen Pflichten nicht, weil sie zu sehr durch den Beruf beansprucht werden oder Pflege und Erziehung entsprechend dem traditionellen Geschlechtsrollenleitbild ihren Partnerinnen als Aufgabe zuweisen. Einige Frauen lehnen den Lebensstil einer jungen Mutter ab, bleiben vollerwerbstätig und überlassen die Versorgung ihrer Kinder einer wechselnden Zahl von Betreuungspersonen - was unter Umständen zu Deprivationserscheinungen führen kann. Geben sie hingegen ihren Beruf auf, so machen manche ihre Kinder für den Verlust an Kontakten und Befriedigungen verantwortlich und lehnen sie ab. Manchmal fehlen Müttern auch die für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder notwendigen Fertigkeiten, da sie zuvor keine Erfahrungen im Umgang mit kleinen Kindern sammeln konnten. So mögen sie ihre Kinder vorzeitig entwöhnen, zu früh mit den Anforderungen der Reinlichkeitserziehung konfrontieren, dabei zu streng und ungeduldig vorgehen, den Willen der Kinder in der Trotzphase zu brechen versuchen oder ihnen dann keine Grenzen setzen. Manche erschweren die Ablösung der Kinder, indem sie sie zum Beispiel nicht mit anderen Kindern in Kontakt bringen und zu wenig an die Betreuung durch Dritte gewöhnen. Dann können der Eintritt in den Kindergarten oder die Einschulung zu Krisen werden. Die Ablösungsproblematik wird später wieder in der Pubertät aktuell und kann mit Machtkämpfen und Konflikten verbunden sein, wenn die Kinder von ihren Eltern nicht "losgelassen" werden.
Häufig kommt es auch zur Ausbildung von Verhaltensauffälligkeiten, wenn die Eltern einen der folgenden Erziehungsstile praktizieren:
(1) Vernachlässigung: Die Eltern kümmern sich kaum um ihre Kinder, zeigen wenig Interesse an ihren Gedanken und Gefühlen, befriedigen nicht ihre Bedürfnisse und bieten ihnen nur wenig Zuwendung, Wärme und Selbstbestätigung. Oft sind sie durch berufliche, gesellschaftliche und sportliche Aktivitäten so ausgelastet, dass kaum Zeit für die Kinder bleibt. In anderen Fällen betrachten sie sie als Hindernisse für die eigene Selbstverwirklichung oder als Konkurrenten um die Liebe ihres Ehepartners.
(2) Verwöhnung: Die Eltern erfüllen ihren Kindern jeden Wunsch, verweichlichen und unterfordern sie. Sie versuchen, ihnen alle Versagungen zu ersparen, und überhäufen sie mit exklusiver Kleidung und teurem Spielzeug. Manchmal sehen sie auch in diesen Dingen Statussymbole, wollen durch sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen (weil sie zum Beispiel selten mit den Kindern zusammen sind) oder möchten, dass es den Kindern besser geht als ihnen selbst während ihrer Kindheit.
(3) Überbehütung: Die Eltern ergreifen Besitz von ihren Kindern, binden sie an sich und beaufsichtigen sie fortwährend. Sie sind sehr fürsorglich, opfern sich für sie auf und erdrücken sie mit ihrer Liebe. Oft sehen sie in den Kindern den Sinn ihrer Existenz oder gehen in der Erziehung auf, weil sie in anderen Lebensbereichen keine Erfüllung finden.
(4) Autoritäre Erziehung: Die Eltern lenken das Verhalten ihrer Kinder fortwährend durch Anweisungen, Befehle und Verbote, prägen sie nach bestimmten Leitbildern und erzwingen ihren Gehorsam durch Strenge und (oft harte) Strafen. Zumeist haben sie wenig Verständnis für die kindliche Wesensart, sind sehr konformistisch oder fühlen sich durch die Selbstdifferenzierungsbestrebungen ihrer Kinder bedroht.
(5) Antiautoritäre Erziehung: Die Eltern verzichten entweder bewusst auf Regeln für das Verhalten ihrer Kinder, setzen sich ihnen gegenüber nicht durch oder können sich nicht auf bestimmte Normen einigen (zum Beispiel wegen starker Ehekonflikte). Sie wollen ihren Kindern entweder unbeschränkte Entfaltungsmöglichkeiten bieten, besitzen keine Techniken zur Verhaltenskontrolle oder stacheln die Kinder auf, um auf diese Weise die Erziehungsbemühungen ihrer Partner zu sabotieren und sie zu "strafen".
(6) Inkonsistente Erziehung: Die Eltern haben unterschiedliche Erziehungsstile (wobei also jeder einen bestimmten praktiziert) oder wechseln fortwährend zwischen zwei Erziehungsstilen.
In all diesen Fällen werden den Kindern keine optimalen Entwicklungsbedingungen geboten. Sie fühlen sich abgelehnt und ungeliebt (bei Vernachlässigung), entwickeln keine Leistungsbereitschaft und kein Selbstvertrauen (bei Verwöhnung), bleiben von ihren Eltern abhängig (bei Überbehütung), werden in ihrer Individuation behindert (autoritäre Erziehung), lernen keine Selbstkontrolle (antiautoritäre Erziehung) oder sind orientierungslos (inkonsistente Erziehung).
Oft machen Eltern auch bei der Geschlechtserziehung Fehler. So mögen sie die Neugierde ihrer Kinder hinsichtlich der Geschlechtsunterschiede unterdrücken und sie bei Masturbation streng bestrafen. Manchmal lehnen sie körperliche Zärtlichkeiten und Liebkosungen ab. In anderen, recht seltenen Fällen überschütten sie ihre Kinder mit Informationen über Sexualität, schicken sie bei Geschlechtsverkehr nicht aus dem Schlafzimmer oder stimulieren verfrüht sexuelle Bedürfnisse. Vielfach haben Kinder aber auch Schwierigkeiten bei der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität, wenn ein Rollenmodell (zum Beispiel wegen mangelndem Kontakt) ausfällt, die (Geschlechts-)Beziehung ihrer Eltern gestört ist oder extreme Geschlechtsrollenleitbilder vertreten werden.
Sind Kinder den beschriebenen Einflüssen ausgesetzt, werden sie oft psychisch krank und verhaltensauffällig. Ihre Symptome sind dann verständliche und sinnvolle Reaktionen auf eine gestörte Umwelt. Sie sind eine Funktion zwischenmenschlicher Beziehungen und können nur im Kontext des Familienlebens verstanden werden. Zudem gewinnen die Kinder durch ihre Symptome eine gewisse Machtposition, werden diese von ihren Eltern (und anderen Personen) durch Aufmerksamkeit, Fürsorge, Unterstützung usw. verstärkt. Zugleich signalisieren die Kinder aber auch durch ihre Symptome, dass sie leiden, dass ihre Familienverhältnisse gestört sind und dass sowohl sie als auch andere Familienmitglieder hilfsbedürftig sind.
Viele Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen liegen aber auch außerhalb der Familie. So ist für Kinder sehr belastend, wenn sie keine gleichaltrigen Freunde haben oder in Gruppen keine Beachtung finden. Dann fühlen sie sich einsam, ziehen sich immer mehr zurück und entwickeln ein negatives Selbstbild. In anderen Fällen versuchen sie, durch auffällige Verhaltensweisen (Gewalt, Clownerei, sexuelle Aktivität usw.) die Aufmerksamkeit der Gleichaltrigen auf sich zu ziehen und ihre Position in der Gruppe zu verbessern. Jedoch kann es sich auch negativ auswirken, wenn Jugendliche zu enge Beziehungen zu Gleichaltrigen eingehen, sich deren Einfluss unterwerfen und dadurch in ihrem Prozess der Selbstdifferenzierung gehemmt werden. Bestimmte Subkulturen wie Jugendsekten oder extreme politische Gruppierungen können sie zudem ihrer Familie und der Gesellschaft entfremden.
Andere Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten können im Schulsystem liegen. So leiden viele Kinder und Jugendliche unter Konflikten mit Lehrern und Klassenkameraden, unter Schulstress, Über- oder Unterforderung, Schulversagen und Schulangst. Diese Probleme wirken sich auch auf das Familienleben aus und können die Eltern-Kind-Beziehung stark belasten, insbesondere wenn die Eltern ihre Kinder für Schulschwierigkeiten verantwortlich machen, sie nicht verstehen und ihnen nicht helfen. Sie können ferner dadurch verschärft werden, dass Eltern und Lehrer nicht miteinander reden, einander wechselseitig für die Probleme verantwortlich machen und gegeneinander arbeiten.
Vielfach wirkt sich auch negativ aus, dass das Bildungssystem Kinder und Jugendliche aus der Gesellschaft ausgrenzt und ihnen ein in vielerlei Hinsicht problematisches Bild von ihr vermittelt. Viele junge Menschen haben Angst vor der Welt der Erwachsenen, die sie als inhuman, fremd und abschreckend sowie durch atomare Vernichtung und Umweltverschmutzung als bedroht erleben. Dementsprechend nehmen sie eine kritische Haltung gegenüber dem Staat und seinen Institutionen ein. Oft leiden sie unter Konflikten zwischen ihren hohen Ansprüchen an sich selbst und ihren mangelnden Fähigkeiten, zwischen gesellschaftlich dominanten Werten und ihren individuellen Bedürfnissen, zwischen ihren Idealen und der Realität. Manche integrieren sich nicht in die Gesellschaft, rebellieren gegen sie und experimentieren mit neuen Formen des Zusammenlebens und Wirtschaftens. Andere fürchten den Eintritt in das Berufsleben und die Welt der Erwachsenen so sehr, dass sie ihn immer weiter aufschieben. Sie wollen sich dem Wettbewerb nicht stellen und keine Verpflichtungen übernehmen.
Aber auch manche Eltern erleben die Arbeitswelt als belastend und tragen Probleme aus ihr in die Familie hinein. Manchmal benutzen sie dann ihre Kinder als Sündenböcke und reagieren die im Beruf angesammelten Spannungen an ihnen ab. Viele Eltern kommen erschöpft, gestresst oder frustriert nach Hause und wollen daheim in erster Linie entspannen und sich regenerieren. So wollen sie von ihren Kindern nicht gestört werden, kümmern sich nur wenig um sie und reagieren oft überreizt und vorschnell. Auch erfolgsorientierte Eltern, die oft Überstunden machen oder Arbeit mit nach Hause nehmen, haben häufig nur wenig Zeit für ihre Kinder. Sie stellen zudem vielfach zu hohe Anforderungen an sie oder behandeln sie sogar wie Untergebene - wobei sie jedoch vor allem bei Jugendlichen auf Ablehnung, Widerstand oder offene Rebellion stoßen.
Gewalt in der Familie
Misshandlung von Ehepartnern
Gesicherte Befunde über die Häufigkeit der Misshandlung von Ehepartnern liegen nicht vor; auch Zahlen aus amtlichen Berichten sind wenig verlässlich: "Nach Schätzungen werden jährlich bis zu 4 Mio. Frauen von ihren Ehemännern in der Bundesrepublik Deutschland misshandelt" (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1989: 69). Auch ist wahrscheinlich in jeder fünften Ehe die Ehefrau von ihrem Gatten zumindest einmal vergewaltigt worden (a.a.O.). Bei einer bundesweiten Umfrage gaben 13% der Befragten an, gegenüber dem Partner körperlich aggressiv geworden zu sein (Wahl/Stich/Seidenspinner 1989).
Gewalt in der Ehe (einschließlich der Vergewaltigung des Partners) kommt in allen Gesellschaftsschichten vor und tritt oft jahrelang auf. Frauen sind jedoch nur in Einzelfällen gewalttätig, wobei ein derartiges Verhalten oft der Selbstverteidigung dient. Aufgrund ihrer schwächeren Körperkräfte können sie zudem ihren Ehemännern nur wenig Schaden zufügen.
Gewalt in der Ehe kommt vielfach in sozial isolierten Familien vor, deren Mitglieder nur wenig Freunde haben und selten ihre Freizeit mit anderen Menschen verbringen. So versuchen sie, alle Bedürfnisse in der Familie zu befriedigen - was leicht zur Überforderung der anderen Personen führen kann. Auch kann bei Familienkrisen nur mit wenig Unterstützung aus dem Netzwerk gerechnet werden. Viele gewalttätige Ehemänner wurden in ihrer Kindheit selbst misshandelt oder erlebten mit, wie ihre Mütter von ihren Vätern geschlagen wurden. So ist für sie Gewalt in der Familie etwas "Normales", folgen sie dem Beispiel ihrer Eltern. Häufig haben sie wenig Erfolg im Beruf (unerfüllte Erwartungen), erleben Probleme am Arbeitsplatz, sind arbeitslos oder fühlen sich aufgrund fehlender Hobbys unausgelastet. Die Erfahrung wiederholten Versagens hat bei ihnen zu einem negativen Selbstbild, Unsicherheit und dem Eindruck der Machtlosigkeit geführt. Durch Gewaltanwendung kompensieren sie nun ihre Minderwertigkeitsgefühle: Wenn sie ihre Frauen schlagen, erleben sie sich als männlich, stark und mächtig.
In anderen Fällen resultiert Gewaltanwendung aus Ehekonflikten. Vor allem wenn Männer unreif sind, eine geringe Frustrationstoleranz besitzen, wenig Kontrolle über ihre Gefühle haben, starken Gefühlsschwankungen unterliegen, besonders sensibel auf Kritik reagieren oder bei verbalen Auseinandersetzungen ihren Frauen aufgrund schlechterer Kommunikationsfähigkeiten unterlegen sind, mögen sie bei Konflikten gewalttätig werden. Viele Ehemänner sind auch sehr autoritär und dominant, bestimmen über alle Bereiche des Familienlebens. Sie vertreten die Auffassung, dass die Männer in ihren Familien das Sagen haben und die Frauen sich ihnen unterwerfen sollen. So greifen sie rigoros durch, wenn diese ihnen widersprechen oder sonst wie ihre Autorität antasten. In anderen Fällen glauben gewalttätige Männer, dass ihre Frauen ihr Besitz wären, ihnen aber nicht zu trauen sei. Sie rechnen fortwährend mit außerehelichen Affären, überwachen ihre Partnerinnen andauernd und reagieren mit Eifersucht und schließlich mit Gewalt auf jeden engeren Kontakt ihrer Frauen zu Dritten. Generell sehen die Männer kein Problem in ihrer Gewalttätigkeit und empfinden dementsprechend keine Reue. Sie schreiben die Schuld für ihr Verhalten ihren Frauen zu und halten es somit für gerechtfertigt. Handeln sie unter Alkoholeinfluss, machen sie den Alkohol für ihre mangelnde Selbstbeherrschung verantwortlich.
Geschlagene Frauen akzeptieren in der Regel ihre Männer als Familienoberhäupter, ordnen sich ihnen unter, sind unterwürfig und versuchen zumeist, deren Wünsche zu erfüllen. Oft erleben sie sich als inkompetent, wertlos oder nicht liebenswert und leiden unter negativen Selbstwertgefühlen. Sie halten sich vielfach für schuldig, wenn sie von ihren Partnern geschlagen werden. Häufig wehren sie sich auch nicht, da sie schon als Kinder misshandelt wurden und eine Opferrolle verinnerlicht haben. Zumeist brechen sie nicht aus der Ehe aus, da sie von ihren Partnern abhängig sind und sich selbst als unselbständig und unfähig erleben. Sie haben oft Alpträume, schlafen schlecht, leiden unter psychosomatischen Beschwerden, sind energielos und verzweifelt. Vereinzelt besteht Selbstmord- oder Mordgefahr. Viele Frauen, deren Männer gewalttätig sind, finden wenig Verständnis bei Netzwerkmitgliedern, die sie zum Beispiel für masochistisch halten, ihnen ein "falsches" Verhalten gegenüber ihren Partnern unterstellen oder ihnen die Schuld für ihre "Bestrafung" zuschreiben. Auch für Kinder hat es unerwünschte Folgen, wenn sie miterleben, wie ihre Mütter geschlagen werden. So ist beispielsweise mit negativen Auswirkungen auf ihre Geschlechtsrollenidentität und ihr Selbstbild zu rechnen.
Gewalt gegen alte Familienmitglieder
Erst im Verlauf der letzten Jahre ist erkannt und öffentlich angesprochen worden, dass es in manchen Familien auch zur Gewaltanwendung gegenüber alten oder pflegebedürftigen Mitgliedern kommt. In diesen Fällen leiden viele Täter unter Persönlichkeitsstörungen, besitzen wenig Selbstkontrolle, sind unreif, unsicher, wenig belastbar, impulsiv, leicht erregbar und intolerant. Manche sind ihren alten oder pflegebedürftigen Elternteilen gegenüber autoritär, dominant und kontrollierend, zeigen nur wenig Respekt für sie. Häufig verstehen sie Alterungsprozesse nicht und fassen deshalb störende und auffällige Verhaltensweisen, die aus altersbedingten psychischen Störungen (Demenz, Depression usw.) resultieren, als absichtliche Provokation auf. In diesen Situationen reagieren sie dann oft gewalttätig.
Die meisten Täter haben sich in ihr Schicksal ergeben, dass sie die alten oder pflegebedürftigen Familienmitglieder versorgen müssen. Sie glauben, dass sie ein großes Opfer erbringen, für das niemand sie entschädigen wird. So erleben sie die alten Menschen als Bürde, fühlen sich ausgebeutet und benachteiligt. Sie empfinden Feindseligkeit und Wut ihnen gegenüber, die sich dann in Gewalttätigkeiten entladen können. In vielen Fällen fühlen sich auch die Täter durch ihre pflegerischen Aufgaben körperlich und psychisch überlastet, wobei der hieraus resultierende Stress noch durch die Erfahrung mangelnder Unterstützung durch Dritte, das enge Zusammenleben, gestörte Kommunikationsprozesse oder Eheprobleme intensiviert werden kann. Manche nehmen dann alkoholische Getränke oder andere Suchtmittel zu sich, weil sie glauben, dass sie auf diese Weise mit der andauernden Überforderung besser fertig werden können. Der fortwährende Stress, die Überreiztheit, der Alkoholmissbrauch usw. können dann dazu führen, dass die Pflegepersonen in bestimmten Situationen "die Nerven verlieren" und gewalttätig werden.
Die alten Familienmitglieder sind sehr verletzlich, da sie aufgrund von mangelnder Kompetenz, Senilität, Krankheit usw. von ihren Pflegepersonen abhängig sind, oft an die Wohnung gebunden sind und kaum noch Freunde haben. Viele fühlen sich nutzlos oder als Bürde. Werden sie misshandelt, so sind sie häufig verzweifelt, verängstigt, verwirrt oder wütend und verlieren mehr und mehr an Selbstachtung. Sie fühlen sich hilflos, da sie nicht wissen, was sie in dieser Situation machen sollen und wie sie sich vor weiteren Gewalttätigkeiten schützen können. Manchmal provozieren sie aber auch ihre Pflegepersonen, indem sie zum Beispiel immer mehr von ihnen fordern und nie zufrieden sind.
Kindesmisshandlung
In der Erziehung von Kindern wird noch immer von körperlicher Züchtigung Gebrauch gemacht. So werden in 10 bis 16% aller Familien Kinder mit Gegenständen geschlagen (Engfer 1988). In schätzungsweise 400.000 Fällen pro Jahr kommt es zu Kindesmisshandlung; allerdings wird nur ein Bruchteil polizeilich erfasst (Bundesregierung 1986b; Kannen 1986). Jedoch sind diese Angaben wenig verlässlich und vermitteln kein klares Bild. Neben Kindern, die körperlich und/oder psychisch misshandelt werden, werden auch viele vernachlässigt. Sie erhalten nicht das für eine gesunde Entwicklung notwendige Maß an Ernährung, Pflege, Schutz, Aufsicht, Erziehung usw. Während Kindesmisshandlung in allen Schichten vorkommt, wird von Vernachlässigung insbesondere bei Armut, sozialer Randständigkeit und Suchtmittelmissbrauch berichtet.
Gewalttätige Eltern wurden oft selbst als Kinder misshandelt; sie lernten, körperliche Züchtigung als akzeptable Erziehungstechnik zu betrachten (Zyklus der Gewalt). Aufgrund ihrer schlechten familialen Entwicklungsbedingungen haben sie häufig psychische und Persönlichkeitsstörungen ausgebildet. Auch sind sie unreif und besitzen nur wenig Selbstachtung. Oft kommt es zu Kindesmisshandlung, wenn die Eltern in psychisch belastende Stresssituationen geraten, also zum Beispiel Familienkrisen, Ehekonflikte, berufliche Misserfolge oder wirtschaftliche Not erleben, arbeitslos werden oder Probleme beim Übergang von einer Phase des Familienzyklus in die Nächste erleben. Sie können die aus diesen Belastungen resultierenden Affekte nicht mehr kontrollieren und geben den Druck an ihre Kinder weiter. Zu ähnlichen Situationen kann es kommen, wenn die Eltern aufgrund einer hohen Kinderzahl überfordert sind oder in einer sehr kleinen Wohnung leben und sich somit fortwährend durch das Verhalten ihrer Kinder gestört fühlen.
Manche Eltern misshandeln auch ihre Kinder, wenn diese ihren hohen emotionalen Ansprüchen oder Leistungserwartungen nicht genügen, also zum Beispiel auf der Schule versagen. Andere lehnen die Kinder bewusst oder unbewusst ab, da diese beispielsweise unerwünscht waren, nichtehelich geboren wurden, als Sündenböcke benötigt werden, behindert sind, kränkeln oder Entwicklungsstörungen aufweisen. Wenn Eltern bei verhaltensauffälligen oder von ihnen als "schwierig" erlebten Kindern mit ihren Erziehungsbemühungen scheitern, reagieren manche aus ihrer Hilflosigkeit, Ohnmacht und Überforderung heraus mit Gewalt. In anderen Fällen werden Kinder misshandelt, weil ihre Eltern aufgrund mangelnder erzieherischer Kompetenzen nicht mit ihnen fertig werden oder einen sehr autoritären Erziehungsstil praktizieren ("Wer sein Kind liebt, der züchtigt es").
Eltern, die ihre Kinder misshandeln, betrachten diese zumeist als unfertige und damit noch nicht vollwertige Personen, die auch geschlagen werden dürfen. Sie übersehen, dass sie ihnen auf diese Weise körperliche und seelische Schäden zufügen. So fallen ihre Kinder zum Beispiel durch Antriebsarmut, Rückzugstendenzen, Misstrauen, negative Selbstwertgefühle, Einnässen, Schlafstörungen, Aggressivität, dissoziale Verhaltensweisen, Lern- und Leistungsstörungen auf. Sie wirken oft verängstigt, halten von ihren Eltern Abstand und sind vielfach überangepasst.
Sexueller Missbrauch und Inzest
Pro Jahr werden etwas mehr als 10.000 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern registriert. Aufgrund der sehr hohen Dunkelziffer wird jedoch von 150.000 bis 300.000 Fällen ausgegangen (Bundesregierung 1985; Kannen 1986; Saller 1986), wobei diese Zahlen aber letztlich nur Vermutungen sind. Fast immer werden Mädchen sexuell missbraucht; etwa 95% der Täter sind männlich. In rund 80% der Fälle kennen die Kinder den Täter; der Tatort ist in der Regel die Wohnung des Opfers oder des Täters. Sehr oft werden Kinder von ihren Vätern missbraucht – Mädchen in Stieffamilien sind besonders gefährdet. Inzest kommt in allen Gesellschaftsschichten vor und zieht sich oft über Monate und Jahre hinweg.
Bei vielen Tätern sind keine psychischen Auffälligkeiten festzustellen; andere leiden unter Persönlichkeitsstörungen, Stress oder inner- und außerfamilialen Problemen. Sie haben häufig nur wenig Außenkontakte, sodass sie hinsichtlich ihrer Bedürfnisbefriedigung überwiegend auf die eigene Familie angewiesen sind.
Viele Väter, die ihre Kinder in inzestuöse Beziehungen verwickeln, betrachten sie als ihren Besitz. Sie glauben, dass ihre Kinder auch für sexuelle Kontakte verfügbar seien, und halten dies für unschädlich. Manchmal werden sie in der beschriebenen Auffassung durch Kinderpornos oder andere pornographische Medienprodukte bestärkt, die oft auch den Anstoß für inzestuöse Handlungen geben. In anderen Fällen haben sich die Väter ihren Partnerinnen entfremdet, tragen fortwährend mit ihnen Konflikte aus oder erleben den Geschlechtsverkehr mit ihnen als langweilig. So benutzen sie ihre Kinder als Partnerersatz, um ihre Bedürfnisse nach Intimität und Nähe zu befriedigen. Entgegen weit verbreiteten Vorurteilen werden sie nicht von ihren Töchtern verführt. Ein eventuell in der Pubertät oder Vorpubertät auftretendes Kokettieren von Mädchen muss als normales altersspezifisches Verhalten verstanden werden.
Väter (aber auch Brüder und andere Verwandte) missbrauchen ihre Kinder nur selten unter Einsatz von Gewalt. Zumeist versuchen sie, ihre Kooperation zu gewinnen, indem sie schrittweise vorgehen. So achten sie nicht die Intimsphäre ihrer Kinder, zeigen sich ihnen nackt und machen dabei vor allem auf ihre Genitalien aufmerksam. Dann verwickeln sie sie in immer intimere Aktivitäten, die als Spiel, notwendige Aufklärung oder etwas ganz "Normales" deklariert werden. In anderen Fällen erpressen sie ihre Kinder, indem sie sexuelle Handlungen als Zeichen der Zuneigung verlangen. Oft versprechen sie ihnen aber auch Belohnungen oder besondere Privilegien. Sie verpflichten ihre Kinder zur Geheimhaltung, wobei sie auch von Strafandrohungen Gebrauch machen. Dennoch haben die Mütter zumeist von den inzestuösen Beziehungen Kenntnis. Sie schützen ihre Kinder jedoch nicht und ignorieren deren Signale, da sie Angst vor ihren Partnern haben oder einen Skandal befürchten. Manchmal entlasten sie sich auch von einer Überforderung durch ihre Ehemänner im sexuellen Bereich, indem sie ihre Kinder bewusst oder unbewusst als Ersatz anbieten.
Die Kinder sind ihren Eltern in inzestuösen Beziehungen hilflos ausgeliefert und werden in die Rolle eines Opfers hineinsozialisiert. Manchmal leiden sie unter Unterleibsschmerzen, Verletzungen im Genitalbereich, Infektionen, Wundsein oder sogar Geschlechtskrankheiten. Sie reagieren auf den sexuellen Missbrauch zum Beispiel mit Schuldgefühlen, Scham, Verwirrung, regressivem Verhalten, Rückzug, Schlafstörungen, sexuellen Auffälligkeiten, Rollenverwirrung, psychosomatischen Beschwerden, Depressionen, Zwangshandlungen, Schulversagen, selbstdestruktivem Verhalten oder Promiskuität.
Wird der sexuelle Missbrauch zufällig oder durch die Betroffenen aufgedeckt (zum Beispiel aus Angst vor Schwangerschaft oder aus dem Bestreben heraus, einen Geschwisterteil zu schützen), kommt es oft zu einer Familienkrise. Häufig leugnet der Vater die Tat oder macht das Kind mitschuldig. Zumeist wird der Vorfall vertuscht (auch wenn der sexuelle Missbrauch durch Geschwister oder andere Verwandte erfolgte), da die Familienmitglieder eine Gerichtsverhandlung, einen möglichen Gefängnisaufenthalt und das damit verbundene öffentliche Aufsehen vermeiden wollen.
Nachwort
Abschließend soll noch die Frage gestellt werden, welche Hilfsangebote für die in Teil 3 dieses Buches beschriebenen Familienprobleme und Problemfamilien zur Verfügung stehen. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurde eine fast unüberschaubare Vielfalt an Maßnahmen entwickelt, die zum Beispiel Familien-, Ehe-, Erziehungs-, Scheidungs-, Schwangeren- und Schuldnerberatung, Eltern- und Familienarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Selbsthilfegruppen, Sozialpädagogische Familienhilfe, Heimerziehung, Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit sowie besondere Angebote für sozial schwache, Teil-, Zweit- und Ausländerfamilien, für Familien mit pflegebedürftigen, behinderten und psychisch kranken Mitgliedern umfassen. Hierauf kann in dieser Veröffentlichung nicht eingegangen werden. Einen umfassenden Überblick über die erwähnten Hilfsangebote bieten die Beiträge des Taschenbuchs "Hilfen für Familien. Ein Handbuch für psychosoziale Berufe" (Textor 1990), in dem auch gesetzliche Grundlagen für die Arbeit mit Familien dargestellt werden; hilfreich ist auch der Sammelband "Eltern- und Familienarbeit. Familie zwischen Selbsthilfe und professioneller Hilfe" (Hohmeier/Mair 1989).
Neben einer breiten Palette von Beratungs- und Hilfsangeboten für Familien mit besonderen Problemen und Belastungen bieten Staat, Kommunen und Wohlfahrtsverbände auch eine allgemeine Förderung von Familien an, um einen Teil der Kinderlasten zu kompensieren, die familialen Lebensbedingungen zu verbessern und dem Grundgesetzauftrag des Artikels 6 gerecht zu werden. Einen Überblick über finanzielle Leistungen und Steuererleichterungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs bieten - neben kostenlosen Broschüren der zuständigen Bundes- und Landesministerien - die Bücher "Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland" (Münch 1990) und "Familienpolitik" (Textor 1991). Letzteres stellt auch in komprimierter Form familienorientierte Maßnahmen des Sozialwesens vor.
Die Bedeutung einer umfassenden Förderung der Familie wurde beispielsweise schon von der Frauenrechtlerin Bäumer am Schluss ihres 1933 veröffentlichten Buches "Familienpolitik" betont: "Der Inbegriff der Politik eines Volkes ist die Frage: Was habt ihr euren Kindern zu bieten? Und eine solche Politik führt an den Ursprung zurück: sie beginnt bei der Familie" (S. 77).
Es ist zu hoffen, dass im Jahr 1994, das von den Vereinten Nationen zum "Internationalen Jahr der Familie" erklärt wurde, die Probleme von Familien noch deutlicher werden und es zu einer weiteren Verbesserung ihrer Lage und der für sie zur Verfügung stehenden Hilfsangebote kommen wird.
Literatur
Allerbeck, K./Hoag, W. J.: Jugend ohne Zukunft? Einstellungen, Umwelt, Lebensperspektiven. München 1985
Ariés, P.: Geschichte der Kindheit. München, 4. Aufl. 1977
Aristoteles: Nikomachische Ethik. Stuttgart 1969
Articus, S./Karolus, S.: Pflegebedürftige alte Menschen in der Familie. Probleme und Belastungen pflegender Angehöriger und die Möglichkeiten ihrer Unterstützung im Rahmen kommunaler Sozialpolitik. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 1985, 65, S. 41-48
Auge, M.: Humanvermögen, Sozialisation und Familienlastenausgleich. Zur vermögenstheoretischen Perspektive in der Familienpolitik. Spardorf 1984
Bäumer, G.: Familienpolitik. Probleme, Ziele und Wege. Berlin 1933
Bargel, T./Fauser, R./Mundt, J. W.: Lokale Umwelten und familiale Sozialisation: Konzeptualisierung und Befunde. In: Vaskovics, L. A. (Hrsg.): Umweltbedingungen familialer Sozialisation. Beiträge zur sozialökologischen Sozialisationsforschung. Stuttgart 1982, S. 204-236
Bayerisches Staatsministerium des Innern/Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung: Alkohol, Drogen, Medikamente, Tabak. Jugend fragt Jugend. Repräsentativerhebungen bei Jugendlichen in Bayern 1973, 1976, 1980, 1984. München 1986
Bebel, A.: Die Frau und der Sozialismus. Hannover 1974
Becker-Schmidt, R./Knapp, G. A.: Arbeiterkinder gestern - Arbeiterkinder heute. Erziehungsansprüche und -probleme von Arbeiterinnen im intergenerativen Vergleich. Bonn 1985
Behr, S.: Junge Kinder in Einelternfamilien. Auswirkungen der sozialen und wirtschaftlichen Lage von Einelternfamilien auf die Entwicklungschancen der Kinder. Bonn o. J.
Berg-Laase, G./Berning, M./Graf, U./Jacob, J.: Verkehr und Wohnumfeld im Alltag von Kindern. Pfaffenweiler 1985
Bertram, H.: Solidarität, soziale Räume und die Organisation von Zeit als Aspekte einer zukunftsorientierten Familienpolitik. Vortrag auf dem familienpolitischen Kongress der CSU in Bayreuth, 21. Juli 1990
Bethusy-Huc, V. Gräfin von: Familienpolitik. Aktuelle Bestandsaufnahme der familienpolitischen Leistungen und Reformvorschläge. Tübingen 1987
Beuys, B.: Familienleben in Deutschland. Neue Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Reinbek 1980
Bolte, K. M./Hradil, S.: Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen 1984
Bolton, F. G./Bolton, S. R.: Working with violent families. A guide for clinical and legal practitioners. Newbury Park 1987
Bowen, M.: Family therapy in clinical practice. New York: Aronson 1978
Braun, B. von: Armut auf dem Lande - Erscheinungsformen und Ursachen in Südniedersachsen. Göttingen l985
Braun, H./Articus, S.: Die häusliche Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen. Eine empirische Untersuchung der Erscheinungsformen, Probleme und Unterstützungsmöglichkeiten. Melle 1984
Brigitte/Metz-Göckel, S./Müller, U.: Brigitte Untersuchung 85: Der Mann. Eine repräsentative Untersuchung über die Lebenssituation und das Frauenbild 20- bis 50-jähriger Männer im Auftrag der Zeitschrift Brigitte. Hamburg 1985
Brinkmann, C.: Die individuellen Folgen langfristiger Arbeitslosigkeit. Ergebnisse einer repräsentativen Längsschnittuntersuchung. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1984, 17, S. 454-473
Bronfenbrenner, U.: Recent advances in research on the ecology of human development. In: Silbereisen, R. K./Eyferth, K./Rudinger, G. (Hrsg.): Development as action in context. Problem behavior and normal youth development. Berlin 1986, S. 287-309
Buchholz, W.: Lebensweltanalyse. Sozialpsychologische Beiträge zur Untersuchung von krisenhaften Prozessen in der Familie. München 1984
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): ... es begann in Berlin. Bilder und Dokumente aus der deutschen Sozialgeschichte. Bonn 1987
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch 1989. Arbeits- und Sozialstatistik. Bonn 1989
Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.): Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1989
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.): Zweiter Familienbericht. Familie und Sozialisation. Bonn 1975
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.): Nichteheliche Lebensgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1985
Bundesregierung: Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland - Zur psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung. Drucksache 7/4200. Bonn 1975
Bundesregierung: Sexueller Missbrauch von Kindern. Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN. Drucksache 10/3845. Bonn 1985
Bundesregierung: Die Situation der älteren Menschen in der Familie. Vierter Familienbericht. Drucksache 10/6145. Bonn 1986a
Bundesregierung: Kindesmisshandlung und -vernachlässigung in der Bundesrepublik Deutschland. Antwort auf die Große Anfrage der Abgeordneten Frau Wagner und der Fraktion DIE GRÜNEN. Drucksache 10/5460. Bonn 1986b
Bundesregierung: Lebenssituation der Kinder in der Bundesrepublik Deutschland. Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Gilges und anderen Drucksache 10/4623. Bonn 1986c
Cicirelli, V. G.: Sibling relationships throughout the life cyle. In: L'Abate, L. (Hrsg.): The handbook of family psychology and therapy (Bd. 1). Chicago 1985, S. 177-214
Conen, G.: Was wissen wir über die soziale Lage der Familien und der Kinder? In: Familienpolitische Informationen 1989, 28, S. 2-6
Cornelius, I.: Zur Einkommenslage von Familien. In: Dokumentation der Referate, die während der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft im Arbeitskreis Bevölkerungsökonomie vom 3. bis 5.10.1984 in Buchenbach gehalten wurden. Wiesbaden 1985, S. 69-91
Cornelius, I./Linder, P./Rückert, G.-R.: Ökonomische Rahmenbedingungen der Familien. Stuttgart 1986
Deutscher Kinderschutzbund (Hrsg.): Wenn Eltern zuschlagen ... Gesellschaftliche Voraussetzungen und Bedingungen der Kinderschutzarbeit. Hannover 1985
Die Familie in der Bundesrepublik Deutschland (Informationen zur politischen Bildung, Nr. 206). Bonn 1985
Dietrich, G.: Erziehungsvorstellungen von Eltern. Ein Beitrag zur Aufklärung der subjektiven Theorie der Erziehung. Göttingen 1985
Dittrich, K. A.: Familienalltag und Familienbeziehung. Eine Explorationsstudie. Frankfurt/Main 1985
Ebel, H./Eickelpasch, R./Kühne, E.: Familie in der Gesellschaft. Gestalt - Standort - Funktion. Bonn 1983
Ehekommission der Evangelischen Kirche in Deutschland: Erwägungen zum evangelischen Eheverständnis. In: Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Ehe, Familie, Sexualität, Jugend. Gütersloh 1981, S. 53-56
EMNID-Institut: Adam und Eva '85 - Idealvorstellungen von Mann und Frau. In: EMNID-Informationen 1985a, 37, S. 25-29
EMNID-Institut: Die größten Probleme bundesdeutscher Familien. EMNID-Informationen 1985b, 37, S. 18-19
EMNID-Institut: Gleichberechtigung im Haushalt lässt weiter auf sich warten. EMNID-Informationen 1986a, 38, S. 22-24
EMNID-Institut: Wichtigste Lebensinhalte von Männern und Frauen. EMNID-Informationen 1986b, 38, S. 19-20
EMNID-Institut: Paare ohne Trauschein aus der Sicht der Bundesbürger. EMNID-Informationen 1986c, 38, S. ll-13
EMNID-Institut: Sind die Deutschen kinderfeindlich? EMNID-Informationen 1986d, 38, S. 22-24
EMNID-Institut: Gehorsam und Unterordnung als Erziehungsziel kaum noch gefragt. EMNID-Informationen 1986e, 38, S. 20-22
EMNID-Institut: Altersnormen für Kinder und Jugendliche. EMNID-Informationen 1986f, 38, S. 23-24
Engfer, A.: Ursachen für Gewalt gegen Kinder in Familie und Gesellschaft - Wie lässt sich Gewalt verhindern? In: IFP-Nachrichtendienst 1988, 4, S. 11-12
Erler, G./Jaeckel, M./Pettinger, R./Sass, J.: Brigitte Untersuchung 88. Kind? Beruf? Oder beides? Hamburg 1988
Evangelische Kirche in Deutschland. Kommission für sexualethische Fragen: Denkschrift zu Fragen der Sexualethik. In: Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Ehe, Familie, Sexualität, Jugend. Gütersloh 1981, S. 139-173
Evangelisches Soziallexikon. Stuttgart, 7. Aufl. 1980
Familienbund der Deutschen Katholiken. Landesverband Hessen (Hrsg.): Ehe und Familie in kirchlichen Verlautbarungen. Frankfurt/Main 1986
Familienwissenschaftliche Forschungsstelle: Familie im Wandel. Überblick über Auswirkungen demographischer, wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen auf Familie und Gesellschaft. Stuttgart 1985
Fauser, R.: Zur Isolationsproblematik von Familien. Sozialisationstheoretische Überlegungen und empirische Befunde. München 1982
Frör, H.: Familienfragen im Neuen Testament. In: Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (Hrsg.): Reden für die Familie. Karlsruhe 1985, S. 10-21
Galanis, G.: Griechische Migrantenmädchen von 15 bis 18 Jahren in Deutschland. In: Stiksrud, A./Wobit, F. (Hrsg.): Adoleszenz und Postadoleszenz. Beiträge zur angewandten Jugendpsychologie. Eschborn 1985, S. 126-137
Gloger-Tippelt, G.: Der Übergang zur Elternschaft. Eine entwicklungspsychologische Analyse. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 1985, 17, S. 53-92
Görres, S.: Leben mit einem behinderten Kind. München 1987
Großjohann, K.: Belastungen der Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen - Entlastungsmöglichkeiten durch neue Vorschläge zur sozialen Sicherung bei Pflegebedürftigkeit. In: Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (Hrsg.): Die ältere Generation. Last und Chance für Familie und Gesellschaft. Bonn 1985, S. 29-37
Grunddaten zur Situation älterer Menschen in Bayern: Arbeit und Soziales 1984, 39, S. 57-81
Gysi, J.: Familienleben in der DDR: Zum Alltag von Familien mit Kindern. Berlin 1989
Hagemann-White, C.: Sozialisation: Weiblich - männlich? Opladen 1984
Heilig, G.: Heiratsalter und Fruchtbarkeit bei deutschen Ehepaaren. Wiesbaden 1985
Helwig, G.: Jugend und Familie in der DDR. Leitbild und Alltag im Widerspruch. Köln 1984
Herlth, A./Strohmeier, K. P.: Sozialpolitik und der Alltag von Kindern. In: Vaskovics, L. A. (Hrsg.): Umweltbedingungen familialer Sozialisation. Beiträge zur sozialökologischen Sozialisationsforschung. Stuttgart 1982, S. 307-329
Herlyn, I.: Wohnung und Wohnumwelt. Wohnverhältnisse der Familien und familienorientierte Wohnungsbaupolitik. In: Weigelt, K. (Hrsg.): Familie und Familienpolitik. Zur Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Melle 1985, S. l05-116
Herzberg, I./Ledig, M.: Was tun Kinder nach der Schule? Eine empirische Studien zum Freizeitverhalten von Kindern in der mittleren Kindheit. In: Informationsdienst Nr. 8 der DGfE Kommission "Pädagogik der Frühen Kindheit" 1990, S. 40-42
Hessische Landesregierung: Antwort auf die Große Anfrage der Abg. Schmidt und anderen betreffend Lage der Familie in Hessen. Drucksache 11/6386. Wiesbaden 1986a
Hessische Landesregierung: Antwort auf die Große Anfrage der Abg. Dr. Streletz und anderen betreffend Lage der Familien in Hessen. Drucksache 11/6708. Wiesbaden 1986b
Hille, B.: Familie und Sozialisation in der DDR. Opladen 1985
Hohmeier, J./Mair, H. (Hrsg.): Eltern- und Familienarbeit. Familien zwischen Selbsthilfe und professioneller Hilfe. Freiburg 1989
Hornstein, W./Lüders, C.: Arbeitslosigkeit - und was sie für Familie und Kinder bedeutet. In: Zeitschrift für Pädagogik 1987, 33, S. 595-614
Hubbard, W. H.: Familiengeschichte. Materialien zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983
Hüttche, W.: Familieneinkommen - Familienaufwendungen. Unbefriedigende Einkommenssituation der Mehrkinderhaushalte. In: Stimme der Familie 1988, 35, S. 75-76
Institut für Demoskopie Allensbach: Die Situation der Frau in Baden-Württemberg. Eine Repräsentativuntersuchung unter Frauen, ihren Partnern und Kindern über die Situation der Frau im Spannungsfeld von Beruf und Familie. Stuttgart 1983a
Institut für Demoskopie Allensbach: Eine Generation später. Bundesrepublik Deutschland 1953 - 1979. München 1983b
Institut für Demoskopie Allensbach: Einstellungen zu Ehe und Familie im Wandel der Zeit. Eine Repräsentativuntersuchung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung Baden-Württemberg. Stuttgart 1985a
Institut für Demoskopie Allensbach: Familie im Brennpunkt. Ergebnisse einer neuen Repräsentativuntersuchung zu "Ehe und Familie". Allensbach 1985b
Jugendwerk der Deutschen Shell: Jugendliche und Erwachsene '85. Generationen im Vergleich. Bd. 1: Biographien – Orientierungsmuster - Perspektiven. Opladen 1985a
Jugendwerk der Deutschen Shell: Jugendliche und Erwachsene '85. Generationen im Vergleich. Bd. 3: Jugend der fünfziger Jahre - heute. Opladen 1985b
Kannen, M.: Problemskizze und Einleitung. In: Arbeitsgemeinschaft von Einrichtungen für Familienbildung (Hrsg.): Sexueller Missbrauch von Kindern. Das Schweigen brechen. Bonn 1986, S. 4-14
Kasten, H.: Geburtsrangplatz und Geschwisterposition. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 1986, 6, S. 321-328
Katholisches Soziallexikon. Innsbruck, 2. Aufl. 1980
Kinder der Arbeitslosen - Kinder der Krise (Teil I-IV). In: Sozialprisma 1987, 32, S. 14-15, 21, 32, 48, 61
Kluge, K.-J./Hemmert-Halswick, S.: Familie als Erziehungsinstanz. Teil I: Eltern in Not - Probleme in der Familienerziehung. Zur Notwendigkeit von Elternberatung und Elternarbeit. München 1982
Knirim, C./Krüll, M./Peters, R.: Familienstrukturen in Stadt und Land. Eine Untersuchung der Rollenbeziehungen zwischen den Ehegatten, den Eltern und Kindern und den Generationen. Bonn 1974
König, R.: Familie und Familiensoziologie. In: Bernsdorf, W. (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart, 2. Aufl. 1969, S. 247-262
Kössler, R.: Grundvermögen privater Haushalte. In: Baden-Württemberg in Wort und Zahl 1986, 34, S. 138-143
Kohlmann, C.-W./Krohne, H. W.: Der Einfluss elterlicher Erziehung auf die Leistung und Angst des Kindes in der Schule. Mainz 1985
Koschorke, M.: Zweite Familien und ihre Probleme in der Beratung. Berlin 1985
Krombholz, H.: Ergebnisse der Studie "Familie in Bayern 1986" (Manuskript). München 1987
Krüsselberg, H.-G./Auge, M./Hilzenbecher, M.: Verhaltenshypothesen und Familienzeitbudgets – Die Ansatzpunkte der "Neuen Haushaltsökonomik" für Familienpolitik. Stuttgart 1986
Kuhnt, M./Speil, W.: Zeit von Kindern - Zeit für Kinder. Ein empirischer Beitrag zur Dokumentation des Betreuungsaufwandes und der Erziehungsleistung für kleine Kinder. Hannover 1986
Kuratorium Deutsche Altershilfe: Hilfe und Pflege im Alter. Informationen und Ratschläge für die Betreuung und Versorgung zu Hause. Köln 1986
Lange, J.: Alternativ leben? - Gegenmodelle zu Ehe und Familie. Bonn 1981
Langenmayr, A.: Unvollständigkeit von Familien und ihre Auswirkung auf die Kinder. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1987, 36, S. 249-256
Löw, K. (Hrsg.): Marxismus. Quellenlexikon. Köln 1985
Loos, R.: Zahlen und Daten. Entwicklungen der letzten Jahre. In: Stimme der Familie 1987, 34, S. 114-116
Lüscher, K.: Familie als Solidargemeinschaft aller Familienangehörigen - Erwartungen und Möglichkeiten. In: Familie und soziale Arbeit. Familienideal, Familienalltag - Neue Aufgaben für die soziale Arbeit. Frankfurt/Main 1987, S. 22-37
Lüscher, K.: Von der ökologischen Sozialisationsforschung zur Analyse familialer Aufgaben und Leistungen. Die Pragmatik familialen Handelns. In: Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hrsg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Bd. 1: Familienforschung. Neuwied 1989, S. 95-112
Lukesch, H.: Video im Alltag der Jugend. Quantitative und qualitative Aspekte des Videokonsums, des Videospielens und der Nutzung anderer Medien bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Regensburg 1989
Maier, E.: Die Bedeutung der Familie für eine prophylaktische Kinder-und Jugendhilfe. In: Unsere Jugend 1986, 38, S. 46-56
Marbach, J.: Soziale Netzwerke von Familien. Vortrag im Staatsinstitut für Frühpädagogik und Familienforschung. München, 04. Mai 1987
Marbach, J./Mayr-Kleffel, V./Stich, J./Wahl, K.: Familien in den 80er-Jahren. Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung des Deutschen Jugendinstituts, München. In: Familienpolitische Informationen 1987, 26, S. 28-30
Mattejat, F.: Pathogene Familienmuster. Theoretische und empirische Analysen zum Zusammenhang zwischen Familienmerkmalen und psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart 1985
Mayntz, R.: Die moderne Familie. Geschlechtsleben und Gesellschaft. Stuttgart 1955
Meves, C.: Typische Binnenprobleme der heutigen Familie. In: Schnyder, B. (Hrsg.): Familie - Herausforderung der Zukunft. Freiburg 1982, S. 47-60
Meyer, S./Schulze, E.: Von Liebe sprach damals keiner. Familienalltag in der Nachkriegszeit. München 1985
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): 3. Familienbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf o.J.
Mount, F.: Die autonome Familie. Plädoyer für das Private. Eine Geschichte des latenten Widerstandes gegen Kirche, Staat und Ideologen. Weinheim 1982
Mühlfeld, C.: Ehe und Familie. Opladen 1982
Münch, U.: Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Maßnahmen, Defizite, Organisation familienpolitischer Staatstätigkeit. Freiburg 1990
Nauck, B.: Zwanzig Jahre Migrantenfamilien in der Bundesrepublik Deutschland. Familiärer Wandel zwischen Situationsanpassung, Akkulturation und Segregation. In: Nave-Herz, R. (Hrsg.): Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1988, S. 279-297
Nauck, B.: Individualistische Erklärungsansätze in der Familienforschung: die rational-choice Basis von Familienökonomie, Ressourcen- und Austauschtheorien. In: Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hrsg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Bd. 1: Familienforschung. Neuwied 1989, S. 45-61
Nauck, B./Özel, S.: Erziehungsvorstellungen und Sozialisationspraktiken in türkischen Migrantenfamilien. Eine individualistische Erklärung interkulturell vergleichender empirischer Befunde. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 1986, 6, S. 285-312
Nave-Herz, R.: Familiäre Veränderungen seit 1950 - eine empirische Studie. Oldenburg 1984
Nave-Herz, R.: Gegenstandsbereich und historische Entwicklung der Familienforschung. In: Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hrsg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Bd. 1: Familienforschung. Neuwied 1989, S. 1-17
Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hrsg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung (2 Bde.). Neuwied 1989
Neidhardt, F.: Strukturbedingungen und Probleme familiärer Sozialisation. In: Lüschen, G./Lupri, E. (Hrsg.): Soziologie der Familie. Opladen 1970, S. 144-168
Neidhardt, F.: Die Familie in Deutschland. Gesellschaftliche Stellung, Struktur und Funktion. Opladen, 4. Aufl. 1975
Ohe, W. von der: Bayern im 19. Jahrhundert - ein Entwicklungsland? Möglichkeiten und Grenzen des Beitrages der vergleichenden Sozialforschung. In: Grimm, C. (Hrsg.): Linien der Entwicklungsgeschichte. Aufbruch ins Industriezeitalter (Bd. 1). München 1985, S. 169-202
Olbrich, E./Brüderl, L.: Frühes Erwachsenenalter: Partnerwahl, Partnerschaft und Übergang zur Elternschaft. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 1986, 18, S. 189-213
Oppitz, G.: Der Lebensstil junger Ehepaare - eine empirische Studie. In: Stiksrud, A./Wobit, F. (Hrsg.): Adoleszenz und Postadoleszenz. Beiträge zur angewandten Jugendpsychologie. Eschborn 1985, S. 242-253
Oswald, G.: Systemansatz und soziale Familienarbeit. Methodische Grundlagen und Arbeitsformen. Freiburg 1988
Peikert, I.: Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Entwicklungstendenzen. In: Reif, H. (Hrsg.): Die Familie in der Geschichte. Göttingen 1982, S. 114-136
Pfaff, A. B.: Finanzlage der Familie. Wirtschaftliche Verhältnisse und Auswirkungen sozialpolitischer Maßnahmen. In: Weigelt, K. (Hrsg.): Familie und Familienpolitik. Zur Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Melle 1985, S. 58-94
Pohl, K.: Wende - oder Einstellungswandel? Heiratsabsichten und Kinderwunsch 18-28jähriger deutscher Frauen 1978 und 1983. In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 1985, 11, S. 89-110
Reble, A.: Geschichte der Pädagogik. Stuttgart, 11. Aufl. 1971
Reimann, H.: Familienbeziehungen und Familienvorstellungen in der Jugend in der Bundesrepublik Deutschland. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 1986, 17, S. 128-143
Ricci, I.: Meine Eltern sind geschieden. Wie Kinder dennoch glücklich bleiben. München 1984
Richter, H. E.: Eltern, Kind und Neurose. Psychoanalyse der kindlichen Rolle. Reinbek 1969
Saller, H.: Sexueller Missbrauch von Kindern - ein soziales Problem. In: Arbeitsgemeinschaft von Einrichtungen für Familienbildung (Hrsg.): Sexueller Missbrauch von Kindern. Das Schweigen brechen. Bonn 1986, S. 15-33
Salloch-Vogel, R.-R.: Erwachsene Kinder suchtkranker Eltern: Was wird aus diesen Kindern? In: Brakhoff, J. (Hrsg.): Kinder von Suchtkranken. Situation, Prävention, Beratung und Therapie. Freiburg 1987, S. 11-24
Satir, V.: Conjoint family therapy: A guide to theory and technique. Revised edition. Palo Alto 1967
Satir, V.: Selbstwert und Kommunikation. Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe. München 1975
Scheele, M.: "Wilde Ehe" oder Trauschein? Im Vergleich: freie Partnerschaft und Ehe. München 1982
Schelsky, H.: Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft. Hamburg 1960
Schenk, H.: Wir leben zusammen - nicht allein. Wohngemeinschaften heute. Köln 1984
Schenk, J.: Die Begegnung der Geschlechter in der Ehe. Ein psychologischer Beitrag. In: Textor, M. R. (Hrsg.): Die Familie. Beiträge aus verschiedenen Forschungsbereichen. Frankfurt/Main 1984, S. 30-94
Schlumbohm, J. (Hrsg.): Kinderstuben. Wie Kinder zu Bauern, Bürgern, Aristokraten wurden. 1700-1850. München 1983
Schmidtchen, G.: Die Situation der Frau. Trendbeobachtungen über Rollen-und Bewusstseinsänderungen der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1984
Schober, K.: Die soziale und psychische Lage arbeitsloser Jugendlicher. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1987, 20, S. 453-478
Schönauer, R.: Eheliche Qualität und Stabilität. Ergebnisse und Hypothesen aus der angloamerikanischen Literatur. Wiesbaden 1983
Schütze, Y.: Die Geschwisterbeziehung im Sozialisationsprozess. Ein historischer Überblick. In: Baethge, M./Essbach, W. (Hrsg.): Soziologie: Entdeckungen im Alltäglichen. Frankfurt/Main 1983, S. 44-64
Schütze, Y.: Geschwisterbeziehungen. In: Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hrsg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Bd. 1: Familienforschung. Neuwied 1989, S. 311-324
Schuhmacher, H.: Wie halte ich mit meinem Einkommen Haus? Berlin 1910
Schuler, T.: Familien im Mittelalter. In: Reif, H. (Hrsg.): Die Familie in der Geschichte. Göttingen 1982, S. 28-60
Schulz, W.: Familie und Lebensqualität im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung. In: Schattovits, H./Schulz, W. (Hrsg.): Die Familie in Europa auf dem Weg in das Jahr 2000. Wien 1983, S. 34-52
Schulze, H.-J./Tyrell, H./Künzler, J.: Vom Strukturfunktionalismus zur Systemtheorie der Familie. In: Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hrsg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Bd. 1: Familienforschung. Neuwied 1989, S. 31-43
Schwägler, G.: Soziologie der Familie. Ursprung und Entwicklung. Tübingen, 2. Aufl. 1975
Schwarz, K./Höhn, C.: Weniger Kinder - weniger Ehen - weniger Zukunft? Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland gestern, heute und morgen. Ottweiler 1985
Schwarzenauer, W.: Was macht eine Ehe glücklich? Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. In: Partnerberatung 1980, 17, S. 49-66
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Christlich gelebte Ehe und Familie. Ein Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn l975
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches Schreiben "Familiaris Consortio" von Papst Johannes Paul II über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute. Bonn 1981
Siewert, H. H.: Scheidung - Wege zur Bewältigung. München 1983
Simm, R.: Junge Frauen in Partnerschaft und Familie. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 1989, B 28, S. 34-39
SINUS-Institut: Die verunsicherte Generation. Jugend und Wertewandel. Opladen 1983
SINUS-Institut: Jugend privat. Verwöhnt? Bindungslos? Hedonistisch? Opladen 1985
Sozialreferat der Landeshauptstadt München: Zur Situation von Familien in München: Auswertung der Familienuntersuchung I und II. München 1981
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1985. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1985
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1987. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1987a
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 1987 für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1987b
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Gebiet und Bevölkerung 1985. Stuttgart 1987c
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 1989 für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1989
Stein, A.: Selbstbild und Erziehungsverständnis junger Elternpaare. Ein Beitrag zur Analyse innerfamiliärer Rollenbeziehungen in der Erziehungssituation. Konstanz 1983
Steinkamp, G.: Arbeitsplatzerfahrung und familiale Sozialisation. Ergebnisse und Probleme einer empirischen Untersuchung an Eltern und Kindern. In: Vascovics, L. A. (Hrsg.): Umweltbedingungen familialer Sozialisation. Beiträge zur sozialökologischen Sozialisationsforschung. Stuttgart 1982, S. 120-142
Stierlin, H.: "Rolle" und "Auftrag" in der Familientheorie und -therapie. In: Familiendynamik 1976, 1, S. 36-59
Stierlin, H.: Perspektiven der Familientheorie und -therapie. In: Medizin, Mensch, Gesellschaft 1977, 2, S. 188-193
Strätling-Tölle, H.: Ehe und Familie heute - Krisenmomente und ihre Ursachen. Versuch einer Situationsanalyse unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten. In: Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung (Hrsg.): Die so genannte "Krise". Probleme um Ehe und Familie heute. Bonn 1981, S. 25-57
Strauß, M.: Die Not der jungen Familien. In: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft (Hrsg.): Familienpolitische Defizite unseres sozialen Systems. Ottweiler 1984, S. 74-79
Stützle, H.: Familie, Jugendliche und Wohnen (Manuskript). München 1986a
Stützle, H.: Materielle und persönliche Hilfen für sozial benachteiligte und einkommensschwache Familien bei der Sicherung und Erhaltung der Familienwohnungen. In: Zeitschrift für das gemeinnützige Wohnungswesen in Bayern 1986b, 76, S. 630-640
Swientek, C.: Alleinerziehende - Familien wie andere auch? Zur Lebenssituation von Ein-Eltern-Familien. Bielefeld 1984
Textor, M. R.: Einleitung. In: Textor, M. R. (Hrsg.): Die Familie. Beiträge aus verschiedenen Forschungsbereichen. Frankfurt/Main 1984, S. I-III
Textor, M. R.: Integrative Familientherapie. Eine systematische Darstellung der Konzepte, Hypothesen und Techniken amerikanischer Therapeuten. Berlin 1985
Textor, M. R.: Erklärungsmodelle und Behandlungsansätze für Verhaltensstörungen und psychische Probleme. Die Notwendigkeit der Integration. In: Soziale Arbeit 1988, 37, S. 129-134
Textor, M. R.: The divorce transition. In: Textor, M. R. (Hrsg.): The divorce and divorce therapy handbook. Northvale 1989a, S. 3-43
Textor, M. R.: Drogensucht und Familie. In: Familiendynamik 1989b, 14, S. 13-26
Textor, M. R. (Hrsg.): Hilfen für Familien. Ein Handbuch für psychosoziale Berufe. Frankfurt/Main 1990
Textor, M. R.: Familienpolitik. München 1991
Textor, M. R./Schobert, K.: Familienzyklus und -therapie. In: Textor, M. R. (Hrsg.): Das Buch der Familientherapie. Sechs Schulen in Theorie und Praxis. Frankfurt, 3. Aufl. 1988, S. 249-263
Visher, E. B./Visher, J. S.: Stiefeltern, Stiefkinder und ihre Familien. Probleme und Chancen. München 1987
Vollbrecht, R.: Die Entstehung der modernen Familie. Umrisse einer Theorie der Privatheit. München 1983
Wahl, K./Stich, J./Seidenspinner, G.: Das Innenleben der modernen Familie - Messungen auf schwierigem Terrain. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Familienalltag. Frauensichten - Männersichten. Reinbeck 1989, S. 24-53
Wallner, E. M./Pohler-Funke, M.: Soziologie der Familie. Heidelberg 1977
Waninger, H.: Einstellungen von Landfrauen zu Fragen der Sexualität und Sexualerziehung und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder. Frankfurt/Main 1982
Weber, A.: Immer auf dem Sofa. Das familiäre Glück vom Biedermeier bis heute. Berlin l982
Weber-Kellermann, I.: Die Familie. Geschichte, Geschichten und Bilder. Frankfurt/Main 1976
Weber-Kellermann, I.: Die Kindheit. Kleidung und Wohnen, Arbeit und Spiel. Eine Kulturgeschichte. Frankfurt/Main 1979
Weckowicz, T.: Models of mental illness: Systems and theories of abnormal psychology. Springfield 1984
Weins, W.: Problemfamilien im Gemeindekontext. Eine theoretische und empirische Analyse. Stuttgart 1983
Weiß, W. W.: Familienleben in unserer Gesellschaft. Nürnberg 1985
Werner, J.: Die Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern unter 15 Jahren und die Situation der Kinderbetreuung in Baden-Württemberg. Stuttgart: 1984
West, M. O./Prinz, R. J.: Parental alcoholism and childhood psychopathology. In: Psychological Bulletin 1987, 102, S. 204-218
Whitbourne, S. K./Weinstock, C. S.: Die mittlere Lebensspanne. Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters. München 1982
Wingen, M.: Nichteheliche Lebensgemeinschaften. Formen - Motive - Folgen. Zürich 1984
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen: Familien mit Kleinkindern. Spezifische Belastungssituationen in der frühkindlichen Entwicklung. Stuttgart 1980
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen: Familie und Arbeitswelt. Stuttgart 1984
Zenke, K. G./Ludwig, G.: Kinder arbeitsloser Eltern (I). In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik 1985a, 93, S. 96-98
Zenke, K. G./Ludwig, G.: Kinder arbeitsloser Eltern (II). In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik 1985b, 93, S. 114-118
Zenke, K. G./Ludwig, G.: Kinder arbeitsloser Eltern. Erfahrungen, Einsichten und Zwischenergebnisse aus einem laufenden Projekt. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1985c, 18, S. 265-278
Zentralstelle für rationales Haushalten: Damit können Sie rechnen - so viel kostet das erste Kind. Stuttgart 1990
Zimmermann, K. F.: Familienökonomie. Theoretische und empirische Untersuchungen zur Frauenerwerbstätigkeit und Geburtenentwicklung. Berlin-West 1985.